 Aktuell macht ein „Framing Manual“ die Runde durch Redaktionen. Das 89-seitige Dokument stammt vom Berkeley International Framing Institut und wurde im Auftrag der ARD erstellt. In dem an ARD-Mitarbeiter gerichteten Papier wird umfangreich beschrieben, wie mit Hilfe des so genannten Framings Sichtweisen in die öffentliche Debatte eingebracht werden können. ARD-Generalsekretärin Susanne Pfab über Manual und die Kritik daran:
Aktuell macht ein „Framing Manual“ die Runde durch Redaktionen. Das 89-seitige Dokument stammt vom Berkeley International Framing Institut und wurde im Auftrag der ARD erstellt. In dem an ARD-Mitarbeiter gerichteten Papier wird umfangreich beschrieben, wie mit Hilfe des so genannten Framings Sichtweisen in die öffentliche Debatte eingebracht werden können. ARD-Generalsekretärin Susanne Pfab über Manual und die Kritik daran:
 Entsteht durch bloße Digitalisierung eines gemeinfreien Werks ein neues Schutzrecht am Foto oder Scan? Darüber haben die Reiss-Engelhorn-Museen seit drei Jahren mit der Wikimedia Foundation vor Gericht gestritten. In der mündlichen Verhandlung beim Bundesgerichtshof hatten Freunde der Gemeinfreiheit wenig zu lachen. (Dieses Bild des Reiss-Engelhorn-Museum wird auf Wikimedia Commons trotz BGH-Urteils verfügbar bleiben. Es steht unter einer Creative-Commons-Lizenz und fällt unter die Panoramafreiheit des deutschen Urheberrechts. CC-BY 3.0 Hubert Berberich). Wer allerdings künftig einen Museumsbesuch plant, sollte auf den Besichtigungsvertrag achten.
Entsteht durch bloße Digitalisierung eines gemeinfreien Werks ein neues Schutzrecht am Foto oder Scan? Darüber haben die Reiss-Engelhorn-Museen seit drei Jahren mit der Wikimedia Foundation vor Gericht gestritten. In der mündlichen Verhandlung beim Bundesgerichtshof hatten Freunde der Gemeinfreiheit wenig zu lachen. (Dieses Bild des Reiss-Engelhorn-Museum wird auf Wikimedia Commons trotz BGH-Urteils verfügbar bleiben. Es steht unter einer Creative-Commons-Lizenz und fällt unter die Panoramafreiheit des deutschen Urheberrechts. CC-BY 3.0 Hubert Berberich). Wer allerdings künftig einen Museumsbesuch plant, sollte auf den Besichtigungsvertrag achten.
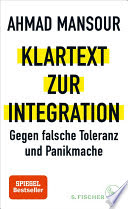 Warum Integration bisweilen nicht funktioniert, beschreibt Ahmad Mansour in aller Deutlichkeit in seinem im S. Fischer Verlag erschienenen Buch am Beispiel eines Bekannten namens Nader. Wer Nader frage, was er sei, bekomme zur Antwort „Palästinenser und Moslem“, obgleich Nader schon seit Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit besitze. Nader gebe sich als Patriarch. Er sagt seiner Frau und seinen Kindern, was sie zu tun haben. Er arbeitet schwarz und nimmt die Unterstützung der Behörden mit. Was er für seine Kinder wünsche? „Sie sollen die Ehre der Familie hochhalten. Sie sollen wissen, woher sie kommen, wissen, dass sie Palästinenser sind und sonst nichts – und auf mich hören.“ Soweit der Bürger Nader, der „mittendrin“ in einer Parallelgesellschaft lebe. Man liest diese Beschreibung eines Menschen und fragt sich: Warum sollte er sich ändern, nachdem er von Gaza nach Berlin gezogen ist? In seiner Welt ist er der Chef.
Warum Integration bisweilen nicht funktioniert, beschreibt Ahmad Mansour in aller Deutlichkeit in seinem im S. Fischer Verlag erschienenen Buch am Beispiel eines Bekannten namens Nader. Wer Nader frage, was er sei, bekomme zur Antwort „Palästinenser und Moslem“, obgleich Nader schon seit Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit besitze. Nader gebe sich als Patriarch. Er sagt seiner Frau und seinen Kindern, was sie zu tun haben. Er arbeitet schwarz und nimmt die Unterstützung der Behörden mit. Was er für seine Kinder wünsche? „Sie sollen die Ehre der Familie hochhalten. Sie sollen wissen, woher sie kommen, wissen, dass sie Palästinenser sind und sonst nichts – und auf mich hören.“ Soweit der Bürger Nader, der „mittendrin“ in einer Parallelgesellschaft lebe. Man liest diese Beschreibung eines Menschen und fragt sich: Warum sollte er sich ändern, nachdem er von Gaza nach Berlin gezogen ist? In seiner Welt ist er der Chef.

 Hermann Maas rettete in der Zeit des Nationalsozialismus zahlreichen Juden sowie anderer dem Regime kritischen Menschen das Leben.
Hermann Maas rettete in der Zeit des Nationalsozialismus zahlreichen Juden sowie anderer dem Regime kritischen Menschen das Leben.
(Bunsen-Gymnasium HD):
In Erinnerung an die Person und das Wirken des ehemaligen Heidelberger Heiliggeistpfarrers und badischen Prälaten initiiert die Stadt Heidelberg eine neue Vortragsreihe mit dem Titel „Hermann-Maas-Reden“. Im zweijährigen Turnus sollen hochkarätige Vorträge gehalten werden.

 Das Recht auf Wasser ist ein Menschenrecht! Doch Nestlé-Verwaltungsratschef Peter Brabeck macht kein Geheimnis daraus, dass Wasser in seinen Augen kein öffentliches Gut sein sollte, sondern auch einen Marktwert wie jedes andere Lebensmittel benötige. In Algerien hat Nestlé die Wassernutzungsrechte erworben und lässt die Fabriken bewachen und einzäunen. In Pakistan das Gleiche. In diesen Ländern wird das Wasser angezapft und für viel Geld in Plastikflaschen verkauft, während die Bevölkerung keinen Zugang mehr zu diesem Wasser hat.
Das Recht auf Wasser ist ein Menschenrecht! Doch Nestlé-Verwaltungsratschef Peter Brabeck macht kein Geheimnis daraus, dass Wasser in seinen Augen kein öffentliches Gut sein sollte, sondern auch einen Marktwert wie jedes andere Lebensmittel benötige. In Algerien hat Nestlé die Wassernutzungsrechte erworben und lässt die Fabriken bewachen und einzäunen. In Pakistan das Gleiche. In diesen Ländern wird das Wasser angezapft und für viel Geld in Plastikflaschen verkauft, während die Bevölkerung keinen Zugang mehr zu diesem Wasser hat.
Der Bundesgerichtshof hat im Fall Reiss-Engelhorn-Museum versus Wikimedia-Stiftung eine katastrophale urheberrechtliche Entscheidung getroffen, über die in Netzpolitik Leonhard Dobusch berichtet: „Einfaches Abfotografieren gemeinfreier Werke erzeugt Bilder, die 50 Jahre urheberrechtlich geschützt sind.“ Das Museum hatte gegen die Stiftung, die die Wikipedia betreibt, prozessiert, weil sie ein an sich rechtefreies Richard-Wagner-Porträt aus dem Museum abgebildet hatte (mehr hier im Blog des Marta-Museums, das eine völlig andere Position hat als das Mannheimer Museum). Bilder von Urhebern, die mehr als siebzig Jahre tot sind und an sich frei zirkulieren können müssten, werden nun nicht mehr zugänglich sein: „Und zwar geht das so: unter Verweis auf das Hausrecht wird Museumsbesuchern verboten, selbst ein Foto eines gemeinfreien Werkes anzufertigen. Gleichzeitig sind die vom Museum selbst, zum Beispiel für einen Ausstellungskatalog, in Auftrag gegebenen Scans oder Fotos des Werkes als ‚Lichtbild‘ gemäß § 72 Abs. 1 UrhG für weitere fünfzig (!) Jahre geschützt.“ Damit hat der BGH die Gemeinfreiheit praktisch abgeschafft.
 Mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche haben deutschlandweit den Unterricht verlassen. 500 von ihnen sind in Berlin vor das Reichstagsgebäude gezogen. Vor Ort erklären sie, was sie dazu bringt. Klar doch, Schuleschwänzen klingt für viele Jugendliche erst einmal verlockend. Aber am Freitagmorgen ist es kalt. Die Pfützen sind gefroren, Kinder tragen dicke Jacken. Im Klassenzimmer wäre es jetzt wärmer als auf dem Platz vor dem Bundestag. Dennoch haben sich hier um die 500 Kinder und Jugendliche um 10 Uhr verabredet. Sie schwänzen die Schule nicht einfach so: Die Schüler streiken für eine klimafreundliche Politik.
Mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche haben deutschlandweit den Unterricht verlassen. 500 von ihnen sind in Berlin vor das Reichstagsgebäude gezogen. Vor Ort erklären sie, was sie dazu bringt. Klar doch, Schuleschwänzen klingt für viele Jugendliche erst einmal verlockend. Aber am Freitagmorgen ist es kalt. Die Pfützen sind gefroren, Kinder tragen dicke Jacken. Im Klassenzimmer wäre es jetzt wärmer als auf dem Platz vor dem Bundestag. Dennoch haben sich hier um die 500 Kinder und Jugendliche um 10 Uhr verabredet. Sie schwänzen die Schule nicht einfach so: Die Schüler streiken für eine klimafreundliche Politik.
taz gewinnt gegen Bayer: Der Chemie-Riese wollte eine satirische Titelseite zum Pflanzengift Glyphosat per Abmahnung verbieten lassen. Die „taz“ reagierte gelassen mit einer negativen Feststellungsklage, die Bayer untersagt, ohne Urteil ein Verbot zu verlangen. Bayer gibt klein bei und zieht die Abmahnung zurück. Titelseiten der taz sind bekannt für ihren Humor. Am 24. Oktober 2018 zum Beispiel druckte die Zeitung eine Persiflage auf Pharmaanzeigen. Vor einem grellen rosa Hintergrund prangte die Schlagzeile „Das Krebs-Rundumpaket“.
Der Untertitel (das wird bei Bayer wohl nicht so gern gelesen worden sein) pries eine Recherche auf der Seite 3 an: „Der Bayer-Konzern vertreibt Glyphosat, ein Mittel, das wohl Krebs verursacht. Er verkauft aber auch eines, das Krebs heilen soll“. Daneben schwebte auf einer Wolke eine Sprühflasche mit dem Glyphosat-haltigen Pestizid „Roundup“, flankiert von einem Sternsymbol mit der Aufschrift „Super: macht Krebs“.
Auf dem anderen Ende der Wolke flog das Bayer-Medikament „Aliqopa“, das bei genau der Krebsart helfen soll, die Wissenschaftler auch mit Glyphosat in Verbindung bringen. Hier stand – ebenfalls in einem Stern: „Super: heilt Krebs“.
 »Ich wurde zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt – vier Monate vor Hitlers Machtergreifung – in Prag geboren«, so beginnen Saul Friedländers 2016 herausgegebenen Memoiren „Wohin die Erinnerung führt“. Der Anfang seiner Autobiografie steht in gewissem Sinne auch exemplarisch für Friedländers Methode als Historiker.
»Ich wurde zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt – vier Monate vor Hitlers Machtergreifung – in Prag geboren«, so beginnen Saul Friedländers 2016 herausgegebenen Memoiren „Wohin die Erinnerung führt“. Der Anfang seiner Autobiografie steht in gewissem Sinne auch exemplarisch für Friedländers Methode als Historiker.
Anders nämlich als etwa Raul Hilberg, der Pionier der Erforschung der Vernichtungspolitik, hat Friedländer in seinem Standardwerk „Das Dritte Reich und die Juden“ nicht nur den mörderischen Vernichtungsapparat geschildert, sondern immer auch die Schicksale der Menschen berücksichtigt. »Die Juden kamen ja meist nur als Opferzahlen vor. Ich wollte den Ermordeten ihre Stimme zurückgeben«, sagte Friedländer jüngst.


