 Zum 1. Juli können Angestellte in Griechenland sechs Tage die Woche arbeiten – für 40 Prozent mehr Gehalt. In Deutschland gilt die 40-Stunden-Woche. Doch ist das dann noch zeitgemäß? Hannah Scherkamp und David Gutensohn haben dazu unterschiedliche Meinungen.
Zum 1. Juli können Angestellte in Griechenland sechs Tage die Woche arbeiten – für 40 Prozent mehr Gehalt. In Deutschland gilt die 40-Stunden-Woche. Doch ist das dann noch zeitgemäß? Hannah Scherkamp und David Gutensohn haben dazu unterschiedliche Meinungen.
Pro: Jeder sollte mehr arbeiten dürfen, wenn er – sie – das will …
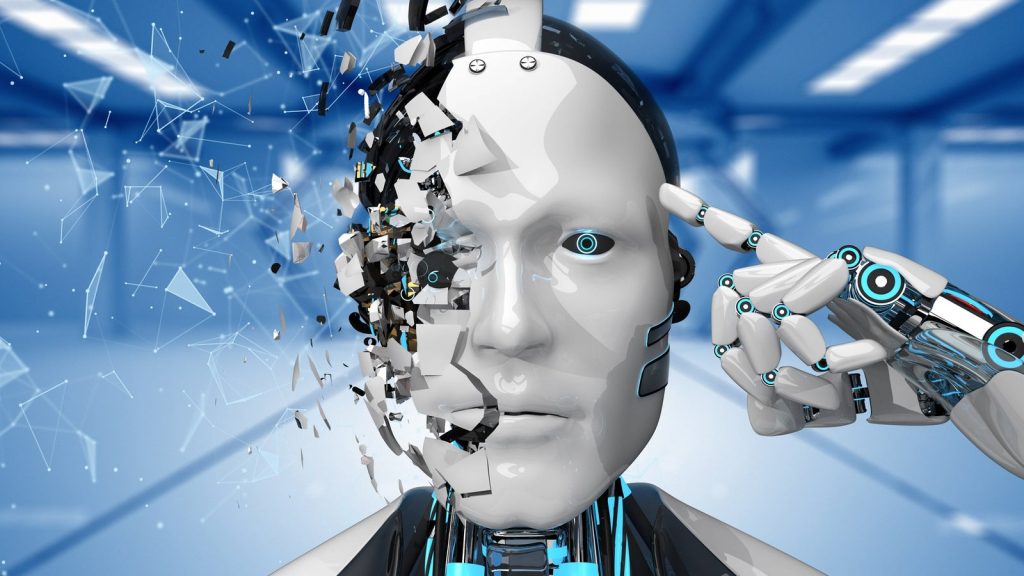 > Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat ein Playbook zu Künstlicher Intelligenz veröffentlicht. Neun Autoren beschäftigen sich mit der Herkunft, dem Status Quo und den Herausforderungen bei der Arbeit mit KI, insbesondere mit generativer KI. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
> Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat ein Playbook zu Künstlicher Intelligenz veröffentlicht. Neun Autoren beschäftigen sich mit der Herkunft, dem Status Quo und den Herausforderungen bei der Arbeit mit KI, insbesondere mit generativer KI. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
 Am vergangenen Donnerstag meldete die Polizei im Kreis Unna, dass ein Achtjähriger an seiner Grundschule in der Stadt Selm unter unklaren Umständen leicht verletzt wurde. Daraus wäre vermutlich keine überregionale Nachricht geworden, wenn die „Bild“-Zeitung all die Fragezeichen, die die Meldung enthielt, nicht zuvor schon mit einem Ausrufezeichen und einer Schlagzeile beantwortet hätte. Von einem „Großalarm an der Overbergschule in Selm (NRW)!“ berichtete sie und behauptete, dass „ein Mann, möglicherweise ein Obdachloser, mit einem Messer auf ein Kind (8) losgegangen“ sei. „Nach der ersten Attacke soll der Mann das Buttermesser in Richtung eines anderen Kindes geschleudert haben. Dann soll der Verdächtige geflüchtet sein. Die Fahndung läuft. Das Messer wurde gefunden und von der Polizei sichergestellt.“
Am vergangenen Donnerstag meldete die Polizei im Kreis Unna, dass ein Achtjähriger an seiner Grundschule in der Stadt Selm unter unklaren Umständen leicht verletzt wurde. Daraus wäre vermutlich keine überregionale Nachricht geworden, wenn die „Bild“-Zeitung all die Fragezeichen, die die Meldung enthielt, nicht zuvor schon mit einem Ausrufezeichen und einer Schlagzeile beantwortet hätte. Von einem „Großalarm an der Overbergschule in Selm (NRW)!“ berichtete sie und behauptete, dass „ein Mann, möglicherweise ein Obdachloser, mit einem Messer auf ein Kind (8) losgegangen“ sei. „Nach der ersten Attacke soll der Mann das Buttermesser in Richtung eines anderen Kindes geschleudert haben. Dann soll der Verdächtige geflüchtet sein. Die Fahndung läuft. Das Messer wurde gefunden und von der Polizei sichergestellt.“
Von dem „möglicherweise“ und den „soll es“ im Artikel blieb in der Schlagzeile nichts übrig:
 Die jüngst erhobenen Vorwürfe, der französische Philosoph Michel Foucault habe Knaben missbraucht, werfen die Frage auf, ob man zwischen Leben und Werk wirklich trennen kann. Und wie integer große Denker sein müssen. „Er wurde geboren, lebte und starb“, mit diesem Standardsatz hat Martin Heidegger in seinen Vorlesungen über Aristoteles die Biografie des Philosophen abgehandelt. Das konkrete Leben ist belanglos, wollte Heidegger damit sagen. Uns hat nur das reine Werk zu interessieren.
Die jüngst erhobenen Vorwürfe, der französische Philosoph Michel Foucault habe Knaben missbraucht, werfen die Frage auf, ob man zwischen Leben und Werk wirklich trennen kann. Und wie integer große Denker sein müssen. „Er wurde geboren, lebte und starb“, mit diesem Standardsatz hat Martin Heidegger in seinen Vorlesungen über Aristoteles die Biografie des Philosophen abgehandelt. Das konkrete Leben ist belanglos, wollte Heidegger damit sagen. Uns hat nur das reine Werk zu interessieren.

Die Seinen oder nicht. wie auch immer: Beide „Parteien“ scheinen nicht glücklich …
Alsdann: Wie steht es um die „acuity“ von Donald Trump, die intellektuelle Schärfe des 78‑Jährigen? Bei seinen Auftritten erzählt er immer seltsamere Geschichten. Macht nichts, sagen manche: Wenn er jetzt zusehends abbaue, werde er als Präsident leichter steuerbar sein. Donald Trump (78) und Joe Biden (81) haben bei allen politischen Gegensätzen eins gemeinsam: Beide machen ihre Berater nervös, wenn sie zu längeren, frei formulierten Erklärungen ansetzen. Die alten Herren verwechseln gern mal was. Zwei harmlose Fälle: Biden warnte vor laufenden Kameras die israelische Regierung davor, „in Haifa einzumarschieren“.Das ist eine Hafenstadt im Norden Israels. Biden meinte Rafah im Süden des Gazastreifens. Donald Trump wiederum warnte Biden vor einer Politik, die „am Ende in einen Zweiten Weltkrieg hineinführt“ – und den hatten wir auch schon
Woran erkennt man hochsensible Kinder? Leo (alle Namen v. d. Red. geändert) ist sieben Jahre alt und liebt Fußball. Seine Kindermannschaft trainiert heute in der Halle. Kaum wird angepfiffen, rennt er, kickt und hat den Ball immer im Auge. Eine Viertelstunde später steht er reglos am Rand des Feldes. Die Augen weit aufgerissen starrt er auf die anderen Kinder, die sich lautstark um den Ball balgen. Als der Trainer Leos Abwesenheit bemerkt, führt er ihn hinaus in die Umkleidekabine. Hier ist es still und Leo löst sich langsam wieder aus seiner Starre. „Fußballspielen ist echt cool!“, sagt der Siebenjährige und grinst. Leo ist kein Problemkind oder leidet gar unter einer Krankheit. Ganz im Gegenteil: er ist nur ein wenig anders. Genauer gesagt – hochsensibel.
Die Flut der Sinnesreize
Im Alltag werden wir von unzähligen Reizen überflutet. Geräusche, Gerüche, Bilder und Berührungen stürmen unaufhörlich auf uns ein. Um diese Fülle an Informationen verarbeiten zu können, ist das menschliche Gehirn mit einem Filtersystem ausgestattet, das einen großen Teil der Sinneswahrnehmungen gar nicht erst bis ins Bewusstsein vordringen lässt. Diese Filterfunktion unseres Gehirns, die das Nervensystem vor Überlastung schützt, ist bei Hochsensiblen durchlässiger. Bei ihnen können viel mehr Reize bis ins Bewusstsein vordringen ohne zuvor „aussortiert“ zu werden. Diese neuronale Besonderheit zeigt zwei Gesichter: einerseits erleben Hochsensible die Welt differenzierter und intensiver, weil ihnen mehr Informationen zur Verfügung stehen. Andererseits führt diese Überfülle an bewusst wahrgenommenen Sinnesreizen schnell zur Überlastung von Körper und Seele.
Das Fußballtraining überfordert Leos Reizkanäle: die vielen Kinder, die sich schnell bewegen, dazu der Lärmpegel, der in der Halle besonders hoch ist. Hochsensible Kinderfühlen sich schneller gestresst oder überfordert, selbst bei schönen Erlebnissen wie Geburtstagsfeiern oder Zoobesuchen. Hochsensible haben feine Antennen für die Schwingungen in ihrer Umgebung, weshalb schulischer Druck oder Erwartungen von Außen bei ihnen früher Überlastungserscheinungen auslösen als bei Normalsensiblen. Noch dazu sind sie kleine Perfektionisten. Um der Reizüberflutung ein Stück weit zu entkommen, suchen hochsensible Kinder häufig nach Rückzugsmöglichkeiten in der Sicherheit einer ruhigen Umgebung und in der Nähe von vertrauten Menschen.
So wie Bastian. Um sich an fremde Menschen, neue Situationen oder eine unbekannte Umgebung zu gewöhnen, benötigt der Dreieinhalbjährige viel Zeit. Es dauerte mehrere Monate bis Bastian so viel Vertrauen zu einer seinen Erzieherinnen schöpfte, dass er sich traute einen ganzen Tag lang im Kindergarten zu verbringen. Auch der Fußballer Leo kann sich nur schlecht konzentrieren, wenn im Klassenzimmer nicht genug Ruhe herrscht. Deshalb sitzt er inzwischen in der ersten Reihe, damit sich sein Sichtfeld auf die Lehrerin an der Tafel beschränkt und sich die Reize des vollen Klassenraumes nicht noch dazwischen schieben.
Eine unsensible Umgebung macht krank
Problematisch wird das Leben eines hochsensiblen Kindes, wenn die Familie keine Strategien findet, mit dieser Besonderheit umzugehen. Oder noch schlimmer, wenn das „Anderssein“ negativ bewertet wird und Anpassungsdruck folgt. Elisa Mutmann, die Mutter von Leo, aus dem niedersächsischen Winsen an der Luhe, ist selbst hochsensibel und hat einen Leidensweg hinter sich, den sie ihrem Sohn ersparen möchte. Wenn sie als Kind empfindlich oder emotional reagierte, erntete sie oft vorwurfsvolle Kommentare: „Sei nicht so theatralisch! Stell dich um Himmelswillen nicht so an!“ Elisa Mutmanns familiäre und schulische Umgebung hat ihr von Klein auf vermittelt, dass sie „falsch tickte“.
Hochsensibilität ist aber keine psychische Fehlfunktion und muss deshalb nicht therapiert werden im Sinne einer Krankheit. Die Betroffenen können ihr Empfinden auch nicht ausblenden, wie Kinderarzt Dr. Bernd Seitz weiß, der sich seit längerem mit Hochsensibilität bei Kindern beschäftigt. Wenn dem Hochsensiblen Ausdrucksmöglichkeiten verweigert werden und er sich aufgrund seines „Andersseins“ an den Rande der Gesellschaft gedrängt fühlt, zieht dies gesundheitliche Folgen nach sich. Elisa Mutmann, heute trockene Alkoholikerin, floh damals in die Sucht, weil sie ihr Leben als gescheitert empfand. Bei Bastians hochsensibler Mutter Karin Sanden aus Schenefeld in Schleswig-Holstein führte die Missachtung der eigenen Bedürfnisse zum Burnout-Syndrom.
Die Dauerüberreizung kann sich nicht nur als Wurzel psychischer Folgeprobleme entpuppen, sondern sich auch in körperlichen Beschwerden niederschlagen. Typisch sind Verspannungen, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, Infektanfälligkeit, Allergien, Rheuma und Asthma. Der Körper reagiert ebenso sensibel wie der Geist. Dr. Bernd Seitz weist darauf hin, dass bei Hochsensiblen das körperliche Schmerzempfinden stärker ausgeprägt ist, Medikamente schon bei einer geringeren Dosis als üblich wirksam werden und leichter Nebenwirkungen auftreten.
Der dreieinhalbjährige Bastian reagierte schon als Baby körperlich auf Reize in seiner Umgebung, mit denen er nicht umgehen konnte. Wenn die Eltern gestresst waren, übertrug sich die Stimmung direkt auf das Baby. In diesen Situationen hustete und spuckte Bastian bis sich seine Umgebung wieder beruhigt hatte. Auch der Grundschüler Leo merkt seine Grenzen schnell. Wenn der Schultag stressig ist und zu viel Unruhe ihn überfordert, leidet er unter Migräne.
Nicht therapieren, sondern ernst nehmen
Negative Folgen entstehen, wenn sich das hochsensible Kind im Konflikt mit einer verständnislosen Außenwelt sieht. Das kann leicht passieren, denn unser gesellschaftliches Wertesystem ist so angelegt, dass Leistungsorientierung, Konkurrenzdenken und Teamgeist schon früh als Norm vermittelt werden. Das widerspricht dem Empfinden Hochsensibler, denn ihre innere Richtschnur orientiert sich an Werten wie Innerlichkeit, Gerechtigkeit und Ausgleich. Außerdem ist unser Schulsystem auf die Vermittlung logischer und faktischer Inhalte ausgerichtet. Fantasie und Kreativität kommen dagegen zu kurz. Erhalten hochsensible Kinder nicht genug Freiräume ihre reiche Innenwelt auszudrücken und ihre Werte zu leben, empfinden sie sich zunehmend als „anders“, „unnormal“, „falsch“. Deshalb ist es wichtig, die Bedürfnisse hochsensibler Kindern ernst zu nehmen, selbst wenn diese gegen gängige Ratschläge für Eltern oder gegen gesellschaftliche Erwartungen verstoßen.
Karin Sanden hatte eine Weile lang versucht ihren Sohn vom elterlichen Bett zu entwöhnen, gemäß einer pädagogischen Empfehlung, die für normalsensible Kinder durchaus sinnvoll ist. Bastian weinte viel, schlief schlecht und war unausgeglichen. Bis seine Mutter einen Strategiewechsel vornahm. Nun haben sich die Sandens eine extragroße Matratze zugelegt, auf der Bastian seinen festen Schlafplatz bei den Eltern hat. Das Gefühl der Nähe, das der Dreieinhalbjährige sich nachts im elterlichen Bett holen kann, macht ihn tagsüber ausgeglichener und selbstständiger.
Als der Grundschüler Leo den Schwimmkurs besuchte, wie seine Lehrer empfahlen, schreckten ihn das Gewusel im Wasser, die vielen Kinder und der Lärmpegel im Hallenbad ab. In den Sommerferien im Pool einer befreundeten Familie dagegen hatte der Siebenjährige große Freude am Plantschen. Leos Eltern zogen daraus die Konsequenz, dass er das Schwimmen nun nicht im Schwimmkurs, sondern im Pool der Freunde lernen wird.
Die Gabe der Hochsensibilität
Wenn das Umfeld – die Familie, Kita oder Schule –die Bedürfnisse der hochsensiblen Kinder zulässt, anstatt ihr Anderssein zu kritisieren, ist der wichtigste Schritt erfolgt. Dann können die Kinder das Potenzial entfalten, das die Hochsensibilität mit sich bringt. Ihr Feingefühl für Zwischentöne und Befindlichkeiten anderer Menschen macht sie zu Vermittlern, denen Harmonie und das Wohlbefinden der Gemeinschaft wichtig sind. Sie besitzen ein inneres Wertesystem, das früher als bei Gleichaltrigen stark ausgeprägt ist. Hochsensible teilen beispielsweise gerne aufgrund ihres starken Gerechtigkeitsempfindens. Elisa Mutmann hat ihre Talente bei der Berufswahl genutzt: sie arbeitet als Gesprächstherapeutin, ein Beruf, bei dem es auf Einfühlung und Vermittlung ankommt.
Viele hochsensible Kinder sind sehr wissensdurstig und phantasievoll. Frühzeitig entwickeln sie ein differenziertes sprachliches Ausdrucksvermögen und die Fähigkeit zu komplexem Denken. Beim Fußballfan Leo koppelt sich Hochsensibilität an Hochbegabung – die Eltern suchen noch nach Möglichkeiten ihn gezielt zu fördern, ohne ihn mit einem Überangebot zu überfordern.
Aufgrund einer angeborenen Schwachstelle im Zwerchfell ist Bastians Entwicklung verzögert. Der Dreieinhalbjährige spricht bisher nur wenige Worte. Doch diesen Nachteil macht er auf kreative Weise wett: er komponiert kleine Geräuschsymphonien und untermalt sie mit ausdrucksstarken Bewegungen. Er reißt die Arme hoch, rollt die Augen, verzieht sein Gesicht und gluckst dann wieder aus voller Kehle. Musik ist für ihn frühe Begabung und Kommunikationsmittel zugleich
Begleitung statt Behandlung von besonderen Kindern
Beide Familien hatten seit dem Babyalter den diffusen Verdacht, dass ihre Kinder sich von Gleichaltrigen unterscheiden. Bei Leo war es der starke Kontrast zwischen fordernder Wissbegier und rascher Überforderung, der die Eltern stutzig machte. Als er in die Schule kam und oft nur weinte, begannen Sie, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Karin Sanden empfand Bastian von Geburt an als dünnhäutig – er reagierte körperlich auf jede Stimmung in seiner Umgebung, was Mutter und Kind sehr belastete.
Beide Familien waren lange Zeit auf der Suche, ohne zu wissen, wonach sie eigentlich konkret suchen sollten, als sie durch Zufall mit Aurum Cordis in Kontakt kamen. Das Zentrum für hochsensible Menschen bietet Eltern Rat und Unterstützung. 1997 hat die amerikanische Wissenschaftlerin Elain Aron erstmals den Begriff der Hochsensibilität geprägt. Welch große Erleichterung eine Benennung ist, bestätigen auch die Eltern von Leo und Bastian, die nun endlich einen Namen für die „Andersartigkeit“ ihrer Kinder haben.
Woran erkennt man hochsensible Kinder? Clemens ist sieben Jahre alt und liebt Fußball. Seine Kindermannschaft trainiert heute in der Halle. Kaum wird angepfiffen, rennt er, kickt und hat den Ball immer im Auge. Eine Viertelstunde später steht er reglos am Rand des Feldes. Die Augen weit aufgerissen starrt er auf die anderen Kinder, die sich lautstark um den Ball balgen. Als der Trainer Leos Abwesenheit bemerkt, führt er ihn hinaus in die Umkleidekabine. Hier ist es still und Leo löst sich langsam wieder aus seiner Starre. „Fußballspielen ist echt cool!“, sagt der Siebenjährige und grinst. Leo ist kein Problemkind oder leidet gar unter einer Krankheit. Ganz im Gegenteil: er ist nur ein wenig anders. Genauer gesagt – hochsensibel.
Die Flut der Sinnesreize
Im Alltag werden wir von unzähligen Reizen überflutet. Geräusche, Gerüche, Bilder und Berührungen stürmen unaufhörlich auf uns ein. Um diese Fülle an Informationen verarbeiten zu können, ist das menschliche Gehirn mit einem Filtersystem ausgestattet, das einen großen Teil der Sinneswahrnehmungen gar nicht erst bis ins Bewusstsein vordringen lässt. Diese Filterfunktion unseres Gehirns, die das Nervensystem vor Überlastung schützt, ist bei Hochsensiblen durchlässiger. Bei ihnen können viel mehr Reize bis ins Bewusstsein vordringen ohne zuvor „aussortiert“ zu werden. Diese neuronale Besonderheit zeigt zwei Gesichter: einerseits erleben Hochsensible die Welt differenzierter und intensiver, weil ihnen mehr Informationen zur Verfügung stehen. Andererseits führt diese Überfülle an bewusst wahrgenommenen Sinnesreizen schnell zur Überlastung von Körper und Seele.
Das Fußballtraining überfordert Leos Reizkanäle: die vielen Kinder, die sich schnell bewegen, dazu der Lärmpegel, der in der Halle besonders hoch ist. Hochsensible Kinderfühlen sich schneller gestresst oder überfordert, selbst bei schönen Erlebnissen wie Geburtstagsfeiern oder Zoobesuchen. Hochsensible haben feine Antennen für die Schwingungen in ihrer Umgebung, weshalb schulischer Druck oder Erwartungen von Außen bei ihnen früher Überlastungserscheinungen auslösen als bei Normalsensiblen. Noch dazu sind sie kleine Perfektionisten. Um der Reizüberflutung ein Stück weit zu entkommen, suchen hochsensible Kinder häufig nach Rückzugsmöglichkeiten in der Sicherheit einer ruhigen Umgebung und in der Nähe von vertrauten Menschen.
So wie Bastian. Um sich an fremde Menschen, neue Situationen oder eine unbekannte Umgebung zu gewöhnen, benötigt der Dreieinhalbjährige viel Zeit. Es dauerte mehrere Monate bis Bastian so viel Vertrauen zu einer seinen Erzieherinnen schöpfte, dass er sich traute einen ganzen Tag lang im Kindergarten zu verbringen. Auch der Fußballer Leo kann sich nur schlecht konzentrieren, wenn im Klassenzimmer nicht genug Ruhe herrscht. Deshalb sitzt er inzwischen in der ersten Reihe, damit sich sein Sichtfeld auf die Lehrerin an der Tafel beschränkt und sich die Reize des vollen Klassenraumes nicht noch dazwischen schieben.
Eine unsensible Umgebung macht krank
Problematisch wird das Leben eines hochsensiblen Kindes, wenn die Familie keine Strategien findet, mit dieser Besonderheit umzugehen. Oder noch schlimmer, wenn das „Anderssein“ negativ bewertet wird und Anpassungsdruck folgt. Elisa Mutmann, die Mutter von Leo, aus dem niedersächsischen Winsen an der Luhe, ist selbst hochsensibel und hat einen Leidensweg hinter sich, den sie ihrem Sohn ersparen möchte. Wenn sie als Kind empfindlich oder emotional reagierte, erntete sie oft vorwurfsvolle Kommentare: „Sei nicht so theatralisch! Stell dich um Himmelswillen nicht so an!“ Elisa Mutmanns familiäre und schulische Umgebung hat ihr von Klein auf vermittelt, dass sie „falsch tickte“.
Hochsensibilität ist aber keine psychische Fehlfunktion und muss deshalb nicht therapiert werden im Sinne einer Krankheit. Die Betroffenen können ihr Empfinden auch nicht ausblenden, wie Kinderarzt Dr. Bernd Seitz weiß, der sich seit längerem mit Hochsensibilität bei Kindern beschäftigt. Wenn dem Hochsensiblen Ausdrucksmöglichkeiten verweigert werden und er sich aufgrund seines „Andersseins“ an den Rande der Gesellschaft gedrängt fühlt, zieht dies gesundheitliche Folgen nach sich. Elisa Mutmann, heute trockene Alkoholikerin, floh damals in die Sucht, weil sie ihr Leben als gescheitert empfand. Bei Bastians hochsensibler Mutter Karin Sanden aus Schenefeld in Schleswig-Holstein führte die Missachtung der eigenen Bedürfnisse zum Burnout-Syndrom.
Die Dauerüberreizung kann sich nicht nur als Wurzel psychischer Folgeprobleme entpuppen, sondern sich auch in körperlichen Beschwerden niederschlagen. Typisch sind Verspannungen, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, Infektanfälligkeit, Allergien, Rheuma und Asthma. Der Körper reagiert ebenso sensibel wie der Geist. Dr. Bernd Seitz weist darauf hin, dass bei Hochsensiblen das körperliche Schmerzempfinden stärker ausgeprägt ist, Medikamente schon bei einer geringeren Dosis als üblich wirksam werden und leichter Nebenwirkungen auftreten.
Der dreieinhalbjährige Bastian reagierte schon als Baby körperlich auf Reize in seiner Umgebung, mit denen er nicht umgehen konnte. Wenn die Eltern gestresst waren, übertrug sich die Stimmung direkt auf das Baby. In diesen Situationen hustete und spuckte Bastian bis sich seine Umgebung wieder beruhigt hatte. Auch der Grundschüler Leo merkt seine Grenzen schnell. Wenn der Schultag stressig ist und zu viel Unruhe ihn überfordert, leidet er unter Migräne.
Ernst nehmen statt therapieren zu wollen
Negative Folgen entstehen, wenn sich das hochsensible Kind im Konflikt mit einer verständnislosen Außenwelt sieht. Das kann leicht passieren, denn unser gesellschaftliches Wertesystem ist so angelegt, dass Leistungsorientierung, Konkurrenzdenken und Teamgeist schon früh als Norm vermittelt werden. Das widerspricht dem Empfinden Hochsensibler, denn ihre innere Richtschnur orientiert sich an Werten wie Innerlichkeit, Gerechtigkeit und Ausgleich. Außerdem ist unser Schulsystem auf die Vermittlung logischer und faktischer Inhalte ausgerichtet. Fantasie und Kreativität kommen dagegen zu kurz. Erhalten hochsensible Kinder nicht genug Freiräume ihre reiche Innenwelt auszudrücken und ihre Werte zu leben, empfinden sie sich zunehmend als „anders“, „unnormal“, „falsch“. Deshalb ist es wichtig, die Bedürfnisse hochsensibler Kindern ernst zu nehmen, selbst wenn diese gegen gängige Ratschläge für Eltern oder gegen gesellschaftliche Erwartungen verstoßen.
Karin Sanden hatte eine Weile lang versucht ihren Sohn vom elterlichen Bett zu entwöhnen, gemäß einer pädagogischen Empfehlung, die für normalsensible Kinder durchaus sinnvoll ist. Bastian weinte viel, schlief schlecht und war unausgeglichen. Bis seine Mutter einen Strategiewechsel vornahm. Nun haben sich die Sandens eine extragroße Matratze zugelegt, auf der Bastian seinen festen Schlafplatz bei den Eltern hat. Das Gefühl der Nähe, das der Dreieinhalbjährige sich nachts im elterlichen Bett holen kann, macht ihn tagsüber ausgeglichener und selbstständiger.
Als der Grundschüler Leo den Schwimmkurs besuchte, wie seine Lehrer empfahlen, schreckten ihn das Gewusel im Wasser, die vielen Kinder und der Lärmpegel im Hallenbad ab. In den Sommerferien im Pool einer befreundeten Familie dagegen hatte der Siebenjährige große Freude am Plantschen. Leos Eltern zogen daraus die Konsequenz, dass er das Schwimmen nun nicht im Schwimmkurs, sondern im Pool der Freunde lernen wird.
Die Gabe der Hochsensibilität
Wenn das Umfeld – die Familie, Kita oder Schule –die Bedürfnisse der hochsensiblen Kinder zulässt, anstatt ihr Anderssein zu kritisieren, ist der wichtigste Schritt erfolgt. Dann können die Kinder das Potenzial entfalten, das die Hochsensibilität mit sich bringt. Ihr Feingefühl für Zwischentöne und Befindlichkeiten anderer Menschen macht sie zu Vermittlern, denen Harmonie und das Wohlbefinden der Gemeinschaft wichtig sind. Sie besitzen ein inneres Wertesystem, das früher als bei Gleichaltrigen stark ausgeprägt ist. Hochsensible teilen beispielsweise gerne aufgrund ihres starken Gerechtigkeitsempfindens. Elisa Mutmann hat ihre Talente bei der Berufswahl genutzt: sie arbeitet als Gesprächstherapeutin, ein Beruf, bei dem es auf Einfühlung und Vermittlung ankommt.
Viele hochsensible Kinder sind sehr wissensdurstig und phantasievoll. Frühzeitig entwickeln sie ein differenziertes sprachliches Ausdrucksvermögen und die Fähigkeit zu komplexem Denken. Beim Fußballfan Leo koppelt sich Hochsensibilität an Hochbegabung – die Eltern suchen noch nach Möglichkeiten ihn gezielt zu fördern, ohne ihn mit einem Überangebot zu überfordern.
Aufgrund einer angeborenen Schwachstelle im Zwerchfell ist Bastians Entwicklung verzögert. Der Dreieinhalbjährige spricht bisher nur wenige Worte. Doch diesen Nachteil macht er auf kreative Weise wett: er komponiert kleine Geräuschsymphonien und untermalt sie mit ausdrucksstarken Bewegungen. Er reißt die Arme hoch, rollt die Augen, verzieht sein Gesicht und gluckst dann wieder aus voller Kehle. Musik ist für ihn frühe Begabung und Kommunikationsmittel zugleich
Begleitung statt Behandlung besonderer Kinder
Beide Familien hatten seit dem Babyalter den diffusen Verdacht, dass ihre Kinder sich von Gleichaltrigen unterscheiden. Bei Leo war es der starke Kontrast zwischen fordernder Wissbegier und rascher Überforderung, der die Eltern stutzig machte. Als er in die Schule kam und oft nur weinte, begannen Sie, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Karin Sanden empfand Bastian von Geburt an als dünnhäutig – er reagierte körperlich auf jede Stimmung in seiner Umgebung, was Mutter und Kind sehr belastete.
Beide Familien waren lange Zeit auf der Suche, ohne zu wissen, wonach sie eigentlich konkret suchen sollten, als sie durch Zufall mit Aurum Cordis in Kontakt kamen. Das Zentrum für hochsensible Menschen bietet Eltern Rat und Unterstützung. 1997 hat die amerikanische Wissenschaftlerin Elain Aron erstmals den Begriff der Hochsensibilität geprägt. Welch große Erleichterung eine Benennung ist, bestätigen auch die Eltern von Leo und Bastian, die nun endlich einen Namen für die „Andersartigkeit“ ihrer Kinder haben.
Der rechte TV-Propagandist Tucker Carlson, der selbst für Fox News zu extrem gewesen war, feierte Assange als „guten Mann“ und unkte: „Die Gezeiten wechseln!“ Von führenden Demokraten oder gar dem Weißen Haus gab es hingegen zunächst keine öffentlichen Reaktionen. Das eigenartige Stimmungsbild kommt nicht überraschend. Mehr noch als anderswo in der Welt polarisiert der schillernde Australier in den USA.

Bei einer Verurteilung ohne eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft hätte Assange wegen Spionage bis zu 175 Jahre Haft gedroht. Journalist sein? Trotz vielerlei und alledem! Immer noch. Und, ersst recht: Ja, gern doch …
Julian Assange bekennt sich „der unrechtmäßigen Beschaffung und Verbreitung von geheimen Unterlagen schuldig“. Nach 14 Jahren Unfreiheit ist das nachvollziehbar, der Deal legitimiert einmal mehr seine unrechtmäßige Verfolgung durch die USA.
Ja. Ein guter Tag für Julian Assange. Endlich, nach 14 (vierzehn!) quälenden Jahren der Unfreiheit wurde er aus britischer Haft entlassen und durfte in seine Heimat Australien ausreisen. Damit endet ein beispielloser juristischer Skandal, bei dem sich die britische und die schwedische Justiz zum Komplizen eines Rachefeldzugs gemacht haben, während die übrigen Regierungen der westlichen Welt schwiegen. Annalena Baerbock etwa, die sich noch im Wahlkampf für Assange eingesetzt hatte, aber – was Wunder – nicht mehr als deutsche Außenministerin …
 Mit der Pandemie erlebte das Arbeiten von zu Hause einen Boom, seitdem wächst das Angebot kontinuierlich. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Regionen und Branchen – mit einem Spitzenreiter Oben Hemd oder Bluse, unten Jogginghose: Vor der Pandemie war es die Ausnahme, so zur Arbeit erscheinen zu können, Corona machte die Ausnahme zur Regel.
Mit der Pandemie erlebte das Arbeiten von zu Hause einen Boom, seitdem wächst das Angebot kontinuierlich. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Regionen und Branchen – mit einem Spitzenreiter Oben Hemd oder Bluse, unten Jogginghose: Vor der Pandemie war es die Ausnahme, so zur Arbeit erscheinen zu können, Corona machte die Ausnahme zur Regel.
Wie wichtig den Beschäftigten die Möglichkeit zum Arbeiten aus dem Homeoffice nach wie vor ist, zeigen auch Zahlen: In den vergangenen Jahren hat der Anteil an Stellenanzeigen mit Homeoffice-Möglichkeit sogar deutlich zugenommen. Das zeigt eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, für die von Januar 2019 bis Mai 2024 rund 55 Millionen Onlinestellenanzeigen ausgewertet wurden.
