Die zur Europawahl antretenden Parteien beschäftigen sich in ihren Programmen sehr ausführlich mit der demokratischen Verfasstheit und politischen Ausgestaltung der Europäischen Union. Viele von ihnen fordern mehr Bürgerbeteiligung und mehr Rechte für das Europäische Parlament, etwa das Initiativrecht bei der Gesetzgebung.
Relativ häufig findet sich auch die Forderung, das Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen des Europäischen Rats abzuschaffen, um Handlungsblockaden zu vermeiden. Was die EU-Erweiterung angeht, so unterscheiden sich die Parteien deutlich in ihrer Haltung: Von der Ablehnung jeglicher Erweiterung bis hin zur Position, dass gerade die Erweiterung die EU stärken werde.
Europawahl Wahlprogramme im Vergleich
CDU/CSU
Die Unionsparteien wollen die Rechtsstaatlichkeit Europas „verteidigen“: Das bereits bestehende Verfahren zum Schutz der Grundwerte der EU im EU-Vertrag sowie der neue EU-Rechtsstaatsmechanismus böten die notwendigen Handlungsspielräume, um schwerwiegende Verletzungen der Grundwerte durch einzelne Mitgliedstaaten zu sanktionieren. Diese müssten genutzt werden, fordern die Schwesterparteien in ihrem Europawahl-Programm.
„Die EU muss handlungsfähiger werden – im Innern wie im Äußeren“, befinden die CDU/CSU. Hierfür brauche es Reformen der EU-Institutionen und ihrer Arbeitsweise. Nur so könne Europa Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft geben.
Dafür wollen CDU/CSU die EU-Kommission „umstrukturieren und verschlanken“ und gleichzeitig das Europäische Parlament stärken – durch das eigene Initiativrecht und das Diskontinuitätsprinzip, nach dem alle nicht beschlossenen Entwürfe in einer neuen Wahlperiode erneut eingebracht werden müssen.
Wenn bei Themen wie etwa der inneren und äußeren Sicherheit oder der Migration schnellere Entscheidungsgeschwindigkeit gefragt ist, solle das vorhandene Instrument der „Verstärkten Zusammenarbeit“ im Sinne eines „Europas der Pioniere“ häufiger genutzt werden, fordern CDU/CSU. Es ermöglicht EU-Staaten in bestimmten Bereichen eine engere Kooperation, wenn mindestens neun von ihnen kooperieren – auch wenn andere EU-Mitglieder dabei nicht mitgehen wollen oder können. Die EU solle in Zukunft auch schneller zu geeinten Positionen in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik kommen und deshalb hier künftig mit qualifizierter Mehrheit abstimmen, finden die Parteien.
Erweiterung und Reformen der EU müssten Hand in Hand gehen, fordern die Parteien. Das bedeutet aus Sicht von CDU/CSU auch Veränderungen bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Die angestrebte Erweiterung der EU müsse Anlass für eine andere Stimmverteilung im EZB-Rat sein: „Unser Ziel ist ein Stimmgewicht in Relation zur volkswirtschaftlichen Größe und zum Haftungsrisiko des einzelnen Landes.“
Bei der EU-Erweiterung geht es für CDU und CSU auch darum, dass Europa zusammenwächst. Die beiden Parteien halten dabei einen EU-Beitritt der sechs Westbalkan-Länder, der Ukraine und der Republik Moldau für richtig. Dies liege „im sicherheits- und geopolitischen Interesse Deutschlands und Europas“. Vor einem Beitritt müssten jedoch alle Beitrittskriterien vollständig erfüllt sein. Auf dem Weg dorthin solle es für Beitrittskandidaten Zwischenstufen geben, fordern die Parteien – etwa die Teilnahme an einzelnen EU-Programmen oder ein „gradueller Zugang zum EU-Binnenmarkt“.
Eine klar ablehnende Haltung haben CDU/CSU zum potenziellen Beitrittskandidaten Türkei: Sie sei zwar von strategischer Bedeutung für Europa, entferne sich derzeit aber von der Werteordnung der EU und könne damit der EU nicht beitreten. Trotzdem sei es im Interesse Europas, zumindest „gute politische und wirtschaftliche Beziehungen zur Türkei“ zu pflegen.
Europawahl 06.05.2024
Wahlprogramm von CDU und CSU „Mit Sicherheit Europa – Für ein Europa, das schützt und nützt“
Wahlprogramm von CDU und CSU zur Europawahl 2024 cdu
Bündnis 90/Die Grünen
Die Grünen wollen eine EU-Rechtsstaatlichkeit ausbauen, „die allen Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit und gleiche Rechte bietet“. Rechtsstaatlichkeit sei eines der Fundamente der Europäischen Union. Verstoße ein EU-Mitglied dagegen, etwa bei Eingriffen in eine unabhängige Justiz, Medienfreiheit oder Minderheitenrechte, schwäche es die Union. Deswegen wollen die Grünen die bestehenden Rechtsstaatsinstrumente konsequenter und schneller nutzen und weiterentwickeln. Aber auch die Auszahlung von EU-Mitteln soll „an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit, demokratischer Prinzipien und der Grundrechte“ geknüpft werden.
Die Grünen sprechen sich für eine EU-Reform bei der Abstimmungsmethodik aus – weg vom Einstimmigkeitsprinzip hin zum Mehrheitsprinzip: Mit der Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen will die Partei auf EU-Ebene Entscheidungen schneller ermöglichen. Dafür sei etwa die seit 2009 existierende „Passerelle-Klausel“ im Vertrag von Lissabon nutzbar: Wo bisher noch Einstimmigkeit im Europäischen Rat erforderlich war „und Entscheidungen deshalb leicht blockiert werden konnten, soll in Zukunft mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt werden“.
Zum anderen will die Partei die in den EU-Verträgen vorgesehene Klausel der „Verstärkten Zusammenarbeit“ besser nutzen. Sie erlaubt es einer Gruppe von mindestens neun EU-Mitgliedstaaten, in ausgewählten Politikfeldern enger zu kooperieren und gemeinsam Projekte anzustoßen.
Eine Reihe der grünen EU-Reformvorschläge würde einer Vertragsänderung bedürfen. Dafür will die Partei einen Konvent unter der Einbeziehung von EU-Bürgerinnen und -Bürgern einberufen.
Die Erweiterung der EU ist für die Grünen eine „Erfolgsgeschichte“. Sie stärke „unsere Sicherheit, unsere Stabilität und unseren Wohlstand“. Deswegen sei es „unsere Verantwortung, die Länder mit europäischer Perspektive aktiv zu unterstützen“, heißt es im Europawahl-Programm. Damit eine erweiterte EU handlungsfähig bleibt, müsse sie ihre Strukturen reformieren. Die Grünen wollen den Beitrittsprozess etappenweise gestalten – und das Erreichen von Zwischenzielen mit positiven Anreizen anerkennen, etwa dem Zugang zu Roaming, zu EU-Programmen oder zu Teilen des Binnenmarkts.
Skeptisch zeigt sich die Partei bei einer Beitrittsperspektive der Türkei aufgrund ihrer aktuellen politischen Ausrichtung, die sich in den vergangenen Jahren immer weiter von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten entfernt habe: „Für uns kann es eine Wiederaufnahme der Gespräche über einen EU-Beitritt erst dann wieder geben, wenn die Türkei glaubhaft den Weg zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einschlägt.“
Europawahlprogramm der Grünen „Was uns schützt.“
SPD
Für die SPD ist klar: „Europa muss gegen Einschränkungen von Rechtsstaat und Gewaltenteilung wirksam vorgehen“ – denn das Programm der Populisten und Europafeinde sei am Ende „ein soziales und kulturelles Verarmungsprogramm für die Bürgerinnen und Bürger“.
Die Partei setze sich „nachdrücklich für den Schutz von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in der EU ein“. Hierzu sollten bestehende Schutzinstrumente mit größerer Härte eingesetzt und neue Instrumente zum Schutz gemeinsamer Werte entwickelt werden. Bei Rechtsstaatsverstößen müssten Vertragsverletzungsverfahren deutlich konsequenter greifen als bisher.
Zudem müsse der Europäische Rat dringend das Grundwerte-Verfahren von Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) anwenden: EU-Mitgliedstaaten, die systematisch gegen Grundwerte verstoßen, sollte das Stimmrecht entzogen werden, fordert die SPD.
Dafür sei es auch notwendig, das Grundwerte-Verfahren selbst anzupassen. Das Europäische Parlament brauche mehr Mitspracherechte – und im Rat „darf es nicht länger möglich sein, dass einzelne Mitgliedstaaten Sanktionen blockieren können“. Solche Verstöße will die SPD auch finanziell sanktionieren: Es brauche verschärfte finanzielle Sanktionsmöglichkeiten für Verstöße gegen die gemeinsamen Werte der EU.
Die Partei gibt sich grundsätzlich offen gegenüber neuen möglichen EU-Mitgliedern: „Die Erweiterungspolitik der EU war und ist ein Motor für Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand in Europa – wir wollen diese Erfolgsgeschichte fortschreiben.“ Die Erweiterungspolitik der EU sei eines der wichtigsten Instrumente der EU-Außenpolitik.
So liefe auch der Prozess zum Beitritt der westlichen Balkanstaaten zu langsam: Vor mehr als 20 Jahren habe die EU diesen Staaten eine Beitrittsperspektive gegeben. „Nach jahrelanger Verzögerung ist es nun allerhöchste Zeit, die Staaten des westlichen Balkans zügig in die Mitte unserer Gemeinschaft aufzunehmen, wenn die Beitrittskriterien erfüllt sind.“ Die Partei will sich dafür einsetzen, dass „erkennbare Zwischenschritte im Erweiterungsprozess etabliert werden“ und will prüfen, „inwiefern zum Beispiel der Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt schon vor der vollständigen EU-Mitgliedschaft gewährt werden kann“.
SPD-Wahlprogramm zu Europawahl „Gemeinsam für ein starkes Europa.“
Das Wahlprogramm der SPD für die Europawahl 2024 spd
AfD
Die Alternative für Deutschland (AfD) bezeichnet die EU als „Fehlkonstruktion“. Solange diese fortbestehe, will sich die AfD dafür einsetzen, „weitere Einschränkungen der nationalen Souveränität und weitere Umverteilungen von Wohlstand und Vermögen unserer Bürger durch EU-Regelungen zu verhindern“. Verträge bezüglich einer EU-Erweiterung dürfe es nur mit begleitender Volksabstimmung geben.
Die Partei will das „undemokratisch gewählte EU-Parlament“ abschaffen. Die Rechtsetzungskompetenz solle „bis zur Neuordnung der Verhältnisse“ allein dem Europäischen Rat übertragen werden. Dessen Mitglieder, also die Staats- und Regierungschefs der EU, müssten in ihrem Stimmverhalten jedoch an Entscheidungen der nationalen Parlamente gebunden werden, fordert die AfD.
Als ihr vorrangiges Ziel im derzeitigen EU-Parlament definiert die Partei, „in der bevorstehenden Wahlperiode Parteien aus allen Ländern für das Zukunftsprojekt einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft zu gewinnen“.
Bis zu deren Gründung wolle die AfD jede Verkleinerung des administrativen Apparats unterstützen, heißt es in ihrem Europawahl-Programm. Die Förderung von Europaparteien und deren Stiftungen aus Steuermitteln müsse zudem beendet werden.
Einer EU-Erweiterung steht die AfD grundsätzlich abweisend gegenüber: So lehnt sie eine Aufnahme der Westbalkanstaaten in die EU explizit ab. Um den Westbalkan zu einem wichtigen Teil Europas zu machen, trete die AfD „für eine privilegierte Partnerschaft mit den Ländern dieser Region ein“. Die Migration über diese Staaten sei durch eine enge sicherheitspolitische Zusammenarbeit einzudämmen.
Die Türkei benennt die AfD zwar als einen wichtigen strategischen und wirtschaftlichen Partner. Sie gehört nach Ansicht der AfD jedoch kulturell nicht zu Europa. Die AfD fordert deswegen „den sofortigen Abbruch der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei und die Einstellung der finanziellen Heranführungshilfen“.
AfD-Europawahlprogramm „Europa neu denken!“
Europawahlprogramm 2024 der AfD afd
Die Linke
Die Linkspartei fordert, dass der Zustand von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten in der EU regelmäßig länderspezifisch evaluiert wird und Verstöße durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) sanktioniert werden.
Darüber hinaus will die Linkspartei „die Demokratieblockade der Europäischen Union lösen“: Die Verträge von Maastricht und Lissabon hätten „den Neoliberalismus in die Grundlagen der EU eingeschrieben“. Die Partei fordert deswegen eine neue Verfassung für die Europäische Union – und zwar mittels eines Verfassungskonvents.
Es brauche „eine friedliche, soziale und demokratische EU mit veränderten vertraglichen Grundlagen, neuen Strukturen, neuen Hoffnungen“. Sie wolle dafür „einen öffentlichen und demokratischen Raum für die Debatte über die Verfassung und die Demokratisierung der Institutionen schaffen – und die Dominanz des Europäischen Rates zurückdrängen“. Vertreterinnen und Vertreter aus den EU-Staaten sollen dort gemeinsam mit Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbänden und weiteren Nichtregierungsorganisationen einen Entwurf für die Verfassung diskutieren.
Die Linkspartei will EU-Bürgerinnen und -Bürgern insgesamt mehr Mitsprache- und Teilhaberechte einräumen: Sie sollten das Recht erhalten, über Volksentscheide und Volksbegehren EU-Politik mitzugestalten und Gesetze zu initiieren. Europaweit sollten zusätzlich „Bürgerräte – vergleichbar den Transformationsräten – eingerichtet werden“, heißt es im Europawahlprogramm der Partei.
Die aktuelle EU-Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik werde von der EU-Kommission „oft auf kurzfristige und bornierte energie- und migrationspolitische ‚Lösungen‘ verkürzt“. Dabei sei eine friedliche, kooperative und umfassende Nachbarschaftspolitik, die eine wachsende wirtschaftliche Zusammenarbeit, Rechtsstaatsdiskurse und Kulturaustausch einschließt, Teil des erklärten Selbstverständnisses der EU, kritisiert die Linkspartei.
Der EU-Erweiterung steht die Partei offen und zugleich kritisch gegenüber: Die EU habe in der Erweiterungspolitik „ihren Kompass verloren“ – bei der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, insbesondere der Förderung rechtsstaatlicher Prozesse in den Kandidatenländern, dem Kampf gegen den Klimawandel und für soziale Teilhabe. Stattdessen werde ein „politisch instrumentelles, rein ökonomisches Interesse an der Zusammenarbeit mit diesen Nachbarstaaten der EU verfolgt“.
Die Linkspartei will Erweiterungsgesuche an soziale und demokratische Standards knüpfen. Eine EU-Mitgliedschaft dürfe „weder politische Verhandlungsmasse für die geostrategischen Interessen von NATO und USA sein, noch an Kürzungs- und Privatisierungsauflagen gekoppelt werden“.
Europawahlprogramm Die Linke „Zeit für Gerechtigkeit. Zeit für Haltung. Zeit für Frieden.“
Programm zur Europawahl 2024 die-linke
FDP
Die Werte der Europäischen Union – nämlich Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – sind für die FDP das Fundament, auf dem die EU aufgebaut sei. Wer den Rechtsstaat mit Füßen trete, dem müssten rasch und konsequent EU-Fördermittel entzogen werden, fordert die Partei.
Künftig solle zudem der Europäische Gerichtshof (EuGH) auf Antrag eines EU-Mitgliedstaats, der EU-Kommission oder des Parlaments EU-Gelder einfrieren können. Die FDP will den Rechtsstaatsmechanismus auf die Verletzung aller Werte der Union ausweiten – unabhängig davon, ob EU-Gelder betroffen sind.
Die Partei regt weitere Reformen an: So fordert sie eine „Europäische Grundrechtsbeschwerde“ – Bürgerinnen und Bürgern sowie juristischen Personen sollten verbesserte Klagemöglichkeiten vor dem EuGH eingeräumt werden. Nach Ausschöpfen des nationalen Rechtswegs müssten diese auch gegen nationale Rechtsakte wegen einer Verletzung ihrer europäischen Grundrechte klagen können. Dazu will die FDP „die erfolgreiche Arbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) stärker fördern und weiter ausbauen.“
Die Erweiterungspolitik der EU brauche mehr Realismus, befindet die FDP in ihrem Europa-Wahlprogramm. Diese müsse mit institutionellen Reformen einhergehen, „damit die EU aufnahmefähig wird“. Die EU-Beitrittsperspektive sei ein zentrales Instrument, „um auf unserem Kontinent Demokratie, innere und äußere Sicherheit, politische Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand langfristig zu sichern“. Dabei müsse bei Beitrittskandidaten ein besonderer Fokus auf dem Thema Rechtsstaatlichkeit liegen.
Deswegen kommt die Partei zu dem Schluss, dass „eine von Präsident Erdogan autoritär regierte Türkei kein Kandidat für eine EU-Mitgliedschaft sein kann“. Die FDP will die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei in der bisherigen Form beenden und die Beziehungen auf eine neue Grundlage enger sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Zusammenarbeit stellen.
FDP-Wahlprogramm zur Europawahl „Europa. Einfach. Machen.“
„Entfesseln wir Europas Energie für mehr Freiheit und mehr Wohlstand.“ Das Programm der FDP zur Europawahl 2024 fdp
Freie Wähler
Die Freien Wähler fordern ein Europa, das pragmatisch und ideologiefrei agiert. Dabei seien Grundwerte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Pressefreiheit oder das Recht auf freie Meinungsäußerung „nicht verhandelbar“.
Die Partei will das Europaparlament mit einer Erweiterung der Kompetenzen und Zuständigkeiten stärken und fordert „ein echtes Initiativrecht“. Die Europäische Bürgerinitiative solle zudem weiter gestärkt werden. Sie ermögliche engagierten Bürgern, ihre politischen Vorstellungen in Europa einzubringen. Des Weiteren soll die Möglichkeit verbindlicher europaweiter Bürgerentscheide geschaffen werden.
Außerdem sollten Verstöße gegen Stabilitäts- und Wachstumspakt künftig automatisch geahndet und sanktioniert werden: „Dadurch erreichen wir mehr Haushaltsdisziplin und verhindern, dass die Stabilität unserer Währungsunion von politischen Entscheidungen abhängt“, heißt es im Europawahl-Programm der Partei.
Zudem will die Partei die Europäische Zentralbank (EZB) neu ausrichten: Die Unabhängigkeit der EZB von politischen Einflüssen sei weiterhin sehr wichtig. „Wir wollen aber, dass intern die Stimmrechte der nationalen Notenbanken in der EZB nach den entsprechenden Haftungsanteilen gewährt werden“, so die Partei. Den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wollen die Freien Wähler als „überstürzt eingeführtes Kriseninstrument wieder auflösen“, indem die Ausleihkapazität des ESM schrittweise zurückgefahren werde.
Was die EU-Erweiterung angeht, so plädiert die Partei dafür, dass neue Beitrittskandidaten für den Schengen-Raum vor ihrer Aufnahme zweifelsfrei alle sicherheitsrelevanten Kriterien nachhaltig erfüllen müssen – „wie die Ausgestaltung der Rechtsstaatlichkeit sowie den entschlossenen Kampf gegen Korruption, organisierte Kriminalität und Terrorismus“. Dabei könne es keine Kompromisse geben. Für den Fall einer nachträglichen Nichterfüllung müssen umgehende Sanktionsmechanismen vorhanden sein.
Um „nachhaltig aufnahmefähig“ zu werden, müsse jedoch sichergestellt werden, dass einzelne Länder weniger Entscheidungen blockieren können. Deshalb müsse für „klar definierten Politikfelder“ die Mehrheitsentscheidung einführt werden. Zudem solle nicht jedes kleine Land immer einen EU-Kommissar stellen müssen.
Den EU-Erweiterungskandidaten des Westbalkans steht die Partei grundsätzlich offen gegenüber. Bei der Türkei nehmen die Freien Wähler eine ablehnende Haltung ein: Angesichts der Entwicklung hin zu einem autoritären Staat sollten diese dauerhaft beendet werden.
Europawahlprogramm der Freien Wähler „Starkes Deutschland in Europa“
Europawahlprogramm 2024 bis 2029 der Freien Wähler freiewaehler
Die PARTEI
Die Satirepartei Die PARTEI äußert sich nicht zu den Themen Rechtsstaatlichkeit in Europa, EU-Reform und -Erweiterung.
02.05.2024
Die PARTEI „Europawahlprogramm 2024″
„Auszug aus dem Wahlprogramm zur Europawahl 2024.“ die-partei
ÖDP
Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) benennt ihre Ausrichtung klar als pro-europäisch – sie stehe für eine demokratisch gestaltete und der kulturellen Vielfalt verpflichtete Europäische Union. Sie sehe gerade deshalb einen tiefgreifenden Reformbedarf bei den EU-Institutionen. Die ÖDP beklagt Bürgerferne und „mangelnde Mitbestimmungsmöglichkeiten“, was die Identifikation vieler Bürgerinnen und Bürger mit der EU erschwere und deren Grundlage gefährde.
Eine Ursache sieht die Partei in „erheblichen Mängeln in den aktuell gültigen EU-Verträgen“. Vor allem litten die EU-Institutionen „unter einem Mangel an demokratischer Legitimation“. Konkret fordert die ÖDP die Einführung von Mehrheitsentscheidungen in allen EU-Institutionen, insbesondere im Rat.
Zugleich sollen die Rechte des Europäischen Parlaments gestärkt und verbindliche europaweite Volksbegehren eingeführt werden. Das Parlament solle das Initiativrecht bekommen, Gesetze selbst zu formulieren, „statt nur über die Vorlagen der EU-Kommission abzustimmen“ sowie das Recht, EU-Kommissare vorzuschlagen und zu entlassen. Insgesamt solle es eine Kontrolle der Kommission durch das Parlament geben.
Zudem plädiert die Partei dafür, die Zuständigkeit der EU zu beschränken: Alle Themen, die kommunal, regional und national geregelt werden könnten, sollten dort gemäß dem Subsidiaritätsprinzip der EU auch verbleiben.
Für eine EU-Reform genauso wie für weitere EU-Beitritte müssten die entscheidenden Kriterien die Achtung der Menschenrechte, die Prinzipien eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats und einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft sein, fordert die ÖDP.
23.04.2024
ÖDP „Wahlprogramm zum Antritt zur Europawahl 2024“
Ökologisch-Demokratische Partei. oedp
Piraten
Die Piratenpartei sieht bei der EU bereits seit ihrer Gründung ein Demokratiedefizit, „das auch im Laufe des weiteren Integrationsprozesses nicht behoben wurde“. Die Partei fordert, dass die politischen Prozesse der Union viel bürgernäher gestalten werden müssten.
Zudem fordert sie die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips ein: „Entscheidungen sollen nicht auf EU-Ebene getroffen werden, wenn sie besser auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene gefällt werden können.“ Europäische Grundwerte wie Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit seien nicht verhandelbar.
Die Partei will die Zivilgesellschaft stärker beteiligen: Sie fordert einen „direkt gewählten Bürgerkonvent“, der mit der Ausarbeitung eines neuen EU-Vertrages beauftragt werden solle. Dieser wiederum solle dann durch ein EU-weites Referendum besiegelt werden. Zudem solle das Europäische Parlament ein „E-Partizipationsinstrument“ einrichten: Bürgerinnen und Bürger sollten die Möglichkeit haben, Gesetzesvorschläge öffentlich zu diskutieren und Änderungsanträge einzubringen.
Die Piratenpartei will zudem das Machtverhältnis innerhalb der europäischen Institutionen zugunsten des Europäischen Parlaments verschieben. Derzeit sieht die Partei den EU-Gesetzgebungsprozess zu stark von der Exekutive, der EU-Kommission dominiert.
Die Piraten unterstützen die Erweiterung der Europäischen Union um weitere Staaten, die die Bedingungen und Kriterien für einen Beitritt erfüllen. Die EU sollte die Beziehungen zu beitrittswilligen Ländern durch eine verstärkte wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit vertiefen.
Gemeinsames europäisches Wahlprogramm der europäischen Piratenpartei zur Europawahl 2024 piratenpartei
Volt
Die Partei Volt will die Europäische Union stärken. Von zentraler Bedeutung sei dabei wiederum die Stärkung der demokratischen Legitimität der EU. Die aktuelle Ausgestaltung der EU-Politik sieht die Partei kritisch: „Der derzeitige institutionelle Rahmen stellt die Interessen der Mitgliedstaaten über jene der Bürgerinnen und Bürger“ – und führe zu Entscheidungsprozessen, die ineffizient und stark von nationalen Interessen beeinflusst seien.
Deshalb solle der Europäische Rat abgeschafft werden und durch einen Europäischen Senat ersetzt werden. Dieser solle als zweite Kammer der EU dienen. In der Zwischenzeit sei sicherzustellen, dass Entscheidungen im Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit anstelle von Einstimmigkeit getroffen werden.
Volt fordert auch, die EU-Kommission zu reformieren: Anstelle der Präsidentin oder des Präsidenten der Europäischen Kommission solle eine EU-Premierministerin oder ein EU-Premierminister aus den Mitgliedern des Europäischen Parlaments gewählt werden. Neben einer Europäische Armee soll es auch ein EU-Außenministerium geben. Die Rolle des Europäischen Parlaments müsse sich zudem „von der bloßen Mitentscheidung über Gesetze hin zur Teilnahme bei der Initiierung neuer Gesetze ändern“.
Gerade angesichts der bevorstehenden EU-Erweiterung müssten bisherige Entscheidungsprozesse reformiert werden, befindet die Partei. Dazu solle ein „Europäischer Kongress“ zur Reform der Europäischen Verträge in der neuen Legislaturperiode initiiert werden, an dem auch die Bürgerinnen und Bürger im Dialog beteiligt sein sollten.
Bei der EU-Erweiterung fordert Volt eine neue Methodik, „die auf einer schritt- und stufenweisen Integration in die EU basiert“. Diese solle den derzeitigen Ansatz „Alles oder nichts“ durch einen „effizienten, transparenten und fairen Prozess“ ersetzen. Wenn Beitrittskandidaten Fortschritte bei der Umsetzung von Reformen zur Angleichung an das EU-Recht machten, würden sie dann schrittweise mehr Zugang zu EU-Ressourcen wie dem EU-Haushalt und der Beteiligung an EU-Institutionen erhalten. Diese Stufen könnten bei Rückschritten in den Reformen rückgängig gemacht werden.
Volt-Europawahlprogramm „Trau Dich Europa“
Europäisches Wahlprogramm 2024-2029 voltdeutschland.org
Familienpartei
Die Familienpartei fordert eine neue Schwerpunktsetzung und eine Neuausrichtung der Europäischen Union: Sie müsse familienfreundlicher ausgestaltet werden – sozialpolitische Akzente seien hierzu der Schlüssel.
Die Rechte des Europäischen Parlaments müssten eine erhebliche Stärkung erfahren: „Es ist unzumutbar, dass sich ein Parlament ‚Parlament‘ nennen darf, obwohl die wichtigsten Entscheidungen von der EU-Kommission getroffen würden.“
Ein Modell wie es in Deutschland zwischen Bundestag und Bundesrat praktiziert werde, sei mindestens wünschenswert.
Wahlprogramm der Familien-Partei „Ich wähle Familie“
Wahlprogramm der Familien-Partei zur Europawahl 2024 xn--whlefamilie-l8a
Partei Mensch Umwelt Tierschutz
Die Tierschutzpartei fordert einen föderalen europäischen Bundesstaat, in dem das Subsidiaritätsprinzip gilt. Dafür brauche die EU eine neue Verfassung und „eine eigenständige europäische Regierung, die direkt von den EU-Institutionen vorgeschlagen, gewählt und ernannt wird, und nicht wie bisher als Europäische Kommission von den Regierungen der Mitgliedstaaten abhängig ist“.
Das Europäische Parlament müsse echte legislative Macht erhalten, fordert die Partei: Es müsse berechtigt sein, Gesetzgebungsverfahren zu initiieren, „statt wie bisher lediglich die EU-Kommission dazu auffordern zu dürfen“. Als zweite Kammer müsse ein neuer „Rat der Regionen“ als Nachfolge des Rats der Europäischen Union geschaffen werden. Mit dem „Rat der Regionen“ sollen „die regionalen und lokalen Interessen vertreten und ein wichtiges Element der Machtverschränkung von unten etabliert“ werden.
Die Partei fordert zudem eine Reform der Beteiligung für EU-Bürgerinnen und -bürger: Es dürfe nicht sein, dass über eine Million Menschen grundlegende Veränderungen über europäische Bürgerinitiativen wollen, aber die Kommission daraufhin nicht tätig werde. „Es muss eine Form der Verbindlichkeit geschaffen werden, sodass der Wille der Menschen, der als Bürgerinneninitiative zum Ausdruck kommt, nicht länger ignoriert werden kann“, heißt es im Europawahlprogramm der Partei.
Die Zukunft der EU sei nur dann sicher, „wenn sie Akzeptanz findet und größtmögliches Vertrauen in ihre Institutionen besteht“. Das sei leider immer weniger der Fall, was auch an der Konstruktion der Europäischen Union liege. Die Partei will sich auch für die Erweiterung um neue Mitglieder und den Wiedereintritt von Großbritannien und Nordirland einsetzen.
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ „Europawahl 2024. Werde Teil der positiven Veränderung – wähle Mitgefühl“
Programmforderungen zur Europawahl 2024 tierschutzpartei
Bündnis Sahra Wagenknecht
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sieht die aktuelle politische Ausgestaltung der Europäischen Union äußerst kritisch: „Die heutige EU ist ein Europa der Banken und des Big Business, in dem die soziale Ungleichheit wächst.“ Viele der Probleme seien nicht auf einzelne Fehlentscheidungen zurückzuführen, „sondern liegen grundsätzlich in den EU-Verträgen begründet, die den Rahmen für die Politik der EU setzen“.
Das BSW will deswegen in den EU-Verträgen eine „soziale Fortschrittsklausel“ verankern, die den Vorrang der sozialen Grundrechte vor den Binnenmarktfreiheiten (Waren, Arbeitskräfte, Dienstleistungen und Kapital) festschreibe.
Zugleich setzt das Bündnis auf „Subsidiarität statt EU-Zentralismus“: Statt weiterer Machtverlagerung auf die EU-Ebene solle die Souveränität demokratisch gewählter nationaler Parlamente und Regierungen gestärkt werden.
Einer EU-Erweiterung steht das BSW ablehnend gegenüber und fordert deswegen ein Erweiterungsmoratorium. Die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, Republik Moldau und Georgien lehnt das BSW explizit ab. Grund seien vor allem die durch einen Beitritt der fünf Länder des Westbalkans, des Kosovo, der Ukraine, Georgiens und Moldau entstehenden Kostenbelastungen für den EU-Haushalt.
Bündnis Sahra Wagenknecht „Programm für die Europawahl 2024“
„Ein unabhängiges Europa souveräner Demokratien – friedlich und gerecht!“ bsw-vg.de
Anmerkung: Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist nicht im Europaparlament vertreten. Da das BSW in Umfragen stabil bei 4 bis 7,5 Prozent ausgewiesen wird und damit von einem Einzug in das Europäische Parlament auszugehen ist, stellen wir die Positionen der Partei jedoch in diesem Überblick vor.
Die Partei Bündnis Deutschland ist im Europaparlament vertreten. Jedoch wurde sie bei der vergangenen Wahl nicht ins Europäische Parlament gewählt, sondern ein gewählter Abgeordneter einer anderen Partei trat später Bündnis Deutschland bei. Daher stellen wir die Positionen der Partei nicht in diesem Überblick vor.
Damit folgen wir dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit.






























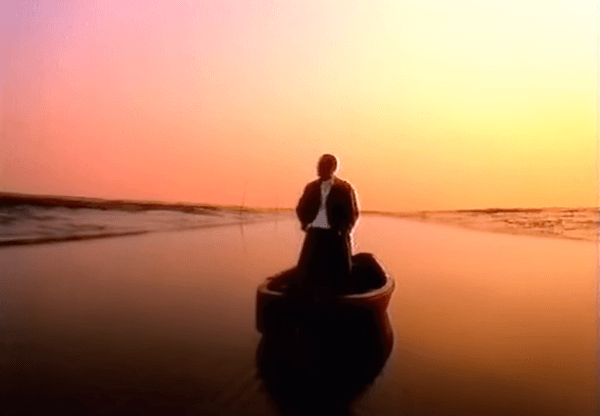










444 Kommentare