James serviert und leert stellvertretend für das Quartett die Gläser:

Und wie in den vergangenen Jahren wird er Mal für Mal über den ausgestopften Tigerkopf stolpern.
Wie im letzten Jahr wird James Miss Sophie immer wieder fragen, im Ganzen nicht weniger als fünfmal, ob «die Prozedur» die gleiche sein solle «wie im letzten Jahr» the same procedure as last year». – Wie im letzten Jahr wird Miss Sophie ihn korrigieren, dass «die Prozedur» die gleiche sein solle «wie jedes Jahr» («as every year») – einschliesslich ihres von James begleiteten Ganges zu Bett. Und wie jedes Jahr werden wir Fernsehzuschauer Miss Sophie alias May Warden und vor allem James alias Freddy Frinton dabei zusehen, wie es ist, wenn «die Prozedur» wie «jedes Jahr» ist.
Nonsens vom Feinsten in der Rundschau Kritik
Wie alle bedeutenden Stücke Drama, ist auch “Dinner For One” an Facetten ungemein reich. Allein die Vielzahl unterschiedlicher Interpretationen zeigt, wie in jedem Betrachter eine Saite zum Schwingen, eine andere zum Schweigen gebracht wird.
Auf diesem 90. Geburtstag der Miss Sophie gibt es nichts Letzthinniges und nichts Ein-für-Allemaliges, und wenn die überwiegende Mehrzahl der Kunstsachverständigen, Essayisten und Liebhaber, die Interesse an einer Kategorisierung des Gesamtstückes oder an einer Analyse einzelner Komponenten haben, für ihre Varianten jeweils Alleinvertretungsansprüche geltend machen, dann ist das erschütternd-bedauerlich.
„Well – I´ll do my very best!“

„Well – I´ll do my very best!“
Wiewohl wir nun im folgenden durchaus mit dem Butler (Freddie Frinton gibt ihn unnachahmlich) mitzuhalten versuchen und unsere Interpretationsansätze durchaus auch von gutem Wein begleiten lassen, wollen wir dem Betrachter weder dies mitzutun, noch ein bestimmtes Verständnis vorschreiben.
Wenn wir dabei auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat verzichten, tun wir das für diesmal der besseren Lesbarkeit wegen ebenso nicht, wie Verzicht zu üben auf die Darstellung einiger eher abseitiger Lesarten, die nur für Experten von Interesse wären. Lediglich sei hier die Polemik einiger selbsternannter Gourmets erwähnt, welche die Zusammenstellung des Menus kritisieren, vornehmlich die Kombination von Huhn und Champagner. Ein Stück, das solche gastrosophischen Verbrechen auf die Bühne bringe, könne nichts wert sein? Diese Kritiker haben offenbar ihre Identitätsbildung so entschieden hochgezüchtet, daß sie – pardon – offenbar schon wieder auf den guten, albernen Pawlowschen Hund gekommen zu sein scheinen.
Lehrstick oder Slapstück?
Weder noch, hier lassen sich zwei Richtungen fühlen: ein Lehrstück fast im Sinne Brechts, das, um die – oder irgendeine – Situation, Problematik oder Lösung herauszuarbeiten, die Mittel der Farce einsetzt: von Elementen des Slapstücks (Butler James trinkt Blumenwasser), bis hin zu jener Distanzierung des Schauspielers von der Rolle, die sich so fassen lässt, dass er im Verlauf deutlich sichtbar in die Rollen der vier abwesenden Personen schlüpft. Aus gestalttherapeutischer Sicht heraus betrachtet, bietet dieser 90. Geburtstag eine in sich geschlossene Realität.
Hier wird reine Form Inhalt, die Funktion der Darstellung ist hier einzig die Darstellung. Jede Frage nach einem überschreitenden Sinn würde in diesem Sinn selbst zu einer Farce.
Lachen an und für sich
Das zweifelsohne von allen Zuschauern ausgeübte Lachen mag als zeitgeistig coole Distanznahme im Sinne jener Studie über das Lachen verstanden werden, die zum Ergebnis kommt, das Lachen habe keinen größeren Feind als die Emotion. Hiernach wäre unser Lachen also nichts anderes als ein Aus-sich- und Aus-jenem-Herausgehen, das zu etwas sowohl führen will wie auch soll: zur Selbsterkenntnis oder zur Einsicht in die Dekadenz der alternden Oberschicht oder zu dem, was Eugène Ionesco dem Humor zumißt: “sich der Absurdität bewußt werden und doch in der Absurdität weiterleben”.
Auch, dass dies Stück nicht mehr mit einer Differenz zwischen Sein und Sollen arbeitet – wohingegen ein ungenannt bleiben wollender Heidelberger Philosoph offenbar japanischer Abstammung in seiner unter dem Pseudonym “Tenno” veröffentlichten Arbeit über diesen 90. Geburtstag die Frage nach “Sein oder Haben?” vermißt, mithin ein Ideal weder propagiere noch fordere, darf wohl so verstanden werden, dass hier Lachen nur als Parodie auf das eigene Selbst gemeint sein könne – als sozusagen erkanntermaßen ritualisierter Effekt.
Arrangement mit den Herrschenden
Wir haben hier ein zutiefst klassenkämpferisches Portrait einer untergehenden Welt, einer ländlich-städtischen Mittelschicht nebst militärischem und couponschneidendem Anhang, die sich in ihrer Zukunftslosigkeit allenfalls noch an sinnentleerten Festen, am Alkohol und am Traumgebilde einer längst vergangenen Vergangenheit festhalten kann. Dazu eine nicht minder dekadente Schicht dienender Berufe: der Butler James, entwürdigt von seiner Herrin bis hin zum “Letzten” – eine anglifizierte Variante des Woyzeck also -, der in all seiner Demütigung doch nur das Arrangement mit den Herrschenden sucht, ja nur noch suchen kann, und seinen Stolz unlöslich an die Rationalität des herrschaftlichen Wohlergehens in Börse, Tisch und Bett bindet.
Seele baumelt? Analyse?
Derweil bei etwa Goethe man sich über verschiedene analytische und psychiatrische Interpretationsweisen ja noch streiten könnte, ließe dies Dinner, solcherweise betrachtet, doch ausschließlich das klinische Lesen, Hören und Sehen insofern zu, als Madame vorgeführt werden in frei flottierender Angst mit hypochondrischen Neigungen. Es agieren hier Mischzustände von Wut, Ohnmacht und Hilflosigkeit, Angst vor Liebe ebenso, wie rasches Schwanken zwischen Idealisierung und Entwertung von Objekten. Und, wo die bedauernswerte Frau ihre Scheinwelt am Tisch nicht erkennt, verdrängt sie – was ja schlimmer ist als beinahe alles Andere.
Und Butler James, der Spiegeltrinker, der sein überhöhtes Alkoholquantum gleichsam gleichmäßig über den Abend verteilt und weitgehend ohne größere Kontrollverluste zu sich nimmt? Ein Deltatyp, der zwangweise wie zwanghaft zugleich in die Situation des Gammatyps versetzt wird, in den Alkoholexzeß. Hier erleben wir einen Menschen, der unmittelbar an der Flasche am Vollbringen eines Selbstopfers zur Befriedigung kommt: an der Überwindung nämlich des Bedürfnisses nach Versagen im oralen Bereich. Eine gefährliche Methode im Gegensatz zu der meist gelebten Form klassischen Asketentums, innerhalb welcher Lust nicht aus der Versagung körperlicher als vielmehr aus der Opferung geistig-seelischer Bedürfnisse gewonnen wird.
Auf also der Grenze zwischen Lehrstück und abgeschlossener Realität gelangen wir hier mit den Protagonisten in die Rolle von vier vermutlich gestorbenen Personen, die erfolgreich ausgefüllt werden, um deren Welt zur Unsterblichkeit zu versteinern. Schauriger kann die apriorische Trostlosigkeit menschlicher Grundbefindlichkeit kaum deutlich gemacht werden: Kein Weg führt zum Du, keiner zu Sinn und Eigentlichkeit, es bleibt die Einzementierung ständigen Zerfließens in ein dennoch abgeschlossenes Ich in einer isolierenden Vorstellung von Welt, ein sich Überliefern an eine geronnene Aufenthaltslosigkeit.
Des Essens philosophischer Aspekt
Betrachten wir den Text populärwissenschaftlich, so finden wir hier einen geprüften Willen zu gesellschaftlichem Sein des dem alles überhaupt keine Grenzen Setzenden. Und: Nehmen wir eine Bemerkung Ernst Blochs (Band 3, “Prinzip Hoffnung”) über die geglaubte Mechanik im Universum, die sich für ihn, gleichwohl ohne Spaß, wie auch ohne Pantheismus, aber dennoch befriedigend vollzieht, sind wir eher geneigt, in der “miss-sophischen Verstetigung“ ihrer Freunde einen so freilich nur in der Aristokratie, nicht aber dem bürgerlich geeinzelten Individuum möglichen objektiv-utopischen Vorgriff auf jene von Bloch bezeichnete So-Welt, als Verschwinden sozusagen des Nichts im sozialistischen Bewußtsein zu sehen.
Dem unüberschreitbaren Zwiespalt durch den selbstaktiven und eigenkontrollierten Schritt über den Tigerkopf in eine systematische Besessenheit werden wir eine künftige Arbeit widmen.
Emanzipatorische …
Das Verhalten Miss Sophies ist als selbstbewußt-folgerichtiger Schritt zu einer – zwar – in die Jahre gekommenen, zum Selbstbewußtsein erwachten Frau zu verstehen, die Stellung bezieht gegen die Verderbnis und das Reguläre, gegen das Leben sowohl wie auch gegen den Tod, gegen den zu-fälligen (oder haben wir den Butler je fallen gesehen?) Verlauf, all der Drohungen, die einsickernde Perfidie gegen den langsamen Fraß innen und gegen das Verschlungenwerden von draußen. Eine Frau, die alle Enttäuschungsmöglichkeiten hinter sich läßt und auf das klägliche Bild verzichtet, das jene Bindung der Seelenphantasie an die empirische Mannes- oder überhaupt Menschenform, wie sie ja in der sogenannten Wirklichkeit vorkommt, bietet. Nur mehr einer mageren Kulisse bedürftig, die ihr Butler James mit seinen vier Rollen baut, erweist Miss Sophie sich erfolgreich in dem Versuch, einen nichtreligiösen Weg der Liebe zu einem Objekt herzustellen, dem sie sich ohne Beschädigung ihres Ichs, ja gleichsam in Verwirklichung ihrer Autonomie, ganz hingeben kann und – selbst aus strengst feministischer Sicht, der wir uns ausdrücklich nicht anschließen – wohl auch möchte dürfen können!
… und komödiantische Aspekte

weg-da-du-da …
Gegebenen Anlasses wegen sei hier direkt im Anschluß die Verwandtschaft des “Dinner For One” mit der Commedia dell’arte behandelt. Wir sehen hier einen Entstehungszusammenhang, ja eine – allenfalls durch Konzessionen an britische Mentalität abgemilderte – große Übereinstimmung. Wenngleich das Spiel als Spiel nicht durch Masken kenntlich gemacht wird, liegt hier dennoch fast ein (hassenswert wie all solches) Plagiat vor, jedenfalls ist die Rollenverteilung eindeutig: Butler James sei Brighella, Sir Toby Pulcinella, Admiral von Schneider der Capitano, Mr. Pommeroy Tartaglia, Mr. Winterbottom der Dottore, Miss Sophie hingegen – Frau natürlich – hat einen superben Hauch von Originalität.
Das Dinner als Gesamtkunstwerk
Was nun aber das Gesamtkunstwerk angeht, meinen wir, dass – vom Autor zwar wahrscheinlich ungewollt, aber eben darum ganz besonders ernst zu nehmen – dieser Text in seiner zumal technischen Reproduzierbarkeit, vergleichbar mit Anton Bruckners Generalpause zu interpretieren sein dürfte.
Dies freilich erkennen zu können, setzt voraus jenes Stocken, das uns schwindelnd tragen soll über das Gewohnte hinweg; jener Rhythmus eines uns ureigenen Pulsierens, der nur in einer von allen Zufälligkeiten gereinigten Stille hörbar ist; der vordergründige Lärm, der hier – einem Saunagang vergleichbar – nichts anderes als sein Gegenteil herausarbeiten soll; die Bedingung der Möglichkeit zum In-Sich-Gehen also!
Dies alles dürfen wir Zusehenden am Silvesterabend nicht vernichten durch vulgäres Lachen, käme dies auch noch so sardonisch oder gar (in memoriam Hans-Georg Gadamer) hermeneutisch verkleidet einher. Tenno Gottsch-Ling
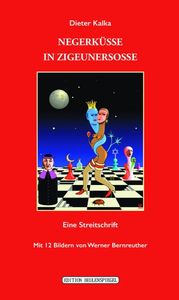





Lese hier immer seit Jahren, habe mich dennoch schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet, weil i c h nämlich in der Regel zu faul bin, das zu tun. Jetzt aber breche ich mein langes Schweigen und möchte zu obigem Beitrag sagen dürfen, dass ich noch selten eine so köstliche nicht nur, sondern auch aussagekräftige (und durchaus ernst zu nehmende Verhonepipelung) Version von Kritikerdeutsch gelesen habe. Darüber habe ich mindestens so fröhlich gelacht, wie alle Jahre wieder über dies „Dinner for one“. Danke dafür.
Mit allerbesten Grüßen und Wünschen für 2015
Mareike Kohler