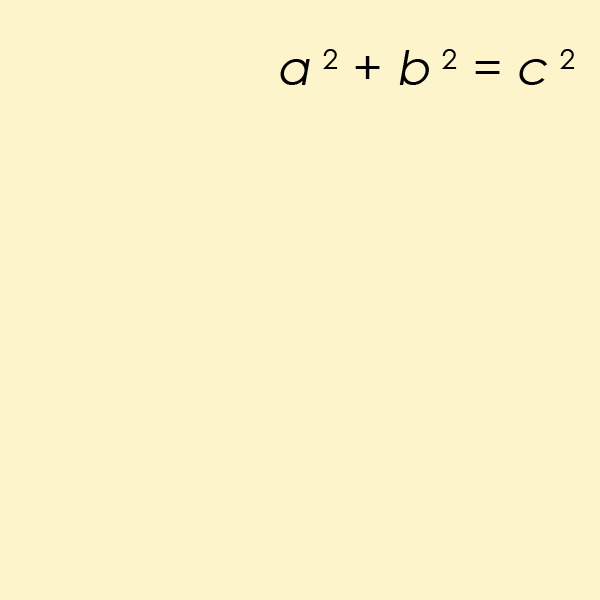|
|
|
|
|
Lieber Herr Gottschling
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Lieber Herr Gottschling
|
|
|
|
|
|
|
|
 Dazu werden Gipfel abgehalten, Bündnisse geschmiedet, und ehrgeizige Ziele verkündet. Wenn man sich nun aber den Wohnungsmarkt ansieht, hat sich die Lage eher stetig verschlechtert. Nun haben wir seit knapp einem halben Jahr wieder ein Bundesbauministerium und eine Ministerin, die jüngst das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ auf den Weg gebracht hat. Gibt es Hoffnung, dass sich – diesmal – tatsächlich etwas bewegt, schließlich hat sich ja durchaus in den vergangenen Jahren schon einiges getan: Neubauten haben erheblich – wenn auch nicht genug – zugenommen. Gleichzeitig nämlich ist der Bedarf vielerorts weiter gestiegen. Viele Hemmnisse, über die bereits seit vielen Jahren geredet wird, verhindern noch immer, dass ausreichend Wohnraum geschaffen wird. Es gibt da offensichtlich eine Diskrepanz zwischen politischenr Erkenntnis und praktischer Umsetzung. Der richtige Weg ist bekannt, von der Bauministerin Klara Geywitz und ihrem Bündnis muss jetzt der Ruck ausgehen, dass alle Beteiligten ihn auch einschlagen. Das ist schwer, aber: Bleiben wir optimistisch.
Dazu werden Gipfel abgehalten, Bündnisse geschmiedet, und ehrgeizige Ziele verkündet. Wenn man sich nun aber den Wohnungsmarkt ansieht, hat sich die Lage eher stetig verschlechtert. Nun haben wir seit knapp einem halben Jahr wieder ein Bundesbauministerium und eine Ministerin, die jüngst das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ auf den Weg gebracht hat. Gibt es Hoffnung, dass sich – diesmal – tatsächlich etwas bewegt, schließlich hat sich ja durchaus in den vergangenen Jahren schon einiges getan: Neubauten haben erheblich – wenn auch nicht genug – zugenommen. Gleichzeitig nämlich ist der Bedarf vielerorts weiter gestiegen. Viele Hemmnisse, über die bereits seit vielen Jahren geredet wird, verhindern noch immer, dass ausreichend Wohnraum geschaffen wird. Es gibt da offensichtlich eine Diskrepanz zwischen politischenr Erkenntnis und praktischer Umsetzung. Der richtige Weg ist bekannt, von der Bauministerin Klara Geywitz und ihrem Bündnis muss jetzt der Ruck ausgehen, dass alle Beteiligten ihn auch einschlagen. Das ist schwer, aber: Bleiben wir optimistisch.
Was sind die größten Hemmnisse für einen zügigen Wohnungsneubau?
Für all das ist nicht die Bundesregierung sondern sind Bundesländer und Kommunen zuständig und natürlich kann Frau Geywitz weder das Baurecht der Länder beeinflussen noch Bauflächen ausweisen oder die Ausstattung der Genehmigungsbehörden verbessern. Aber sie kann einen Anstoß geben und alle Akteure zusammenbringen, damit auf den entscheidenden Ebenen etwas passiert.
Ein weiteres Aufschieben können wir uns einfach nicht mehr leisten, die Lage auf dem Wohnungsmarkt droht eher noch schlimmer zu werden. Mithin ist zu befürchten, dass fast alles, was derzeit geplant, aber noch nicht in der Bauphase ist, überhaupt nicht mehr gebaut werden kann, mithin wird.
Die Kalkulationen gehen nämlich angesichts der explodierenden Preise für Baumaterial nicht mehr auf. Dazu kommen die bekannten Lieferkettenprobleme und der Fachkräftemangel. Gleichzeitig steigen die Zinsen und die Finanzierung wird schwieriger. Das bringt Bauunternehmen und Immobilienentwickler in Existenznot. Wir haben viel Zeit verstreichen lassen, als die Lage besser war, als die Wirtschaft lief und die Zinsen niedrig waren. Jetzt aber sind die Probleme signifikant, dass sich etwas verändern muss. Und das gilt im übrigen nicht nur für den Wohnungsbau, sondern auch für die Digitalisierung oder das Schulsystem. In vielen Bereichen konnte Deutschland es sich lange leisten, Reformen und Investitionen aufzuschieben. Spätestens seit Corona ist klar, dass diese Zeit vorbei ist.
Die politischen Stellschrauben beim Bau, wie das Ausweisen von Flächen und das Abbauen von Vorschriften, helfen bei diesen akuten Krisen-Symptomen hingegen nicht. Die Politik hat zu verssuchen, einen unmittelbar bevorstehenden Einbruch beim Wohnungsbau zu verhindern.
Die Regierung muss nun schnell für eine Entlastung sorgen, sie könnte zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Baumaterial zeitweise senken. Der Druck von Investorenseite auf den Markt lässt bereits etwas nach, weil Alternativen für sichere Anlagen wie zum Beispiel Staatsanleihen wieder Zinsen abwerfen und damit attraktiver werden. Hingegen ist aber keine Flucht aus dem Wohnungssegment zu sehen. Stattdessen sind Wohnimmobilien immer noch das bevorzugte Produkt institutioneller Investoren. Und, viele dieser Investoren finanzieren Immobilienprojekte vollständig mit Eigenkapital, für die sind steigende Zinsen kein Problem darstellen. Bei Investments, die Fremdfinanzierung wie Bankkredite enthalten, schrumpft die Rendite durch die höheren Zinsen dagegen empfindlich zusammen. Auch beim Wohneigentum wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern werden die Preise wahrscheinlich leicht zurückgehen. Zum einen – und zwar nicht nur – weil die Finanzierungskosten durch die höheren Zinsen steigen, sondern auch, weil in der Wirtschaftskrise das verfügbare Einkommen schrumpft.
Schon lange mit Problemen zu kämpfen hat der Markt für Einzelhandelsimmobilien. Mieten und Kaufpreise sind schon teils deutlich gesunken. In vielen Innenstädten stehen Geschäfte leer. Über das Thema „sterbende Innenstädte“ wird nun schon seit Jahren diskutiert, viele Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch, aber die Situation wird schlimmer statt besser. Werden wir uns damit abfinden müssen, dass die deutschen Innenstädte nicht mehr zu retten sind? Offenbar müssen wir uns von Innenstädten mit ihrer seit den 60er Jahren bestehenden Einzelhandels-Monokultur verabschieden und das ist auch gut so. Das heißt aber nicht, dass Stadtzentren sterben. In Zukunft werden die Innenstädte wahrscheinlich so aussehen, wie man sie vorzeiten noch gekannt haben: mit einer lebenswerten Mischung, unter anderem aus Einzelhandel, Büros, Kultur, Gastronomie, Bildungseinrichtungen und auch Wohnen.
Das ist auch keine neue Idee. Aber vielerorts prägt seit Jahren zunehmend trostloser Leerstand das Bild, statt einer solchen Vielfalt.
In den vergangenen Jahren bis zur Corona-Krise war die Lage in den meisten deutschen Städten gar nicht so schlecht. Wir als BMO sind in über 80 deutschen Städten in Einzelhandelsimmobilien investiert. Gerade in den mittelgroßen Städten war das zwar kein Selbstläufer, aber mit entsprechendem Arbeitsaufwand haben wir noch immer passende Nachmieter für alle unsere Einzelhandelsimmobilien gefunden. Das hat sich tatsächlich mit Corona und den Lockdowns dahingehend geändert, dass wir in manchen Lagen noch kreativer in der Nachvermietung sein müssen und auch nach anderen Nutzungsarten schauen. Aber ja, die Lage für viele Innenstädte ist jetzt so dramatisch, der Schmerz so groß, dass sich etwas ändern muss. Wir erleben auch, dass die Kommunalpolitik jetzt wirklich aktiv wird.
Das alles stand bisher nicht im Fokus der Kommunen
Die Entwicklung der Innenstädte ist längst ein Thema, allerdings stand das bisher nicht im Fokus der Kommunen. Bei der Wirtschaftsförderung wurde sich lange Zeit vor allem auf die Ausweisung von Gewerbegebieten im Außenbereich konzentriert. Bei vielen Einzelhandelsimmobilien wusste im Rathaus niemand, wem die eigentlich gehören.
Was können die Kommunen denn wirklich tun?
Das Wichtigste ist, ein schlüssiges Leitbild zu erarbeiten: Wo wollen wir überhaupt hin? Was sind unsere Voraussetzungen und Möglichkeiten vor Ort? Dann können die Kommunen zielgenau handeln. In vielen Fällen sind für eine Umnutzung, etwa von Einzelhandel zu Gastronomie, neue Genehmigungen notwendig. Da müssen die Ämter schnell und unbürokratisch handeln. Neue Nutzungsformen führen nicht nur zu einer Belebung der Innenstadt, sondern oft auch zu Konflikten beispielsweise durch Lärm von Gästen in Restaurants und Kneipen, die es vorher nicht gab. Das muss die Kommunalpolitik moderieren und die Interessen ausgleichen. Eine Stadt kann mal eben zum Beispiel auch direkt Ladenlokale anmieten, um Leerstand zu verhindern oder um statt eines weiteren Ein-Euro-Shops ein junges lokales Unternehmen in die Innenstadt zu bringen, das sich aber die Miete noch nicht leisten kann.
Mieten von mehreren Hundert Euro pro Quadratmeter leisten sich etwa Modeketten in Spitzenlagen, jedoch werden
solche Spitzenmieten auch bisher nur in der 1a-Lage erzielt. Die wird es auch weiterhin geben, denn gerade die Luxusbranche ist ein Teil des Einzelhandels, der gar keine Probleme hat. Allerdings werden diese Lagen kürzer und die Händler benötigen teils weniger Fläche. Statt mehrerer Stockwerke mietet ein Filialist dann oft nur noch das Erdgeschoss an. Darauf müssen wir uns mit neuen Nutzungskonzepten einstellen. Ein Obergeschoss, das bisher als Ladenfläche diente, kann beispielsweise in ein Büro oder eine Arztpraxis umgewandelt werden. Nur eines ist leider meist nicht praktikabel: die Umnutzung etwa von Kaufhäusern in Wohnraum. Die Vorgaben im Planungs- und Baurecht sind so unterschiedlich und ein entsprechender Umbau so aufwendig, dass sich fast niemand solche Wohnungen leisten könnte.
Die Extremwetter-Ereignisse nehmen zu: Hitzewellen, Starkregen. Auch Deutschland bleibt von Katastrophen nicht verschont, die Experten auf den Klimawandel zurückführen. Eine Klimakonferenz folgt auf die nächste, doch die Ergebnisse bleiben dürftig, kritisiert der Meteorologe Mojib Latif. Er spricht darüber, wie die Menschheit doch noch die Kurve kriegen könnte.
 Albert Einsteins Verhältnis zur Theorie der kleinsten Teilchen war stets ambivalent: Einerseits hat er die Quantentheorie maßgeblich mitentwickelt, andererseits wollte sich Einstein mit den Konsequenzen der Theorie nie so recht anfreunden.
Albert Einsteins Verhältnis zur Theorie der kleinsten Teilchen war stets ambivalent: Einerseits hat er die Quantentheorie maßgeblich mitentwickelt, andererseits wollte sich Einstein mit den Konsequenzen der Theorie nie so recht anfreunden.
Diese Skepsis mündete im Jahr 1935 in einen weltberühmten wissenschaftlichen Aufsatz : „Kann die quantenmechanische Beschreibung der physikalischen Welt vollständig sein?“, fragte Einstein dort mit seinen Kollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen.
Putlitz:
https://rundschau-hd.de/archiv-der-rundschau/2003-juni-seite-8.pdf
Das Interview fand in der Diskussion in Deutschland starken Widerhall, doch es änderte nichts. Neun Monate später sollen 20.315 Ortskräfte samt Angehörigen aus Afghanistan evakuiert worden sein. Knapp 11.000 warteten trotz konkreter Zusagen immer noch darauf, dass die Bundesrepublik sie aufnimmt. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linkenabgeordneten Clara Bünger vor.
Damit sollen 65 Prozent der zugesagten Rettungen mittlerweile erfolgt sein. Dass der Rest jedoch immer noch aussteht, zeigt, wie schwer es der Bundesregierung fällt, Versprechen der abgewählten Großen Koalition zu erfüllen. Und das, obwohl die Ampelkoalition in Aussicht gestellt hatte, noch mehr Menschen zu helfen als zunächst geplant. Dabei, so kritisieren Nichtregierungsorganisationen, wurden noch nicht einmal alle Schutzsuchenden erfasst.
Abzug aus Afghanistan: In diesem Flugzeug der US-Armee konnten noch Zivilisten das Land verlassen (Foto vom 24. August 2021) Foto: Master Sgt. Donald R. Allen / U.S. Air Forces
Tatsächlich fehlen auf den Evakuierungslisten beispielsweise bis heute die Namen von den Mitgliedern der Familie M. Diese ist weitverzweigt und gehört zur oberen afghanischen Mittelschicht. Womöglich würden sie auch heute weiter ein unbehelligtes Leben führen, hätte die Familie nicht Anfang August 2021 beschlossen, fünf Häuser in und um Kabul mehrere Wochen lang als sogenannte Safe Houses für bedrohte Ortskräfte zur Verfügung zu stellen.
Die Geschichte der Familie M. zeigt, wie Unterstützern der Deutschen immer noch Hilfe verwehrt wird – und wie sich auch die aktuelle Bundesregierung aus der Verantwortung windet, trotz anders klingender Versprechen.
In den Häusern der Familie M. hätten 400 bis 500 Afghaninnen und Afghanen Zuflucht gefunden, schätzt Sabur M., der die Hilfe für seine Verwandten koordinierte. Die meisten Schutzsuchenden hatten für die Deutschen gearbeitet, sie waren Köche, Übersetzer, langjährige Mitarbeiterinnen. Nachdem die Sicherheitslage über Monate immer gefährlicher geworden war, fürchteten viele spätestens im vergangenen Sommer um ihr Leben. Die Deutschen konnten wenig Schutz anbieten. Familie M. schon. Pro Haus nahmen sie bis zu hundert Menschen auf – geplant waren ursprünglich 30. Teilweise schickten die Deutschen ihre ehemaligen Mitarbeiter gleich selbst in die privaten Verstecke.
Zu den Aufgenommenen gehörte unter anderem auch ein KSK-Dolmetscher, über dessen Fall der SPIEGEL damals berichtete:
Safe Houses als Todesfalle
In die Safe Houses vermittelt wurden die ehemaligen Ortskräfte und ihre Familien über das von Marcus Grotian geleitete »Patenschaftsnetzwerk«. Ein Verein, der sich seit Jahren für Ortskräfte einsetzt. Wie wichtig die Afghanen jahrelang für die Deutschen waren, erlebte Grotian einst selbst als Soldat am Hindukusch.
Bis heute, sagt er, beschäme ihn der deutsche Umgang mit den Afghanen. Das Schicksal von Sabur M. und seiner Familie beschäftigt ihn besonders. Denn nachdem sie die Helfer der Deutschen unterstützt hatten, mussten viele Familienmitglieder von Sabur M. selbst untertauchen. Einen Tag bevor Kabul an die Taliban fiel, beschlossen die Gastgeber und Grotians Patenschaftsnetzwerk, die überfüllten Zufluchtsorte aufzulösen.
Inzwischen sind die Safe Houses womöglich erneut zu einer Todesfalle geworden – für ihre früheren Betreiber. Kurz nach dem Einmarsch der Taliban wurde der Cousin von Sabur M. zu einer Vernehmung einbestellt. Über Details will er bis heute nicht sprechen. Nur so viel: Er habe gestehen müssen, mindestens ein Safe House betrieben zu haben. Allein mit der Erklärung, nichts über die früheren Tätigkeiten seiner Gäste gewusst zu haben und der Bürgschaft eines einflussreichen Mannes sei er freigekommen. »Ich dachte damals, der überlebt das nicht«, sagt Sabur M. heute.
Kurz nach dem Verhör tauchte die Familie unter. Seitdem warten die Sabur M.s Angehörige auf Rettung. Er selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, doch nach der Machtübernahme der Taliban konnte auch er nur noch über Umwege zurückkehren. Sein Cousin in Kabul und die anderen hatten noch weniger Glück. Manche flohen nach Iran, bis das Geld ausging. Andere tauchten bei Verwandten unter.
»Dass ich meine Familie damals überredet habe, den Deutschen zu helfen, war der größte Fehler meines Lebens,« sagt Sabur M. heute. Wie viele Afghanen, die derzeit noch auf Ausreise warten, hatten die Angehörigen von Familie M. das Pech, auf keiner offiziellen Evakuierungsliste zu stehen.
Die Listen umfassten gefährdeter Ortskräfte samt Familienmitgliedern, Menschenrechtsaktivistinnen und NGO-Mitarbeiter. Wie und mit welcher Zuverlässigkeit diese Listen im Sommer 2021 erstellt wurden, ist bis heute politischer Streitpunkt. Klar ist vor allem, dass sie frühzeitig wieder geschlossen wurden – zum Leid vieler, die dadurch kaum noch Chance auf Rettung haben.
Wem geholfen wird, scheint nicht vollständig geklärt
Auch wem konkret wie geholfen wird, ist offenbar weiterhin nicht vollständig geklärt. Auf Nachfrage Büngers teilte das Innenministerium mit, die nach Paragraf 22 erteilten Visa würden bislang »nicht systematisch« erhoben, obwohl sie künftig eine wichtigere Rolle spielen sollen. Als besonders schutzbedürftige Gruppen wurden zuletzt Lehrerinnen und Journalisten genannt. In der Regierungsbefragung Ende April war jedoch auch von »Schutzbedürftigen« allgemein die Rede.
Für Familie M., die den Deutschen wochenlang die Ortskräfte versteckte, fühlt sich indes offensichtlich weiterhin keine Institution zuständig. Auf eine Anfrage Büngers antwortete zunächst das Bundesinnenministerium nüchtern, dass eine Aufnahme aus dringenden humanitären Gründen nicht vorgesehen sei. Dieselbe Argumentation verwendete kürzlich auch das von Baerbock geführte Außenministerium, als es am 10. Mai auf eine erneute »dringende Bitte« der Abgeordneten antwortete.
Ehemalige Ortskräfte demonstrieren vor einem Safe House der Familie M. für ihre Rettung
Ehemalige Ortskräfte demonstrieren vor einem Safe House der Familie M. für ihre Rettung Foto: privat / DER SPIEGEL
Die Aufnahme nach Paragraf 22 sei auch weiterhin nur in »ganz besonders herausgenommenen Einzelfällen« möglich. Die Aufnahme von mehreren Hundert bedrohten Helfern der Deutschen scheint dafür noch nicht auszureichen – so ist es dem Schreiben zu entnehmen.
Sabur M. hatte für die Evakuierung seiner Verwandten aus den Safe Houses bereits eine Liste mit gut 90 Namen erstellt und mehrfach nach Deutschland geschickt. Nach ausbleibender Hilfe kürzte er sie auf 71 Personen, um die Chancen auf Aufnahme zu verbessern. Das Dokument liegt dem SPIEGEL vor. Gestrichen wurden dabei alle jungen Frauen, die bereits verheiratet sind. Nach Taliban-Logik gehören sie anderen Familien an und sind so, mutmaßlich, zumindest besser geschützt. »Ich kann nicht beschreiben, wie schwer mir das fiel«, sagt Sabur M.
Für die Bundesregierung ist die Familie anscheinend jedoch in keiner Konstellation schützenswert. »Soweit aus den Informationen, die Sie uns übermittelt haben, ersichtlich«, heißt es in der Antwort von Baerbocks Ministerium, »betrifft Ihre Anfrage keinen Fall, der eine Aufnahme… ermöglicht«.
Soldaten der US-Armee während der Vorbereitung für einen Evakuierungsflug im August 2021
Soldaten der US-Armee während der Vorbereitung für einen Evakuierungsflug im August 2021 Foto: Taylor Crul / U.S. Air Force / Getty Images
Für Marcus Grotian vom Patenschaftsnetzwerk ist es ein Beweis, dass immer noch nicht genügend Bereitschaft besteht, bedrohten Afghanen zu helfen. »Das Schlimmste für mich ist, dass diese Menschen uns vertraut haben«, sagt er. »Hier haben Menschen aus humanitären Gründen sich selbst in Gefahr gebracht, um unseren Angestellten zu helfen. Sie mussten erst einspringen, weil die Bundesregierung viel zu spät oder gar nicht selbst reagierte.«
Die Linkenabgeordnete Bünger fordert, den Fall von Familie M. neu zu bewerten: »Wenn Annalena Baerbock sich ihre Glaubwürdigkeit bewahren will, muss sie dafür sorgen, dass diese Entscheidung revidiert wird und der Familie die Aufnahme in Deutschland ermöglicht wird.«
Für Sabur M. klingt die Frage nach fehlender Bedrohung seiner Angehörigen indes nur noch wie Hohn. Ihm sei unklar, was noch passieren müsse, um eine Gefährdung nachzuweisen. Rechtsstaatlichkeit, die Trennung von Exekutive und Judikative, seien in Afghanistan längst aufgehoben. Die Gefahr sei für seine untergetauchten Verwandten dadurch allgegenwärtig, sie lauere an jedem Checkpoint und bei jeder Razzia. Oder einfacher gesagt: »Die Taliban verschicken keine Mahnung, bevor sie dich abknallen.«
Unter dem Titel »Globale Gesellschaft« berichten Reporterinnen und Reporter aus Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa – über Ungerechtigkeiten in einer globalisierten Welt, gesellschaftspolitische Herausforderungen und nachhaltige Entwicklung. Die Reportagen, Analysen, Fotostrecken, Videos und Podcasts erscheinen in einer eigenen Sektion. Das Projekt ist langfristig angelegt und wird von der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) unterstützt.
Ein ausführliches FAQ mit Fragen und Antworten zum Projekt finden Sie hier.
Es gibt die tröstende Dimension der Religion. Der Glaube an eine Gottheit, die uns liebt, sich um uns kümmert und uns beschützt. Es gibt die verstörende Dimension der Religion: Die Furcht vor einer Gottheit, die uns bedroht und die nur mit Opfern freundlich gestimmt werden kann. In letzter Konsequenz werden der Gottheit Menschenopfer dargebracht. Wobei das eine euphemistische Formulierung ist, deren Zweck nur zu deutlich ist:
Denn bei genauerem Hinsehen sticht in einer Szene ein besonderes Detail heraus: Homer steht – ganz im Stil eines nerdigen Professors – nachdenklich mit Brille an einer vollgekritzelten Tafel. Neben den obligatorischen Donuts, die nicht nur Homers Leibspeise sind, sondern gerade im Bereich der Topologie eine große Rolle spielen, findet sich eine harmlos anmutende Gleichung: 398712 + 436512 = 447212. Tippt man sie in einen Taschenrechner ein, erweist sie sich offenbar als richtig. Das Erstaunliche: Sie widerspricht einem der etabliertesten Theoreme der Mathematik, dem großen Satz von Fermat.
Der große Satz von Fermat: Ein jahrhundertealtes mathematisches Rätsel
Dieser stammt aus dem 17. Jahrhundert und sieht auf den ersten Blick recht einfach aus: Er besagt, dass die Gleichung xn + yn = zn keine ganzzahligen, positiven Lösungen x, y und z hat, wenn n größer ist als zwei. Wählt man n = 1, dann ist die Gleichung immer erfüllt: Egal, wie man die Werte für x und y wählt, z wird stets ein positives, ganzzahliges Ergebnis sein, zum Beispiel: 3 + 6 = 9. Selbst Homer, der in der Serie häufig als dümmlich dargestellt wird, traut man diese Einsicht zu.
Für n = 2 wird es schon etwas kniffliger, denn die Gleichung wird quadratisch: x2 + y2 = z2. Wenn x und y ganzzahlige Werte haben, muss das nicht notwendigerweise für z gelten, etwa ergibt für x = 1 und y = 2 die Formel 12 + 22 = 5 – und 5 ist keine Quadratzahl. Das heißt, es gibt zwar eine Lösung für z (die Wurzel aus 5), die ist jedoch nicht ganzzahlig. Dennoch findet man Ausnahmen, für welche die quadratische Gleichung doch eine passende Lösung hat, zum Beispiel: 42 + 32 = 25 = 52.