Radikale Kräfte wollen an Universitäten eine neue Zensur durchsetzen. Solche Gesinnungspolizei steht gerade in Deutschland in einer Tradition des Ungeistes – dennoch wird sie noch immer verharmlost.
Wenn eine hasenfüssige Universitätsleitung, wie an der Humboldt-Universität in Berlin geschehen, vor einem studentischen Mob einknickt und einen Vortrag absagt, ertönt unfehlbar der beruhigende Hinweis: So schlimm wie in den USA oder allenfalls noch Grossbritannien ist es hierzulande mit der Cancel-Culture nicht.
Das stimmt. So schlimm wie in den USA, wo inzwischen viele Professoren aus Angst vor forschen Antirassisten und Gender-Polizisten schweigen, ist es in Deutschland nicht. Auch wurde noch keine Professorin aus der Universität gedrängt, weil sie auf zwei biologischen Geschlechtern beharrte, wie Kathleen Stock in England.
Dennoch gibt es Gründe, das vorübergehende Auftrittsverbot für Marie-Luise Vollbrecht an der Humboldt-Universität und andere ähnliche Vorkommnisse nicht als Einzelfälle zu behandeln. Das vielleicht beste Argument ist die deutsche Geschichte. In den dreissiger Jahren war Deutschland ein Vorreiter der Cancel-Culture – und zwar vor der Machtergreifung Hitlers.
Die jungen Wilden gewinnen gegen die alten Ängstlichen
Wie es damals an den Universitäten zuging, berichtet Golo Mann in seinen «Erinnerungen und Gedanken» aus Heidelberg, wo der Sohn Thomas Manns einige Semester verbrachte. Im Herbst 1930 erhielt dort der Mathematiker Emil Julius Gumbel eine Professur. Er war ein rotes Tuch für die Nazis, die im Studentenausschuss, dem Asta, die Mehrheit besassen. Gumbel war Jude, Pazifist und hatte sich einen Namen gemacht als Autor eines Buches über die auf dem rechten Auge blinde Justiz der Weimarer Republik.
Gegen die Ernennung brach ein Empörungssturm los, der bald den Namen «Gumbel-Krawalle» trug. Der Asta inszenierte einen Boykott, um die Entlassung zu erzwingen. Anfänglich stand die Professorenschaft noch zu ihrem Kollegen, nicht ohne den säuerlichen Hinweis auf dessen «unerfreuliche Persönlichkeit und Gesinnung».
Doch schon im Jahr darauf verlor Gumbel seine Lehrbefugnis. Er emigrierte nach Frankreich und später in die USA. Nach Kriegsende verweigerte man ihm in Heidelberg die erhoffte Wiederanstellung. Universitäten sind Bürokratien; diese pflegen träge und feige zu sein. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Gumbel war kein Einzelfall in Heidelberg. Ähnliches widerfuhr dem Theologen Günther Dehn, einem bekennenden Sozialisten und Pazifisten. Er konnte die ihm zugesagte Professorenstelle nicht antreten, da die Fakultät Proteste fürchtete. Golo Mann kommentierte die Affäre 1931 mit Worten, die wie eine gegenwärtige Abrechnung mit dem Verhalten der Humboldt-Universität klingen. Beschämend sei, «dass die Fakultät nicht einmal vor aktuellem Terror, sondern vor der Möglichkeit zukünftigen Terrors gekniffen hat».
In Berlin kapitulierte man jetzt wie ein Jahrhundert zuvor in Heidelberg vorauseilend vor potenzieller Randale. Es scheint jedes Mal dasselbe zu sein, wenn studentische Radikalität auf professorales Ruhebedürfnis trifft. Die jungen Wilden siegen über die alten Ängstlichen.
Die Cancel-Culture der Weimarer Republik endete am 30. Januar 1933. Aus dem Radau einer Minderheit wurde Staatsterrorismus. Nicht mehr Extremisten bekämpften die Verfassungsordnung, der Staat selbst war der erste und oberste Extremist.
Die Universitäten werden zu Orten der Zensur
Wiederholt sich die Geschichte? Deutschland ist eine junge, aber starke Demokratie, so wie die USA eine alte, aber noch immer vitale Demokratie sind. An der Cancel-Culture gehen diese Demokratien nicht zugrunde, so wenig wie an Massnahmenkritikern und Putin-Verstehern. Aber es lohnt sich, wachsam zu bleiben, was sich an Universitäten zusammenbraut, denn diese sind Frühwarnsysteme für gesellschaftliche Fehlentwicklungen.
Noch nie zweifelten so viele Deutsche an der Meinungsfreiheit
Antworten der Umfrage-Teilnehmer auf die Frage «Haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann?» (in Prozent)
Es ist besser, vorsichtig zu sein
Man kann seine Meinung frei sagen
1971 glaubten 83 Prozent der befragten Westdeutschen, ihre Meinung frei sagen zu können.
Das historische Beispiel zeigt, wohin das Kesseltreiben gegen Personen und Ideen führen kann. Auf dem Platz vor der Humboldt-Universität erinnert heute ein Kunstwerk an die Bücherverbrennungen der Nazis, denen auch Gumbels Buch zum Opfer fiel. Man hält sich in Deutschland also zugute, die Vergangenheit als Mahnung für die Gegenwart zu begreifen.
Der Respekt vor der Geschichte sollte dazu führen, dass man Cancel-Culture als das bezeichnet, was sie ist: eine neue Form von Extremismus. Der aus dem Englischen importierte Begriff ist ein Euphemismus, die absichtliche Beschönigung von akademischen Hexenjagden. In Deutschland sollte sich das verbieten.
«Wehret den Anfängen» ist kein schlechtes Motto. Es hat sich im Umgang mit Neonazis bewährt. Es ist auch der richtige Wahlspruch, wenn wieder Minderheiten deutsche Universitäten zu okkupieren versuchen, um missliebige Ansichten auszumerzen.
Wenn der entfesselte Zeitgeist zuschlägt wie in der Hetzkampagne gegen die britische Feministin Kathleen Stock, stehen Ruf und Existenz auf dem Spiel. Selbst in Deutschland, wo noch niemand seine Professur verlor, bleibt immer etwas hängen: mindestens das dümmste Adjektiv der deutschen Sprache. Die Davongekommenen gelten fortan als «umstritten» – die Berliner Professoren Herfried Münkler und Jörg Baberowski, beide völlig unumstrittene Koryphäen ihres Fachs, können ein Lied davon singen.
Nach jedem Vorfall wird die erstaunte Frage gestellt, warum sich das ausgerechnet an Universitäten ereigne, den Orten des freien Denkens. Die Gegenfrage müsste lauten: wo sonst, wenn nicht an Universitäten? Wo neue Ideen entstehen, wächst auch der Wille, die Zweifler und Opponenten der reinen Lehre mundtot zu machen.
Das freie Denken und sein Gegenteil, Zensur und Dogmatismus, treten oft zusammen auf. Das ist die negative Dialektik des akademischen Fortschritts. Nicht nur zu Golo Manns Zeiten war das so, sondern auch während der Studentenunruhen 1968.
Das Phänomen verläuft wellenförmig, nur die Inhalte wechseln. Heute sind es Identitätspolitik, militanter Antirassismus und eine Gender-Ideologie, die alles Geschlechtliche zu rein sozialen Konstrukten erklärt. In den sechziger Jahren war es ein doktrinärer Neomarxismus, der Vorlesungen störte und Institute besetzte. Mancher Asta, nun eben rot statt braun lackiert, organisierte wie drei Jahrzehnte zuvor Boykott-Aktionen.
Die Cancel-Culture wird noch immer beschönigt
Ins Fadenkreuz der Gender-Ideologen geraten heute besonders traditionell argumentierende Feministinnen und Lesben wie Kathleen Stock. In den sechziger Jahren richtete sich die Wut der Marxisten gegen andere Marxisten. Der Kommunistische Bund Westdeutschlands (KBW) war der ärgste Feind des Kommunistischen Bundes (KB). Extremismus funktioniert immer nach denselben Regeln.
Zugleich gedeiht Extremismus nur mithilfe von Beschwichtigern in Rektoraten und Redaktionen. Sie wiegeln ab, wo Nulltoleranz geboten wäre. Auch die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» scheint in dieses Lager übergelaufen zu sein. Sie spöttelt über «Kampagnenmedien der Anti-Cancel-Kultur», obwohl das Thema bürgerlich-akademische Kreise intensiv beschäftigt. Sonst hätten sich kaum Forscher und Forscherinnen im «Netzwerk Wissenschaftsfreiheit» zusammengefunden, um, wie sie selbst sagen, «die Prinzipien der Aufklärung zu verteidigen».
Wer sich gegen eine gesellschaftliche Fehlentwicklung stemmt, führt keine Kampagne. Eine Kampagne kann nur der erkennen, der die Fehlentwicklung nicht sieht oder sie bewusst kleinredet.
Das Argument der Euphemisten lautet stets, «Cancel-Culture» gebe es eigentlich nicht; es handle sich um aufgebauschte Einzelfälle. Mit derselben Logik liesse sich behaupten, es gebe keinen Rechtsextremismus, sondern eine Fülle von Einzelfällen.
Wer Extremismus zu einer Frage der Zahl erklärt, verkennt zudem den dahinterstehenden Ungeist, also das Wirkprinzip. Menschenrechte wie Rede- und Forschungsfreiheit sind unteilbar und nicht erst dann in Gefahr, wenn sie massenhaft verletzt werden. Dann ist es ohnehin meist zu spät zur Gegenwehr.
Zum Wesen von Extremismus gehört, dass er sich ausbreitet, wenn man ihm nicht entgegentritt – aber nicht «mit allen Mitteln» von Justiz und Verfassungsschutz, wie es angesichts der Proteste von Impfgegnern hiess, sondern mit Augenmass und Zivilcourage.
Masslosigkeit gehört zum Instrumentarium von Extremisten, deren Gegner sollten sich daran kein Vorbild nehmen. Gute Argumente sind im politischen Kampf nachhaltiger als die Androhung von Strafen und die Beobachtung durch den Geheimdienst. Die politische Auseinandersetzung mit Extremisten ist daher das Gegenteil einer Kampagne, sie ist leidenschaftliches Engagement für Freiheit und Demokratie.
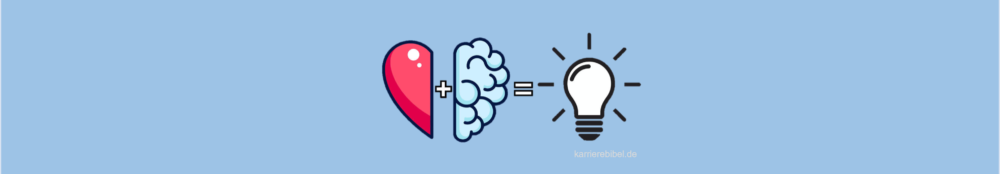
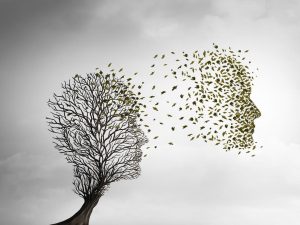 Wenn ein Mensch stirbt, stellt sein Gehirn nicht von einem Moment auf den anderen die Arbeit ein. Der Neurologe Jens Dreier hat untersucht, was in der Zwischenzeit passiert – und stieß auf verblüffende Parallelen zur Migräne.
Wenn ein Mensch stirbt, stellt sein Gehirn nicht von einem Moment auf den anderen die Arbeit ein. Der Neurologe Jens Dreier hat untersucht, was in der Zwischenzeit passiert – und stieß auf verblüffende Parallelen zur Migräne. Es gibt einige wiederkehrende Muster, etwa das Gefühl, sich gleichzeitig in verschiedenen Epochen und an verschiedenen Orten zu befinden. Häufig entstehen auch abstrakte Sinneseindrücke, zum Beispiel ein helles Licht oder eine Verengung des Sichtfelds – als würde man durch einen Tunnel laufen. Manche erzählen zudem von außerkörperlichen Erfahrungen.
Es gibt einige wiederkehrende Muster, etwa das Gefühl, sich gleichzeitig in verschiedenen Epochen und an verschiedenen Orten zu befinden. Häufig entstehen auch abstrakte Sinneseindrücke, zum Beispiel ein helles Licht oder eine Verengung des Sichtfelds – als würde man durch einen Tunnel laufen. Manche erzählen zudem von außerkörperlichen Erfahrungen.





