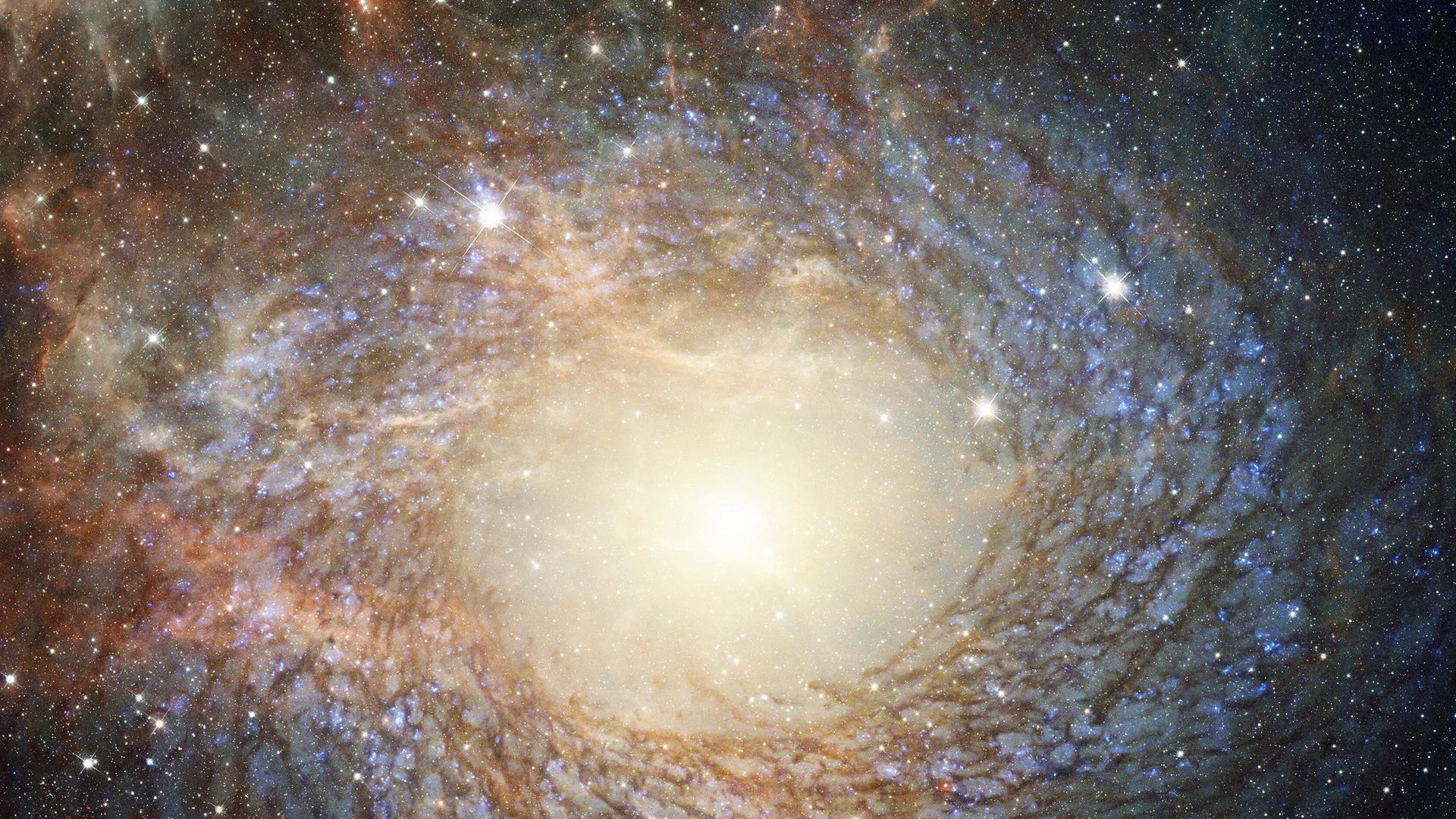Zunächst einmal und vorneweg: Im Grunde fragen Sie den Falschen. Denn nach Statistik habe ich als praktischer Arzt eine Lebenserwartung von 67 Jahren und liege damit um 10 Jahre unter dem bundesrepublikanischen Durchschnitt. Die Ärzte haben eine höhere Rate an Herzinfarkten, eine dreifach so hohe Wahrscheinlichkeit einer Suchtkrankheit zu erliegen und ein zehnfaches Suicidrisiko gegenüber anderen Berufsgruppen. Am besten liegt in der Statistik der verheiratete evangelische Theologe. Am beeindruckensten von den lebenden Alten ist für mich der Geiger und Dirigent Yehudi Menuhin, ich habe ihn am 6.Februar 1998 in einem dreistündigen Konzert in Mannheim gesehen, sowas von gerader Haltung, Spannkraft und Dynamik der Bewegung, Eleganz im Auftreten und Klarheit des Auges, dem sollte man die Fragen nach Gesundheit und Alter stellen.
Und es gibt ein gesundes Alter. Und auch das hat seine Zeichen, denken wir an eine alte Hose: die ist abgenutzt, hat ausgebeulte Knie und einen ausgedünnten Stoff. So auch manche Krankheiten die typisch sind für das Alter: Sie zeigen Abnutzung wie Arthrose, Sklerose (Gelenke, Gefäße und Gehirn verhärten und zerbröckeln) oder Abschlaffungen (Tränensäcke, Inkontinenz) oder Ausdünnungen (Osteoporose) andere kommen nur häufiger vor wie Krebs weil der Reparaturmechanismus langsamer wird.
Die Veränderungen sind kein Muß: Tizian malte im 90 Lebensjahr, Luis Trenker stieg uralt auf höchste Berggipfel., Goethe verliebte sich 80 jährig in immer jüngere Frauen.
Oder sind die Altersveränderungen doch ein Muß?: Jedes Alter ist an der Hauterschlaffung auf plus-minus fünf Jahre gut einschätzbar. Wer krank wird, ist immer schlecht dran. Wer aber gesund bleibt, erlebt auch Veränderungen. Deswegen einige Gedanken zum gesunden Altern. Und auch am Schluß Tips zur Makrobiotik, zur Kunst, das Leben zu verlängern.
Komisch, dass wir – zwar – alle alt werden wollen, – aber – alt sein will Keiner. Bei reich werden und reich sein ist das etwas anders. In Heidelberg gibt es eine wunderbare vielbesuchte Einrichtung, eine Universität für Menschen in der dritten Lebensphase, die heißt Akademie für Ältere. Hieße sie Akademie für Alte würde wohl keiner kommen.
Die problematische Frage, wann das Alter denn nun anfängt, hat ein unbekannter Dichter mal so beschrieben:
Das Alter
Es ist schon seltsam mit dem Alter
Wenn man 13 und noch Kind
Weiß man glasklar dass das Alter
So um die 20 rum beginnt.
Ist man selber aber zwanzig
Denkt man nicht mehr ganz so steif
Denkt jedoch so um die Dreißig
Sei man für den Sperrmüll reif.
Dreißiger schon etwas weiser
Und vom Lebenskampf geprägt
Haben den Beginn des Alters
Dann auf 40 festgelegt.
Vierziger mit Hang zum Grübeln
Sagen dumpf wie ein Fagott
Mit 50 sei die Altersgrenze
Und von da ab sei man Schrott.
Doch nach den Fünfzig peu a peu
Schraubt man das Alter in die Höh‘
Die 60 scheint noch ganz passabel
Und erst die 70 miserabel.
Mit 70 hofft man still
Ich werde 80 so Gott will.
Und wer die 80 überlebt,
zielsicher nach der 90 strebt.
Dort angelangt zählt er geschwind
Die Leute die noch älter sind.
Die 90er die denken dann:
Das Alter fängt mit 100 an!
unbekannter Dichter
Thema des Tages sind Gesundheitstips im Alter: Ja, was wollt ihr mehr vom Arzt?
Definieren wir zunächst das Alter
Als Material bringe ich mit: Ein Diana-Bild, einen Spiegel (in dem Sie sich sehen), und das „Rauchhaupt-Protrait“ unseres ältesten Patienten, des 1990 verstorbenen Herrn von Rauchhaupt.
Haben diese Dinge ein Gemeinsames? Alle zeigen eine oder einen Sterblichen.
Beachte dennoch den Unterschied:
„Like a candle in the wind“: sang Elton John über Prinzessin Dianas früh ausgeblasenens Lebenslicht. Die Zufälligkeit der individuellen Lebensdauer zeigt das erste Bild.
Das zweite, Ihr Spiegelbild, zeigt uns die durchschnittliche Dauer des Lebens unter idealen Bedingungen, vor 2500 Jahren (Psalmen Davids) wie heute bei der Altersstatistik der Allianzversicherung.
„Unser Leben währet 70 Jahre, und wenn’s hoch kommt sind’s 80 Jahre, und wenn’s köstlich gewesen ist, so ist’s Mühe und Arbeit gewesen.“
Und mit dem Spiegel halte ich Ihnen wie es der berühmte Brückenaffe an der Heidelberger alten Brücke tut, Ihr eigenes individuelles Konterfei als Spiegel der Selbsterkenntnis vor:
„Was thustu mich hie angaffen?
Hastu nicht gesehen den alten Affen
Zu Heidelberg / sich dich hin und her:
Da findestu wol meines gleichen mehr!“
So schreibt Martin Zeller (1632) – so habe der Spruch unter dem Brückenaffen geheißen.
„Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen.“ 5. Mose 34, Vers 7. Hier kommt die maximal mögliche Dauer des Lebens als ein Vorgang, der sich definitiv beendet.
„Der Tod ist der Kunstgriff der Natur zur ewigen Jugend“ sagte Goethe,
und dass das maximal mögliche Alter auch unter besten Bedingungen nicht über 120 Jahre geht, haben die alten Bücher der Bibel schon vor Jahrtausenden erkannt. Wenn auch in sagenumwogener Zeit Lebensräume von Jahrtausenden durchlebt worden sein sollen:
„Noah war noch 950 Jahre alt, und starb 350 Jahre nach der Sintflut.“ So steht es bei 1.Mose 9, Vers 28 u 29. Es waren im Schnitt alle Mitmenschen von Noah so alt, aber Gott sucht offensichtlich eine bessere Lösung zur Regelung der Überbevölkerung als das kollektive Ertrinken:
„Aber als sich die Menschen zu mehren begannen … sprach Gott: Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre.!“ 1. Mose 6, Vers 1-3
Und das ist bis heute so geblieben. Ein genetisch verankertes Program des Todes, das wir entsprechend auch in jedem Tier finden. Es sind hier klare Korrelationen umgekehrt zur Herzfrequenz: je schneller das Herz schlägt, desto kurzlebiger ist das Tier, Schildkröten und Papageien mit einer Lebenserwartung von 300 Jahren haben eine sehr langsame Frequenz. Und Eintagsfliegen sollen einen rasend schnellen Puls haben. Auch ist eine klare Korrelatin zur Geschlechtsreife einprogrammiert. Im allgemeinen werden Menschen wie Tiere 5 x so alt wie der Zeitraum zur Geschlechtsreife, also 5 x 15 = 75. Ein Elefant wird erst mit 20 geschlechtsreif, lebt dafür aber im Schnitt 100 Jahre…
Hier haben wir eine genaue genetische Definition der maximal möglichen Lebensspanne und das ist ja das Interessante, dass in uns ein Tod programmiert ist, dessen Entprogrammisierung noch tödlicher wäre: Die Krebszelle hat ja den Zelltod – die Apoptose – aufgehoben. <Siehe unseren Wartezimmer-Ordner „Tod“>
Definieren wir dann Gesundheit
Gesundheit ist das Schweigen der Organe. (franz. Chirurg X)
Gesundheit ist die völlige Abwesenheit von körperlichen, geistigen und sozialen Störungen. (World Health Organisation)
Gesundheit ist die Fähigkeit, Arbeiten und Lieben zu können. (Freud?)
Gesundheit … ich suche weitere Definitionen, wer hilft mir?
Pobleme der Ratschläge für Gesundheitstips im Alter
Wir kommen im Alter auf ein Feld, wo wir mit immer weniger Lösungsmöglichkeiten, immer mehr endgültigen Verlusten leben müssen. Wachstum (als Lebensprinzip immer noch die Nummer eins) ist vorbei, Bewahren (das konservative Muster als zweites Prinzip) ist oft nicht mehr möglich, dennoch ist hier die hohe Schule: Nicht verzweifeln, sondern die neue Lage mit der Summe der Lebenserfahrung meistern.
Gibt es so etwas wie eine Altersweisheit, oder ist es nur eine zunehmende Vorsichtigkeit, Ängstlichkeit und einfach die Umbenennung der zu hoch hängenden Trauben in saure Früchte? Sicher gibt es eine Altersphilosophie, die auf der besonderen Möglichkeit der zusammenfassenden Überschau fußt und die große Summen der Erfahrungen nutzt, aber nicht nach einer Kosten-Nutzen-Effizienzausrichtung sondern in großer Gelassenheit, wissend um alle Unabwägbarkeiten und dennoch nicht resignieren.
„Das Alter ist eine wunderbare Sache, wenn man nicht verlernt hat was Anfangen heißt.“ (Martin Buber)
Hören wir die Alten an, wir haben dazu unseren ältesten Patient im 108 Lebensjahr befragt, einem rüstigen Mann, der sich noch gut erinnerte, wie auf seinem väterlichen Gut in Ostpreußen Kaiser Wilhelm zu Gast war. Dieser Mann, Patient kann ich ihn nicht nennen, denn er war bis ins hohe Alter frei von allen Krankheiten, war Professor von Rauchhaupt. Er sagte:
Drei Lebensprinzipien möchte ich mein hohes Alter zuschreiben:
Nicht jede Buddel ganz austrinken.
Täglich lange Spaziergänge.
Jederzeit bereit sein, was neues Anzufangen.“
(von Rauchhaupt)
Medizinisch zusammengefaßt: Mäßigung, aber sich täglich körperlichen und geistigen Anforderungen stellen. Oder wie Hesse (1877 – 1962) es im hohen Alter – er wurde 85, sagte, besonders im Hinblick auf die von Martin Buber geforderte Bereitschaft des permanenten Neubeginns:
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
an keinem wie an einer Heimat hängen,
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreis
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise
mag lähmender Gewöhung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
uns neuen Räumen jung entgegensenden,
des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…
wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.
Hermann Hesse
Anders sieht das Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-91), gestorben mit 52 Jahren:
Der Greis
Die bösen Tage sind kommen;
Da sind sie nun, die Jahre
Von denen ich sagen muß:
Leer sind sie mir von Freuden!
Sonne, Licht, Mond und Sterne
Dunkeln um mich. Ich sehe nur Wolken
Und höre nur rasselnden Regen.
Die Hüter meiner Leibeshütte, die Hände, zittern.
Es krümmen sich die Starken, meine Füße.
Meine Zähne, die Mühlenmägde,
haben Feierabend gemacht.
Aus den Fenstern der Augen blicken nicht mehr
freundlich lächelnde Geister.
Verschlossen sind die Türen nach der Straße,
denn vergebens horcht das Ohr nach Vogellaut;
verstummt sind ihm die Töchter des Gesangs.
Schwindeld fürcht‘ ich mich auf dem Hügel
Und schrecke bei Tritte auf ebenem Wege.
An meinem Stabe zusammengekrümt
Bin ich der Heuschrecke gleich.
Vertrocknet ist mir die Lust
Bald wird ich beziehen mein ewiges Haus –
Und die Kläger werden beflort gehen auf den Gassen.
Christian Friedrich Daniel Schubart
Letzteres darf bezweifelt werden, die werden mit Freude den Abschied dieses Exemplares begrüßen.
Wir wollen jetzt lernen, welche ärztlichen Tips es geben kann, um von dem im letzten Gedicht geschilderten Greisenpessimismus zur Hesse’schen optimistischen Sicht – auch über die unvermeidliche Grenze (mors ultima linea rerum est) hinaus – zu gelangen.
Ich gebe hier drei Dinge:
Erstens:
Nutzen Sie die Kenntnisse der Medizinmänner und Frauen. Nur die individuelle aktive Sucharbeit des Artzes und des wachen Patienten nach pathologischen Veränderungen ist in der Lage den vorzeitigen Killern auf die Spur zu kommen. Es gibt viele Krankheiten, deren rechtzeitige Diagnose Heilung verspricht. Lassen Sie Ihren Stuhl halbjährlich auf Blut untersuchen: eine kleine Operation mit Herausnahme eines fünf cm langen Darmstückes hat den ganzen Dickdarmkrebs von Präsident Reagan besiegt. Ihn aber nicht vor Alzheimer bewahrt. Hier sehen wir, dass der ärztliche Rat allerhöchstens ein Drittel der Krankheiten erfaßt, zweidrittel sind unweigerlich schicksalshaft unumgänglich.
Zweitens:
Leben ist Bewegung. Fordern Sie diese aktiv von Ihrem Geist und von Ihrem Körper. Geistig und körperlich drohen Sie bei Bewegungslosikeit einzusteifen. Wer aber nach dem mittleren Satz von Rauchhaupt lebt, „täglich lange Spaziergänge“ zu durchlaufen, der merkt auf einmal das Wort spatium, der Raum, engl. space, ist immer auch ein großer Gedankenraum, den man mit durchläuft. Und das befreit aus körperlicher und geistiger Enge zugleich.
Hier wo ich wohne am Schloßberg sind etliche Frauen weit über 80 Jahre alte und ohne Auto, die täglich mehrmals von Markplatzhöhe 126 m üNN auf Schloßhöhe und mehr steigen, 260 m üNN, das sind Leistungen, bei denen Flachlandbewohner klopfenden Herzens kapitulieren. Das ist aber ein Sauerstoffkick an alle Zellen, daraus entstehen nicht nur Muskelpakete, sondern auch biologisch frischere Zellen, die sich eher und leichter gegen Krebs wehren können und vergessen Sie nie, das Gehirn macht nur 2 % des Körpergewichtes aus, aber es verbraucht 20 % des Sauerstoffes.
Gehen Sie also bergauf, und es wird Ihnen mit geistigen Höhenflügen gedankt. Das gilt auch für tägliche kleine Schritte, ein medizinischer Zahlenfreak hat mal errechnet, dass jede Treppenstufe, die wir aufwärts schreiten, unser Leben um 4 sec über unser durchschnittlich zu erwartendes Alter hinaus verlängert.
Drittens:
Nutzen Sie die Technik. Wir haben lange Auszüge aus dem französichen Adelsregister studiert, wo Generationen auf Generationen weit über 80 geworden sind. Die biologische Notwendigkeit Ihres Altwerdens hört aber bei dreißig auf. In Zeiten härtesten Überlebenskampf, Neandertaler-Niveau, dreißigjähriger Krieg etc sind die Menschen gerade so alt geworden, dass die Geschlechtsreife (15 J.) plus die Zeit der Hilflosigkeit der Brut, (15 Jahre) durchlebt werden mußte, danach war die Lebenskraft verbraucht, aber das Überleben der Art gesichert.
Wie Wilhelm Busch sagt: „Es läuft die Zeit im Sauseschritt, und eins, zwei drei, wir laufen mit“. Und wir sehen über diesem Text die Füße des Sensenmannes. Und als Knopp endlich sein Julchen verheiratet hat, kommt „die schwarze Parze mit der Nasenwarze und schneidet schnapp! Knoop sein Lebensfaden ab.“
Damit das aber nicht zu früh erfolgt, gilt es mutwilligen vorzeitigen Verbrauch der Lebenskerze vorzubeugen, als da sind excesse in vino et veneras. Es gilt aber vor allem, die äußere Armut fernzuhalten und keine innere Langeweile aufkommen zu lassen, die dann Exzesse als Füllsel anzieht.
Deshalb das französiche Adelsregister als Beispiel: Hier ist die Widrigkeit äußerer Einflüsse gering gehalten. Schützende Schlossmauern, trockene Räume, warme Betten, ausreichend Personal und nicht zu letzt: „Rotwein ist für alte Knaben, eine der ganz besonderen Gaben.“ Wir können aber hier im Westen zur Zeit behaupten, dass die äußere Lebensqualität fast so ist wie „Gott in Frankreich“. Nutzen Sie aber bitte die Technik nicht nur in Form der Glotze, die in der Diskrepanz von geistige Überreizung und körperliche passiver Erstarrung dazuführt, wie Reich-Ranitzki sagt: „Fernsehn macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer.“
Drei Beispiele für gute Hilfen der Technik:
1. Technik fürs körperliche Wohlbefinden: Nehmen Sie so oft es geht ein heißes Bad und wenn Sie Sorgen mit der Einstiegshürde haben, nutzen Sie die Angebote unserer Krankenkassen, daß Badewannenlifter verschrieben werden können. Kennen Sie die Warmbadetage in den Hallenbädern und besonders im Sommer, gehen Sie ins Thermalbad. Dort kombiniert sich ideal die Lust-Luft-Licht Therapie. Sie brauchen Sonne umVitamin D aufzubauen. Im Winter ist die Nutzung eines Solariums erlaubt. Nicht um als Elektroneger herumzulaufen, sondern nur für die einmal wöchentliche Anregung der Vitaminbildung. Genauso nutzen Sie die Calciumzufuhr im Verbund mit Licht und Bewegung zur Osteoporoseprophylaxe.
2. Technik fürs geistige Wohlbefinden: Kaufen Sie sich ein Fax-Gerät und kommunizieren Sie so mit Zeitungen durch häufige Leserbriefe, kommunizieren Sie so mit Ihren Kindern, die Sie damit nicht stören, sondern nur bereichern, malen Sie Bilder, schneiden Sie, die Sie Zeit haben zum ausführlichen Lesen, Artikel aus, die Ihre Kinder interessieren könnten und faxen Sie denen Aktuelles zu: so ergänzen sich beide.
Für technisch mutige, die gut eine Tastatur bedienen können, würde ich sofort zum Internet Einstieg raten, dann können Sie mit allen Gleichaltrigen sich zusammenschalten, aber auch mit ganz Jungen ohne Ihre Identität zu offenbaren. Nutzen Sie das globale Dorf, nutzen Sie so den Bildschirm aktiv. So könnten Sie sich diesenVortrag sofort ausgedruckt anschauen, zu Hause, und weiterfaxen, versehen mit Ihren eigenen bissigen Kommentaren. Investieren Sie ins Internet, indem sie einmal ca. 2000 DM ausgeben und dann vielleicht nocheinmal 200 DM an einen Studenten zahlen, damit er Ihnen die ersten zehn Stunden Unterricht gibt, bis Sie so fit sind, alleine weiterzulernen.
3. Technik für Luxustaten. Nutzen Sie den Freiraum der völligen Zeitungebundenheit. Suchen Sienach Billigflugreisen zu Zeiten wo arbeitende Menschen im allgemeinen Urlaub machen, ist alles voll und teuer. Aber dazwischen gibt es oft Angebote, die sich in den Lebenshaltungskosten kaum von den Kosten hier unterscheiden. Wagen Sie das Risiko! Fliegen ist für alte Menschen kein Risiko, bei einem Absturz haben Sie sogar viel weniger potentielle Lebensjahre zu verlieren als ihre jungen Mitflieger.
Die Sonne des Südens ist für alte Menschen so gut als Vitamin-D Lieferant gegen Osteoporose, dass ich sogar zur mäßigen Solarienbesuchen rate. Wobei eine Tiefbräunung allerdings die Haut schädigt und vorzeitig altern läßt. Die mediterrane Ernährung (kaltgeschlagene Olivenöle, viel Fisch, Rotwein, immer frisches Gemüse, frisches Brot) im Zusammenhang mit der jodhaltigen Salzluft des Meeres und der durch die sonnige Wärme geförderten besseren Durchblutung und Bewegungsbereitschaft der Muskeln sind ein wahrer Jugendbronn.
Nach diesen drei Tips aus der heutigen Zeit zum Schluß ein Blick auf die Makrobiotik. Die Kunst, das Leben zu verlängern. So nannte Christoph Wilhem Hufeland, der Leibarzt Goethes, sein Lebenswerk, das er auf seinem Sterbelager in Gedichtform faßte, und das in seiner Einfalt uns heute vielleicht „primitiv“ erscheint, aber in seiner Ausführung uns sehr hilft, und wenn wir uns nicht an so primitive Regeln halten, verkürzen wir eben die Lebensdauer:
Willst leben froh und in die Läng
Leb in der Jugend hart und streng. Unsere arme Jugend…
Genieße alles, doch mit Maß
Und was dir schlecht bekommt, das laß. Das Fleisch ist willig…
Das Heute ist ein eigen Ding,
das ganze Leben in einem Ring. Omnis dies vitam …
die Gegenwart – Vergangenheit,
und selbst der Keim der künft’gen Zeit.
Drum lebe lmmer nur für heut,
Arbeit, genieße, was es beut.
Und sorge für den Morgen nicht,
du hast ihn heut schon zugericht. „Schauet die Vöglein unterm Himmel an…
Was du genießt, genieß mit Dank
So sei dein Leben ein Lobgesang.
Mit Milch fängst du dein Leben an
Mit Wein kannst du es wohl beschließen Koronarer Schutzfaktor des Alkohols
Doch fängst du mit dem Ende an
So wird das Ende dich verdrießen.
Die Luft, Mensch, ist dein Element
Du lebst nicht von ihr getrennt,
drum täglich in das Freie geh‘
und besser noch auf Berges Höh‘.
Das Zweite ist das Wasserreich
Es reinigt dich, und stärkt zugleich,
drum wasche tälich deinen Leib
und bade oft zum Zeitvertreib.
Dein Tisch sei stets einfacher Art,
sei Kraft, mit Wohlgeschmack gepaart
Mischst du zusammen vielerlei,
so wirdÆs für dich ein Hexenbrei.
Iß mäßig stets und ohne Hast
Daß du nie fühlst des Magens Last,
genieß es auch mit frohem Mut
so gibt’s dir ein gesundes Blut. Eat seasonal, regional, social
Fleisch nährt, stärket und macht warm
Die Pflanzenkost erschlafft den Darm,
sie kühlet und eröffnet gut,
iund macht dabei ein leichtes Blut.
Das Obst ist wahre Gottesgab,
es labt, erfrischt und kühlet ab,
doch über allem steht das Brot,
ja jede Speise kann allein
mit Brot nur gesegnet sein.
Das Fett verschleimt, verdaut sich schwer,
Salz macht scharf‘ Blut und reizet sehr;
Gewürze, ganz dem Feuer gleich
Es wärmet, aber zündet leicht.
Willst du gedeihlich Fisch genießen,
mußt du ihn stets mit Wein begießen.
Den Käse iß nie in Übermaß
Mit Brot, zum Nachtisch, taugt er was.
Der Wein erfreut des Menschen Herz,
Zuviel getrunken macht er Schmerz,
er öffnet sträflich deine Mund
und tut selbst dein Geheimnis kund.
Das Wasser ist der beste Trank
Es macht fürwahr dein Leben lang,
Es kühlet und reiniget dein Blut
Und gibt dir frishcen Lebensmut.
Der Branntwein nur für Krnake ist,
dem Gesundern er das Herz abfrißt,
an seinen Trunk gewöhn dich nie,
er macht dech endlich gar zum Vieh.
Befleiß’ge dich der Reinlichkeit,
Luft, Wäsche, Bett sei oft erneut,
denn Schmutz verdirbt nicht bloß das Blut
auch deiner Seel‘ er Schaden tut.
Willst schlafen ruhgi und komplett
Nimm keine Sorgen mit ins Bet,
auch nicht des vollen Magens Tracht,
und geh‘ zur Ruh‘ vor Mitternacht.
Schlaf ist des Menschen Pflanzenzeit,
wo Nahrung, Wachstum baß gedeiht,
Und selbst die Seel‘ vom Tag verwirrt,
Hier gleichsam neu geboren wird.
Schläfst du zu wenig, wird du matt,
wirst mager und des Lebens satt,
schläfst du zu lang und kehrest es um
so wirst du fett, jawohl auch dumm.
Willst immer froh und heiter sein,
denk nicht: „Es könnte besser sein.“
Arbeite, bet‘, vertraue Gott
Und hilf dem Nächsten aus der Not.
Vermeide allen Müßiggang Müßiggang ist aller Liebe Anfang
Er macht dir Zeit und Weile lang,
gibt deiner Seele schlechten Klang
und ist des Teufels Ruhebank.
Halt deine Seele frei von Hass die biblischen Risikofaktoren: s.u.
Neid, Zorn und Streites Übermaß,
Und richte immer deinen Sinn
Auf Seelenruh und Frieden hin.
Denn Leib und Seele sind genau
In dir vereint, wie Mann und Frau
Und müssen stets, sollst du gedeihn
In guter Eh‘ zusammen sein.
Liebe reine Herzensliebe
Führe dich der Ehe zu;
Denn sie heiligt deine Triebe
Gibt dem Leben Dauer und Ruh.
Bewege täglich deinen Leib,
sei’s Arbeit oder Zeitvertreib;
Zu viele Ruh macht dich zum Sumpf
Sowohl an Leib als Seele stumpf.
Willst sterben ruhig und ohne Scheu
So lebe deiner Pflicht getreu,
betracht den Tod als deinen Feund,
der dich erlöst und Gott vereint.
Christoph Wilhem Hufeland, gedichtet auf seinem Sterbelager im August 1836
Und jetzt unsere Tips:
Unser „Jung“-Brunnen zur Langlebigkeit:
Hier werden wir in lockerer Folge zu einzelnen Krankheitsbildern des vorzeitigen Alterns Abhilfetips geben.
Heute unser Tip zur Osteoporose:
Was macht die Hexe aus:
Sie ist eine alte Frau. (Männer sterben früher, deshalb nennen wir die Rückenveränderung auch Witwenbuckel) Sie hat eine Warze auf der Nase, einen Stock (die alten Hexen sind hier gemeint, die jungen reiten auf einer am Ende behaarten Stange, dem Besen!) und einen Rundrücken. (d.h. die äußeren und inneren Organe verändern sich!) Dem Formverlust des Rückens Können wir entgegenwirken. Hier ist die Rückenschule gleich die wichtigste Anti-Osteoporose-Schule. Die Osteoporose ist eine Alterserkrankung, deren Ursache aber in der Lebensführung liegt.
Wer sitzt macht automatisch schon einen Rundrücken.
Und schädigt sich dreifach doppelt:
1. Duo-Negativ-Wirkung: Es verkürzen sich in der Sitzhaltung die vorderen Muskeln, und duo: es erschlaffen die Rückenmuskeln, Aufrechtgehen wird schwer.
2. Duo-Negativ-Wirkung: ein Stuhl hat eine Lehne, man lehnt sich an, es erlahmt der Gleichgewichtssinn (ganz wichtig als Sturzprophylaxe, denn Fallgruben finden wir überall auf unserem Lebensweg) und duo: es fehlt das bewegungsbedingte Muskel- und Knochenaufbautraining. Wer rastet, rostet und rostiges Eisen zerbricht. Der Muskel setzt immer am Knochen an. Die Knochenstärke ist ein Produkt aus Sehnenzugkraft des Muskels und Sehenzughäufigkeit! Die aufrechte Haltung antrainiert als Seelen- und Körperhaltung macht uns fit für ein hohes Alter. Ich habe am 6. Februar 1998 Jehudi Menhuin gesehen, als Dirigent, schwungvoll, energisch und ganz gerade, mit 84 Jahren!
3. Duo-Negativ-Wirkung: Wer sitzt wird nicht so hungrig und so müde. Der Hunger ist notwendig, damit wir genügend Lust auf Calciumhaltige Nahrungsmittel, Milch, Gemüse bekommen und Lust auf Sprudelwasser. Falsch ist es viel Fleisch zu essen oder konservierte Getränke zu trinken, denn Cola oder Limo und Fleisch enthalten Phosphate und die verdrängen bei der Nahrungsaufnahme das Calcium. Duo: Wer nicht müde wird, kommt nicht in den Tiefschlaf, und nur dann werden Regenerationshormone ausgeschüttet, die den Knochen aufbauen.
Und ganz zum Schluß noch die wichtigen alttestamentarischen Tips zur Vermeidung von Risikofaktoren, die unser Leben vorzeitig beenden können:
Die Risikofaktoren, die auch die moderne Medizin kennt, sind genau in der Bibel festgehalten, und zwar auch in der wichtigen Reihenfolge der Wertigkeiten. Nicht nur der Cholesterinspiegel sondern auch alle anderen bedeutenden Risikofaktoren werden hier aufgezählt. Vor allem die seelischen Bahnungen machen das koronare Risiko aus.
Paulus erzählt uns von denen, „die das Reich Gottes nicht erben werden“, also die, die nicht die gottgewollte Lebensspanne erreichen, die festgelegt ist mit „unser Leben währet 70 Jahre, und wenns hochkommt, so sind es 80 Jahre“, und das sind die Menschen, welche die folgenden Laster pflegen:
„Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen und dergleichen mehr, davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben.“
Galather 5, 20 und 21
Fliegerlied
Vom Nordpol zum Südpol
ist nur ein Katzensprung,
wir fliegen die Strecke
bei jeder Witterung.
Wir warten nicht, wir starten
was immer auch geschieht,
durch Wind und Wetter
klingt das Fliegerlied:
Flieger, gruess mir die Sonne
Grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond
Dein Leben, das ist ein Schweben
durch die Ferne, die keiner bewohnt.
Schneller und immer schneller
rast der Propeller
wie Dir’s grad gefällt!
Piloten ist nichts verboten
drum gib Vollgas und flieg um die Welt!
Such Dir die schönste Sternenschnuppe aus
und bring sie Deinem Mädel mit nach Haus
Udo, grüß mir die Sonne,
grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.