Die richtige Dosis kann einen schmerzvollen Tod verhindern. Wer seinem Leben schwerer Krankheit wegen selbstbestimmt ein Ende setzen möchte und dazu gern ärztliche Hilfe hätte, der sollte sich überlegen, rechtzeitig nach Bayern, Baden-Württemberg oder Berlin umzuziehen. Denn die Wahrscheinlichkeit, einen Arzt zu finden, der bereit ist, einem sterbewilligen Patienten Beihilfe zum Suizid zu leisten, ist in Deutschland abhängig vom Wohnort. Im Süden der Republik und in der Hauptstadt sind die Bestimmungen am liberalsten. Das ergab eine Umfrage der taz unter den 17 Landesärztekammern in Deutschland.
Der Grund: In einigen Bundesländern droht Medizinern, die Menschen bei der Selbsttötung helfen, etwa indem sie ihnen ein entsprechendes Medikament überlassen, ein Berufsverbot nach dem ärztlichen Standesrecht. In anderen Ländern dagegen werden diese Ärzte behandelt wie alle anderen Menschen in der Bundesrepublik derzeit auch: Sie dürfen das. Es droht ihnen keine Sanktion, weder nach dem Strafrecht noch nach den jeweiligen Berufsordnungen für Ärzte. Letztere erlassen die in dieser Frage autonom agierenden Landesärztekammern. In der aktuellen Debatte um eine Reform der Sterbehilfe in Deutschland wurde dies bislang ausgeblendet.
Danach riskiert seine Approbation, wer in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen oder Thüringen einem Patienten beim Suizid assistiert und dabei erwischt wird. In Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein dagegen existiert kein explizites Verbot des ärztlich assistierten Suizids. Folglich riskieren Ärzte dort auch keine berufsrechtlichen Konsequenzen, wenn sie entsprechend helfen.
Besonders prekär ist die Lage in Nordrhein-Westfalen, wo es gleich zwei Ärztekammern gibt: Die Kammer Nordrhein schreibt ihren Ärzten in Paragraf 16 ihrer Satzung kategorisch vor: „Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.“
Moralisch motivierte Willkür
Die Ärztekammer Westfalen-Lippe dagegen fordert, ebenfalls in Paragraf 16 der Berufsordnung, von ihren Ärzten lediglich: „Sie sollen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.“ In der Praxis heißt das: Ein Patient mit Sterbewunsch aus Köln etwa dürfte es aufgrund der dem Arzt dort drohenden Konsequenzen ungleich schwerer haben, einen ärztlichen Helfer zu finden, als beispielsweise einer aus Münster.
Gleichbehandlung von Patienten? Einheitliche medizinische Versorgungsstandards? Klare Rechtslage? In den letzten Lebensfragen gleicht die Republik einem Flickenteppich moralisch motivierter Willkür. „Es droht ein innerdeutscher Suizid-Tourismus“, warnt Urban Wiesing, Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen. Wiesing, bis 2013 zugleich Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, ist überzeugt: „Eine solche Vielfalt im Standesrecht ist den Patienten in Deutschland nicht zumutbar.“
Zwar verfügt keine der 17 von der taz befragten Kammern nach eigenen Angaben über Zahlen oder Schätzungen, wie viele Ärztinnen und Ärzte im jeweiligen Kammerbereich jährlich Beihilfe zum Suizid leisten. Auch verweisen alle Kammern pflichtschuldig darauf, dass die ärztliche Aufgabe die Erhaltung von Leben und die Linderung von Leid sei – und nicht die Beihilfe zum Suizid.
Beihilfe zum Suizid ist in Deutschland erlaubt und bedeutet die Selbsttötung mit Hilfe einer Person, die hierzu ein Mittel bereitstellt, aber nicht verabreicht.
Passive Sterbehilfe ist das Unterlassen oder die Reduktion von eventuell lebensverlängernden Behandlungsmaßnahmen.
Indirekte Sterbehilfe ist die in Kauf genommene Beschleunigung des Todeseintritts als Nebenwirkung einer Medikamentengabe, etwa einer gezielten Schmerzbekämpfung.
Passive und indirekte Sterbehilfe sind legal, sofern eine entsprechende Willensäußerung oder Patientenverfügung vorliegt.
Aktive Sterbehilfe ist die gezielte Herbeiführung des Todes durch Handeln aufgrund eines tatsächlichen oder mutmaßlichen Wunsches einer Person. Die Tötung auf Verlangen ist nach § 216 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe zwischen 6 Monaten und 5 Jahren bedroht. (hh)
Doch allein die Begründungen für die jeweiligen Regelungen machen deutlich, wo Patienten die größten beziehungsweise die geringsten Chancen haben, auf liberal denkende Ärzte zu stoßen, die den Mut haben, sich auch als solche zu outen. So heißt es etwa in der Berufsordnung von Bayern lediglich: „Der Arzt hat Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen.“ Dies lässt viele Interpretationen zu.
Humanere Möglichkeiten
Der baden-württembergische Ärztepräsident Ulrich Clever, dessen Kammer die bayerische Auffassung fast wortgleich teilt, lässt über seinen Pressesprecher präzisieren, wo die Standesorganisation der knapp 61.000 Ärzte im Südwesten politisch steht: „Der Satzungsgeber in Baden-Württemberg hielt es für entbehrlich, das strafrechtliche Verbot der Tötung auf Verlangen in der Berufsordnung zu zitieren. Außerdem sollte, was die Beihilfe zum Suizid angeht, berufsrechtlich keine strengere Regelung als die strafrechtliche getroffen werden.“ Damit sind Ärzte, die den Willen ihrer Patienten respektieren und zugleich dazu beitragen möchten, dass diesen Patienten humanere Möglichkeiten offenstehen, als sich etwa vor einen Zug zu werfen, rechtlich auf der sicheren Seite.
Die Ärztekammer Berlin findet überdies: „Die im Einzelfall von einem Arzt im Rahmen einer gewachsenen Arzt-Patienten-Beziehung getroffene, ethisch wohl abgewogene Entscheidung, bei einem schwer kranken Patienten, der weder mit den Möglichkeiten der Palliativmedizin, der adäquaten Schmerzbehandlung, noch durch Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen eine ausreichende Leidenslinderung erfährt, sollte nicht unter Strafe gestellt werden.“
Aufstand gegen Bund
Mit ihrer liberalen Haltung proben einzelne Landeskammern zugleich den Aufstand gegen den Präsidenten der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery. Dieser hatte beim Deutschen Ärztetag in Kiel 2011 eine in Teilen der Ärzteschaft heftig umstrittene, höchst restriktive Reform der Musterberufsordnung durchsetzen lassen. In dieser heißt es seither: „Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.“
Verfechter dieses Verbots, wie die Landeskammern Thüringen und Hamburg, begründen ihre Haltung noch heute mit der Antizipierung eventueller gesellschaftlicher Entwicklungen, für deren Regelung die Landesärztekammern jedoch überhaupt nicht zuständig sind. „Bei der Zulassung dieser Möglichkeit“, schreibt etwa die Kammer aus Thüringen, habe man die „Sorge“, dass Kranke sich „zu einem suizidalen Schritt genötigt sehen könnten“. Hamburg fordert derweil einen Ausbau der ambulanten palliativmedizinischen Versorgung.
Die Kritiker der Verbotsregelung dagegen hatten sich schon beim Kieler Ärztetag mit ihrem Argument nicht durchsetzen können, der Ärztetag habe überhaupt kein Mandat, die ethische Überzeugung eines Teils seiner Mitglieder als die einzig richtige zu deklarieren – und sodann anderen zu oktroyieren. Was sie als Einschränkung ihrer ärztlichen Freiheitsrechte und Missachtung der Patientenautonomie begreifen, entsorgen sie nun auf ihre Weise: Landesärztekammern sind gegenüber der Bundesärztekammer nicht weisungsgebunden. Über ihre Satzungen entscheiden sie frei.
Kontrovers diskutiert
Unterstützt werden sie dabei durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin aus dem Jahr 2012 (Az.: VG9K63.09). Dieses hatte in einem juristischen Streitfall um die Zulässigkeit ärztlicher Beihilfe entschieden: „Die […] satzungsmäßigen Generalklauseln reichen aber nicht als Rechtsgrundlage aus, um ein […] Verbot für ein Verhalten ausnahmslos auszusprechen, dessen ethische Zulässigkeit in bestimmten Fallkonstellationen auch innerhalb der Ärzteschaft äußerst kontrovers diskutiert wird und dessen Verbot in diesen Ausnahmefällen intensiv in die Freiheit der Berufsausübung des Arztes und seine Gewissensfreiheit eingreift.“
Doch inmitten des Eifers dieser Rebellion gegen die ethische Bevormundung durch die Bundesärztekammer ist es auch zu Pannen gekommen. So haben die Kammern von Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in ihrem stillen Protest ihre Berufsordnungen in Bezug auf den Sterbebeistand seit 2011 gar nicht verändert.
Deswegen gilt dort noch heute eine Regelung, formuliert im Geist der 70er Jahre, in der es heißt: „Der Arzt darf – unter Vorrang des Willens des Patienten – auf lebensverlängernde Maßnahmen nur verzichten und sich auf die Linderung der Beschwerden beschränken, wenn ein Hinausschieben des unvermeidbaren Todes für die sterbende Person lediglich eine unzumutbare Verlängerung des Leidens bedeuten würde.“ Diese Formulierung aber widerspricht allen neueren Bestimmungen zur Patientenautonomie und ist spätestens seit Inkrafttreten des Patientenverfügungsgesetzes im Jahr 2009 eindeutig rechtswidrig: Bei entsprechendem Patientenwillen müssen Ärzte die Vornahme oder die Fortsetzung einer lebenserhaltenden oder lebensverlängernden Behandlung unterlassen. Und zwar auch dann, wenn deren Beginn oder Fortsetzung aus rein medizinischer Sicht geboten wäre.
Dies gilt im Übrigen ohne Rücksicht darauf, ob der Tod nahe bevorsteht. Oder ob der Patient seinen Wohnsitz im Bereich einer Landesärztekammer hat, die dies nicht begriffen hat.
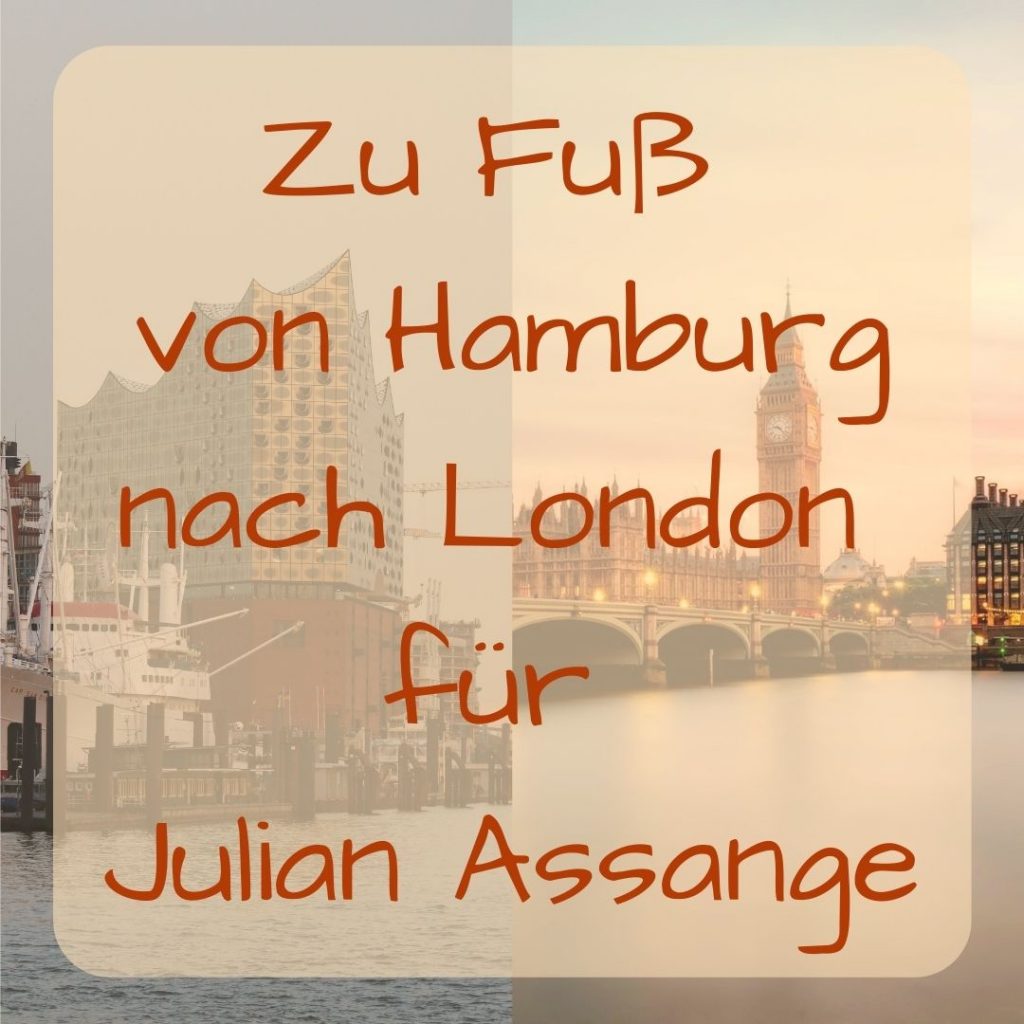





 Zunächst hatten mehrere Nachrichtenagenturen über eine Haftdauer von 19 Jahren berichtet. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch erklärte auf Nachfrage der dpa, dass mit dem Urteil die Gesamtlänge der Haftdauer gemeint sein sollte; also die neun Jahre Straflager, zu denen Nawalny bereits verurteilt wurde, mit eingerechnet seien. Es bleibe aber das schriftliche Urteil abzuwarten, sagte sie. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Straflager für Nawalny gefordert und ihn unter anderem bezichtigt, eine extremistische Organisation gegründet und finanziert zu haben. Er selbst weist die Vorwürfe zurück, auch westliche Beobachter halten sie für politisch motiviert.
Zunächst hatten mehrere Nachrichtenagenturen über eine Haftdauer von 19 Jahren berichtet. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch erklärte auf Nachfrage der dpa, dass mit dem Urteil die Gesamtlänge der Haftdauer gemeint sein sollte; also die neun Jahre Straflager, zu denen Nawalny bereits verurteilt wurde, mit eingerechnet seien. Es bleibe aber das schriftliche Urteil abzuwarten, sagte sie. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Straflager für Nawalny gefordert und ihn unter anderem bezichtigt, eine extremistische Organisation gegründet und finanziert zu haben. Er selbst weist die Vorwürfe zurück, auch westliche Beobachter halten sie für politisch motiviert. Dort nämlich (oder genau jetzt in der Rundschau) werden millionenfach Anweisungen gepostet, wie Sie und ich zu Milliardären werden können. Unter den Hashtags #BillionaireMindset, #MillionaireMindset oder auch #BillionaireRoutine finden sich allerhand Tipps für all jene, die mit stählernem Willen reich werden wollen. Früh morgens um 4 Uhr aufstehen. Meditieren, Sport machen, E-Mails checken. Drei Ziele für den Tag setzen. Ein rohes Ei mit Müsli und Magerquark frühstücken. Um 7 Uhr anfangen zu arbeiten. In der Mittagspause: joggen und die Aktienmärkte checken. Um 18 Uhr dann nach Hause, um am Side Hustle zu arbeiten. Spätestens um 21 Uhr ins güldne Bett. Guter Schlaf ist wichtig.
Dort nämlich (oder genau jetzt in der Rundschau) werden millionenfach Anweisungen gepostet, wie Sie und ich zu Milliardären werden können. Unter den Hashtags #BillionaireMindset, #MillionaireMindset oder auch #BillionaireRoutine finden sich allerhand Tipps für all jene, die mit stählernem Willen reich werden wollen. Früh morgens um 4 Uhr aufstehen. Meditieren, Sport machen, E-Mails checken. Drei Ziele für den Tag setzen. Ein rohes Ei mit Müsli und Magerquark frühstücken. Um 7 Uhr anfangen zu arbeiten. In der Mittagspause: joggen und die Aktienmärkte checken. Um 18 Uhr dann nach Hause, um am Side Hustle zu arbeiten. Spätestens um 21 Uhr ins güldne Bett. Guter Schlaf ist wichtig.