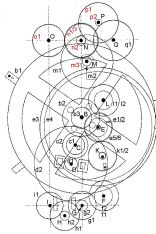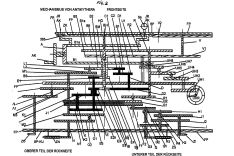Rückkehr aus dem Jenseits?: Wenn Tote plötzlich wieder aufwachen
Das Herz schlägt nicht mehr, die Wiederbelebung ist erfolglos. Doch plötzlich zeigt die Person wieder ein Lebenszeichen. Wie kann das sein? Über das extrem seltene, aber gefürchtete Lazarus-Phänomen.
Es ist eine gruselige Vorstellung: Man wird zunächst für tot erklärt, um dann kurze Zeit später auf dem Obduktionstisch wieder aufzuwachen. Das sogenannte Lazarus-Phänomen kommt zwar so gut wie nie vor – ganz selten aber eben doch. Benannt ist es nach dem biblischen Lazarus, der von Jesus von den Toten auferweckt worden sein soll.
Das Phänomen kann bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand eintreten, die nach erfolglosen notfallmedizinischen Maßnahmen anhand von unsicheren Todeszeichen – Abkühlung des Körpers, Leichenblässe, Puls nicht mehr nachweisbar – und einer Nulllinie im Elektrokardiogramm (EKG) für klinisch tot erklärt wurden – und deren Kreislauf und Atmung plötzlich wieder einsetzen.
Bei dem extrem seltenen Phänomen müsse „das Herz über einige Zeit stillgestanden haben“, erläutert Klaus Püschel, Institutsdirektor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). In Ausnahmefällen könne es aber trotzdem wieder anfangen zu schlagen. Wichtig für die Leichenschau-Routine sei deshalb, dass der Tod eines Menschen zunächst anhand von sicheren Todeszeichen wie Leichenflecken, Leichenstarre, Leichenfäulnis und nicht mit dem Leben vereinbaren Verletzungen festgestellt werden müsse, so Püschel.
Es ist noch nicht restlos geklärt, warum Menschen, die eigentlich erfolglos wiederbelebt wurden, wieder Lebenszeichen zeigen. Zur Häufigkeit des Phänomens gibt eine 2020 veröffentlichte Studie Hinweise: Für diese hat eine Forschungsgruppe die Fachliteratur nach bekannten Fällen seit 1982 durchforstet – damals wurde das Phänomen das erste Mal beschrieben.
„Die Tatsache, dass die Mehrheit der Überlebenden keine Folgeschäden aufwies, ist von allergrößter Bedeutung“, ergänzte Mitautor Mathieu Pasquier. Aufgrund ihrer Erkenntnisse gaben die vier Forscher eine Reihe von Empfehlungen, darunter vor allem, nach Beenden einer Herz-Lungen-Wiederbelebung einen Patienten noch mindestens zehn Minuten mithilfe eines EKG zu überwachen.
Unterschied zu Scheintod
Ein etwas anders gelagerter Fall ereignete sich diesen Sommer in Südamerika. Eine in Ecuador irrtümlich für tot erklärte Frau hat Medienberichten zufolge während ihrer Totenwache wieder Lebenszeichen gezeigt. Angehörige seien gerade dabei gewesen, die vermeintliche Leiche im Sarg für die Beerdigung umzuziehen, als sie bemerkten, dass die ältere Frau noch atmete, hieß es. In diesem Fall spreche man laut Püschel von einem Scheintod.
Der Unterschied zum Lazarus-Phänomen sei, dass Ärzte bei einem Scheintoten nicht richtig untersucht und nach den sicheren Todeszeichen geschaut hätten. „Davon gibt es ja viele oder vergleichsweise mehr Fälle, wenn man die sicheren Todeszeichen eben nicht richtig festgestellt hat und jemand voreilig für tot erklärt wird“, so Püschel. „Dann kann der tatsächlich eventuell Stunden in einem Zustand eines tiefen Komas verharren und dann wieder wach werden.“ Im Extremfall könne dieses Phänomen auch in einer Leichenhalle auftreten, so Püschel. „Es wurden in der alten Literatur sogar Scheintod-Fälle beschrieben, bei denen jemand im Sarg herumkratzte.“
Püschel hat in seiner Laufbahn Tausende von Toten untersucht, wobei er einen Fall bis heute nicht vergessen hat, den er 2005 auch in einem deutschen Fachblatt publizierte: Damals sei eine 83-jährige Frau an einer Bushaltestelle in der Nähe der Klinik zusammengebrochen. Innerhalb weniger Minuten seien Rettungssanitäter und Notarzt vor Ort gewesen, um sie zu reanimieren. „Der Notarzt sagte auch, er habe ein EKG über längere Zeit abgeleitet und es sei eine Nulllinie gewesen“, erzählt Püschel.
Vom Abschluss der Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Frau im Institut für Rechtsmedizin habe es weniger als eine halbe Stunde gedauert. Im Vorraum der Kühlzelle fing das Herz der Frau dann plötzlich wieder an zu schlagen. „Ich war zufällig der diensthabende Arzt und habe dann reanimiert. Wir haben die Anästhesisten des Klinikums gerufen, und diese haben dann tatsächlich die Frau noch kreislaufstabil auf die Intensivstation gebracht.“
Meist kein EKG-Gerät in der Nähe
Nach dem Vorfall habe man sich für das Rettungssystem in Hamburg auf eine eindeutige Richtlinie geeinigt: Die Todesfeststellung einer Patientin oder eines Patienten müsse demnach nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen dadurch erfolgen, dass man mindestens über zehn Minuten ein Nulllinien-EKG ableitet und aufzeichnet.
Leite man sicher eine Nulllinie im Elektrokardiogramm über zehn Minuten ab, sei die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aufwache, gleich Null, so der Rechtsmediziner. Das Problem: Das sichere Ableiten einer Nulllinie finde bei der Todesfeststellung in der Regel nicht statt. „Man kann das im Rettungseinsatz machen, wenn man ein EKG-Gerät dabeihat. Aber wenn ein Hausarzt oder der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst zum Toten in die Wohnung geht, dann nimmt er ja meistens kein EKG mit …
Der letzte Funke Was beim Sterben im Gehirn passiert KI lässt Tote auferstehen Wollen wir die digitalen Klone unserer Verwandten wirklich?
Bei einem Wiederbelebungsversuch ist insbesondere die Geduld ein entscheidender Faktor. „Lazarus-Phänomene kommen vor allen Dingen in der Wiederbelebung vor. Deswegen sage ich immer: Man darf nie zu früh aufgeben“, betont Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin der Uniklinik Köln.
Für ihn gilt: Lieber länger wiederbeleben als kürzer. Tatsächlich könne man auch nach zwei oder gar drei Stunden noch erfolgreich wiederbeleben. „Es wird allerdings immer unwahrscheinlicher, wenn sich jemand nach 20 oder 30 Minuten nicht stabilisiert hat“, betonte Böttiger. Unwahrscheinlich bedeute allerdings nicht unmöglich.