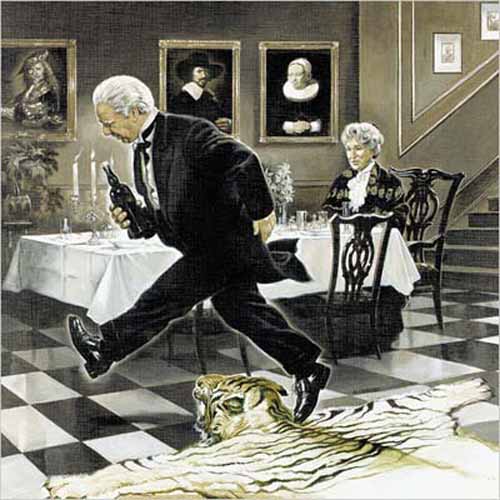Historiker Michael Wolffsohn kam in Tel Aviv zur Welt und wuchs in Berlin auf. Seit Jahren warnt er vor wachsendem Antisemitismus in Deutschland.

Der ehemalige Professor an der Bundeswehruniversität in München ist „vom Herzen her“ Antimilitarist Foto: Jens Gyarmaty
Als Treffpunkt schlägt Michael Wolffsohn das Café Lichtburg im Berliner Wedding vor. Der Ort ist eng mit seiner Familiengeschichte verbunden. „Lichtburg“ hieß der Kinopalast, der hier bis in die 70er Jahre stand. Er gehörte seinem Großvater, bis die Nazis ihn verjagten.
Herr Wolffsohn, als deutsch-jüdischer Historiker sind Sie seit dem 7. Oktober sehr gefragt. Sie sollen alles erklären: Israel, Palästina, Antisemitismus, Judentum, Terror, Krieg, alles. Wie halten Sie es aus?
Michael Wolffsohn: Ich bin ein altes Schlachtross. Und das Sprechen ist auch Entlastung. Denn ich bin zutiefst niedergeschlagen. Von der Entwicklung in Nahost. Und von der Entwicklung in Bezug auf jüdisches Leben in der Diaspora, in Deutschland im Besonderen und ganz besonders in Berlin. Nie habe ich mir vorgestellt, dass es hier je wieder einen so virulenten Antisemitismus gibt. Das auszusprechen ist eine Aufgabe, der ich mich stellen muss.
Um Verständigung herzustellen?
Ich versuche, die Vielschichtigkeit des Konfliktes darzustellen. Geschichte besteht aus vielen Schichten, wie dieses wunderbare Wort zeigt. Das gibt es so in keiner anderen Sprache, die ich kenne.
Am 7. Oktober griff die Hamas Israel an, ermordete um die 1.200 Menschen, verschleppte 250. Haben Sie je mit so einem Angriff gerechnet?
Nein. Aber es überrascht trotzdem nicht. Die Palästinenser sind in der arabischen Welt jene, die im Umgang mit der modernen Waffentechnologie am fähigsten sind. Nicht zuletzt sahen sie sich aufgrund ihrer tragischen Konkurrenz zu Zionismus und Israel auf ihre Weise dazu gezwungen. Seit 2007 wird Israel ständig mit Raketen beschossen. Zuerst waren es selbstgebaute, die dann immer perfektionierter wurden.
Was ist anders an diesem Angriff?
Die Dimension. Wenn wir uns die Geschichte der Terrorakte anschauen, dann ist der 7. Oktober 2023 mit Ausnahme des 11. September 2001 der größte Terrorakt in der westlichen Welt.
Warum diese Gewalt?
Da sind wir bei der mörderischen, aber vor allem selbstmörderischen Strategie der Palästinenser. Denn die Anwendung von Gewalt hat nur Sinn, wenn man ein klar definiertes und erreichbares strategisches Ziel anpeilt.
Und Sie meinen, das ist in der Geschichte der palästinensischen Nationalbewegung nicht der Fall?
Bei aller, aus palästinensischer Sicht nachvollziehbaren Empörung und Wut über Zionismus, war es völlig unrealistisch zu erwarten, dass man Israel damit in die Knie zwingen könne, zumindest seit 1968, seit die palästinensische Befreiungsorganisation PLO den Terrorismus führend mitmacht. Im Gegenteil, das hat die israelische Bevölkerung in ihrer Reaktion selbst immer radikaler gemacht. Das können wir an den Koalitionen, die es in Israel parallel zu den Terrorwellen gab, festmachen. Insofern hat die palästinensische Führung den Zeitpunkt verfehlt, an dem die Gewalt zu einem politischen Zweck im Sinne der Palästinenser oder zu einer friedlichen Lösung geführt hätte.
Wann wäre das gewesen?
1993 nach der ersten Intifada. Die hatte einen strategischen Sinn, der dazu führte, dass es zum Friedensvertrag in Washington kam.
Und warum scheiterte der Friedensprozess?
Weil die palästinensische Führung entschied, eine Doppelstrategie anzuwenden, nämlich Diplomatie und Terror. Ein Fehler. Dann hat die israelische Öffentlichkeit gesagt, also wenn wir „das Risiko des Friedens“ auf uns nehmen, wie der damalige Ministerpräsident Rabin sagte, dann möchten wir auch Frieden und nicht mehr Terror. Das führte 1996 zu ersten Wahl Netanjahus, der Frieden und Sicherheit versprach, aber nicht halten konnte. Dies wiederum führte zur zweiten großen Chance zum Frieden unter der Regierung von Barak, der im Sommer 2000 in Camp David unter der Regie von Clinton den Palästinensern 98 Prozent des Westjordanlandes angeboten hat, Gaza sowieso, plus Ostjerusalem als Hauptstadt.
Klappte das?
Nein, die palästinensische Seite schlug nicht nur das Angebot aus, sie setzte auch weiter auf Gewalt und Terror. Dies führte in der Folge dazu, dass Barak abgelöst und Scharon gewählt wurde. Es kam zur zweiten Intifada. Aber auch hier die Einsicht von Scharon, der alles andere als eine Taube war, 2005 noch mal das Risiko des Friedens einzugehen, und sich aus Gaza zurückzuziehen. Das Ergebnis: die Machtergreifung in Gaza durch die Hamas, die dann in einem Bürgerkrieg die Fatah, eine weltliche Partei, die zur PLO gehört, aus Gaza vertrieb und seit 2007 Israel kontinuierlich mit Raketen bombardierte.
Warum wird so reagiert?
Spätestens seit 2007 ist die palästinensische Gewaltanwendung nur noch Selbstzweck. Die Pläne von israelischen, wie auch arabischen Akteuren, Gaza, ich sag es mal salopp, zu einem Hongkong oder Singapur des Nahen Ostens werden zu lassen, waren fix und fertig in der Schublade. Das politisch ungeschickte Handeln des Palästinenserpräsidenten Abbas und der Terror der Hamas hat diese Entwicklung verhindert. Das ist die Tragödie des palästinensischen Volkes. Dass es Gewalt einsetzte, aber nicht als Mittel zum politischen Zweck, sondern allein als Mittel der Rache und Wut. Besonders deutlich wurde das am 7. Oktober. Die Dimension der Blutorgie ist unvorstellbar. Die Konsequenz: Gaza wird in Schutt und Asche gelegt. Es ist eine Tragödie. Man kann die Wut der Palästinenser nachvollziehen, aber sie müsste sich eigentlich gegen ihre Führung richten, die nicht bereit ist, das Los der eigenen Bevölkerung zu verbessern.
Die Anfänge
Michael Wolffsohn wurde 1947 in Tel Aviv geboren, seine Eltern waren aus Nazideutschland geflohen. 1953 zogen sie zurück nach Berlin. Ab 1966 studierte er an der Freien Universität, ging dann aber 1967 nach Israel, um dort den dreijährigen Wehrdienst zu leisten.
Der Erklärer
Ab 1970 studierte er Geschichte in Berlin, Tel Aviv und New York. Von 1981 bis 2012 lehrte er Geschichte an der Bundeswehrhochschule in München. Einer seiner Schwerpunkte: israelisch-deutsche Geschichte. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und ist ob seiner Bereitschaft, kontrovers zu diskutieren, ein gefragter Gast in Talkshows.
Rache generiert Rache, Hass generiert Hass, sagten Sie einmal. Siedler haben Anfang des Jahres ein palästinensisches Dorf überfallen und zerstört. Ein Mensch starb. Darf man das mit dem Einfall der Hamas vergleichen?
Furchtbar. Von den Mechanismen her identisch. Von der Quantität her nicht vergleichbar, und die Straftaten der Siedler werden im demokratischen Rechtssystem Israels untersucht und vor Gericht bestraft. Die Siedlerbewegung steht in Korrelation mit der aus meiner Sicht falschen, weil auf Gewalt setzenden Politik der Palästinenser. Es hat mehrere Chancen gegeben, dass das Westjordanland Autonomie erhält. Sie wurden alle abgelehnt. 1978 gab es 700 Siedler im Westjordanland. Heute sind 700.000. Das war die Antwort. Ich beschönige nichts: Ich halte die Siedlungspolitik politisch für eine Torheit und viele Siedler sind mir zuwider. Eine Dummheit ergibt die andere.
Sie sagen das so offen, weil Sie gerne das Widersprüchliche an Situationen herausarbeiten.
Widerspruch ist eine Erkenntnismethode. Ich lass mich davon nicht abbringen.
Vor dem Überfall der Hamas deuteten Sie vor allem auf die innere Zerrissenheit Israels. Es gibt „zwei Israels“ sagten Sie.
Eigentlich sogar drei, auch die israelischen Palästinenser kommen hinzu. Die sich bisher, anders als bei früheren Konflikten, ruhig verhalten. In Israel hatten wir vor dem 7. Oktober eine absolut polarisierte Gesellschaft. Und nach dem wahrscheinlichen Sieg über die Hamas werden die innenpolitischen Gegensätze erneut wieder aufflammen.
Es gab auch Proteste gegen die Hamas in Gaza. Ebenso wie im Iran.
Es gibt Umfragen aus dem Süden von Gaza und dem Westjordanland, wie zuverlässig die sind, kann man bezweifeln, dass 75 Prozent sich mit der Mordaktion vom 7. Oktober identifizieren. Aber richtig, es gab diese Proteste. Im Iran, anders als in Gaza, waren es Massenproteste. Das viele Geld, das in den Gazastreifen floss, der Luxus, den sich die Eliten leisten, und das Geld, das in die Tunnelsysteme gesteckt wurde, die Bevölkerung hätte Besseres damit machen können.
In Interviews werden Sie nicht müde zu erklären, dass nach dem Holocaust eines nie mehr geschehen dürfe, nämlich dass Jüdinnen und Juden je wieder so Opfer werden. Der Angriff hat genau das gezeigt. Wie gehen Sie damit um?
Zionismus und Israel haben nie versprochen, dass es Sicherheit nach außen geben werde für das jüdische Volk. Sondern immer nur nach innen. Der Zionismus ist eine Reaktion auf den innenpolitischen Antisemitismus in den Ländern Europas, in Frankreich, in Deutschland, in Osteuropa vor allem. Immer wieder gab es Pogrome bis hin zum Holocaust. Es war vom Beginn der zionistischen Besiedlung von Palästina, oder Zion wie die Juden sagen, klar, dass es zu einem Clash mit der örtlichen Bevölkerung kommen würde. Kurzum, Israel wurde als Zufluchtsort für die Juden und Jüdinnen gegründet, die dort vor innenpolitischem Antisemitismus sicher sein sollten. Ziel war, dass es in diesem Land kein Berlin-Neukölln geben soll, in dem „Tod Israel“, „Tod den Juden“ skandiert wird. Von innen her sollte es keine Judenfeindlichkeit geben.
Ist der Gazakonflikt für Sie eigentlich ein innenpolitischer oder ein außenpolitischer Konflikt?
Das ist eine interessante Frage. Die habe ich mir so noch nicht gestellt. Wenn die Maxime von Israel ist, nie wieder Opfer, dann ist das militärische Übergewicht Israels zwingend. Das ist die Quittung, die die christliche und die islamische Welt bekommt für ihren Jahrtausende währenden Umgang mit den Juden. Die Frage ist doch, wenn Israel verliert, diese letzte Zuflucht, dann, wohin? Nach Neukölln?
Warum schafft es Israel nicht, dass ganz Palästina prosperiert?
Dazu gehören zwei. Es gab im September 2008 von Ministerpräsident Olmert, der Scharon nachfolgte, wieder das Angebot, das Westjordanland zu räumen, der Gazastreifen war es ja schon. Darauf ließ der Palästinenserpräsident durchblicken, dass die Rückkehr aller palästinensischen Flüchtlinge die Voraussetzung wäre. Aber wer sind die Vertriebenen? Im Unabhängigkeitskrieg 1947/48 waren es 700.000 Menschen. Heute sind es mehr als 5 Millionen. Die Angaben schwanken. Das wäre der Selbstmord Israels und die totale Negierung des zionistischen Gründungsmoments, nämlich dass die Juden in ihrem Staat keine Minderheit sind. In dem Augenblick, wo die jüdische Bevölkerung die Minderheit ist, wäre die Situation in Zion identisch wie sie 2.000 Jahre in Europa war, und genau das wollte man verhindern. Ja, klar, man kann fragen, warum akzeptieren die Juden es nicht, wenn sie Minderheit sind. Dann antworte ich: Sie hatten 2.000 Jahre einfach schlechte Erfahrungen damit.
Aus all diesen Gründen sind Sie ein Verfechter des Militärs?
Natürlich.
Sie lehrten Geschichte an der Bundeswehrhochschule und waren gleichzeitig jemand, der der Idee des Pazifismus verbunden ist. Wie passt das zusammen?
Krieg ist eigentlich inakzeptabel. Und Pazifismus ist eine wunderbare Vorstellung. Ich bin kein Pazifist, sondern vom Herzen her ein Antimilitarist.
Israel ist eine Sache, die andere Deutschland. Sie sind 1947 in Israel geboren, ab 1953 wuchsen Sie in Berlin auf. Als Jude in der Bundesrepublik sind Sie ein Seismograf für Antisemitismus. Schon vor 15 Jahren sagten Sie, es werde immer schlimmer. Sie dachten ans Auswandern. Und jetzt?
Ich bin zu alt. Aber ich bin jetzt skeptischer denn je. Nicht weil dieser Staat uns nicht schützen will, sondern weil er es nicht kann. Die sicherheitspolitischen Defizite nach innen, wie auch nach außen, sind so eklatant, dass mir Angst und Bange wird. Auf der anderen Seite sehe ich dankbar, dass die Mehrheit der Deutschen Sicherheitspolitik am liebsten nicht haben möchte. Ich kann das nachvollziehen, erst recht nach dem „Dritten Reich“ und dem Militär im Kaiserreichs, aber es ist unrealistisch.
Antisemitismus in Deutschland kommt aus drei Richtungen, sagen Sie. Von der Linken, von der Rechten und von der muslimischen Seite. Wie geht das jetzt weiter?
Indem man die Wirklichkeit als Wirklichkeit erkennt. Die Einschätzung und die Gegenstrategien zum Antisemitismus waren bis kürzlich geradezu absurd. Bis zum 7. Oktober, das besagen auch die Statistiken, wurde vor allem der rechtsextreme Antisemitismus gesehen. Dabei war schon vorher völlig klar, dass es den linksextremistischen teilweise bis ins linksliberale Lager hineinreichende Antisemitismus auch gibt. Bei der neuen Linken ist es etwas anders als früher, sie versteht sich als antikolonialistisch und Israels Zionismus ist für sie die Speerspitze des westlichen Kolonialismus und Imperialismus, daher die starke Identifizierung mit den Palästinensern. Das ist allerdings bar jeder historischen Realität. Es ist blanker Unsinn und eine Ideologie, die wie ein Krebsgeschwür insbesondere an Universitäten wuchert.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Im linken Lager ist es schwierig, den muslimischen Antisemitismus zu benennen, übrigens auch Homophobie und Frauenfeindlichkeit.
Dabei ist es doch eindeutig. Die erlebte verbale oder körperliche Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, die in zig Statistiken, vor allem von der EU-Agentur für Grundrechte belegt wurde, sagt, dass die meiste Gewalt gegen diese zuletzt von Muslimen ausgegangen ist. Warum kriegt man in Deutschland Ärger, wenn man das ausspricht? Man kann in der Demokratie alles sagen. Aber hier setzt die Schweigespirale ein und da mache ich nicht mit. Dazu gehört eigentlich nicht viel Mut, man muss nur ein Stück weit gesellschaftliche Isolierung auf sich nehmen. Jetzt reden übrigens alle nur noch über die muslimische Gefahr. Das ist in dieser Pauschalität auch völlig idiotisch, es gibt nach wie vor die beiden anderen auch.
Manchmal klingt es so, als fühlten Sie sich als Jude von den Linken besonders verraten.
Ja, weil ich mich denen atmosphärisch immer näher gefühlt habe. Vom internationalistischen Selbstanspruch her. Auch dass sie im kulturellen Sinne das Spießertum bekämpfen will, finde ich gut. Im Grunde fühle ich mich von denen ausgestoßen. Oder anders: Ich kann mich nicht nähern, wenn zwischen Anspruch und Wirklichkeit diese Diskrepanz besteht und fühle mich geschützter durch das konservative Deutschland.
Wenn Sie sich in Talkshows oder Interviews ins Zeug legen, entsteht mitunter der Eindruck, dass es nicht nur um Verstehen geht. Sondern auch um Lösen. Gar um Heilen. Die Konflikte heilen.
Wenn ich das nicht wollte, müsste ich gar nicht erst an Talkshows teilnehmen. Sonst wäre es nur noch Selbstdarstellung.
Sehen Sie eine Lösung für das politische Chaos in Israel?
Ja, ich habe es in meinem Buch zum Weltfrieden dargelegt. Es wäre eine Mischung aus bundesstaatlichen und staatenbündischen Elementen mit mehreren Kammern und Quotenregelungen. In Ansätzen ein Schweizer Modell. Es gibt Möglichkeiten, einen friedlichen Weg zu finden, wenn man sich vom Nationalstaat als einziger Lösung löst. Was jetzt wieder gesagt wird, Zweistaatenlösung, das ist doch gar nicht durchdacht. Von den meisten Politikern aller Parteien bekomme ich auf mein Friedensmodell die Antwort, interessant, aber unrealistisch, auch von der Linken. Mit der AfD spreche ich nicht.
Sie haben vor ungefähr zwanzig Jahren einen Häuserblock in Berlin geerbt. Einst gehörte er mit dem Filmpalast „Lichtburg“ Ihrem Großvater. Er wurde von den Nazis enteignet und floh nach Israel. Kurz nach dem Krieg, kam er zurück und kämpfte sehr darum, sein Eigentum wiederzubekommen. Mit der Gartenstadt Atlantic, einer 20er-Jahre-Reformsiedlung, gelang es. Mit dem Kino nicht. Wie groß ist die Gartenstadt?
500 Wohnungen mit Kindergärten, einer Stiftung, Restaurants, mit Spenden und mit Fördergeldern finanzierte Lernwerkstätten in Physik, Musik, bildende Kunst, Kochen, Natur, Theater, Literatur und neue Medien. Mit 73.000 Teilnehmenden vor Corona pro Jahr.
Als Sie die Gartenstadt erbten, riet man Ihnen, sie zu verkaufen. Sie aber haben Kredite aufgenommen, sie saniert und vermieten bewusst an jüdische und muslimische Menschen, biodeutsch oder nicht.
Wir vermieten an alle.
Gelingt das Zusammenleben?
Ja, es ist eine friedliche Oase. Dass es klappt, hat nichts mit jüdisch oder muslimisch zu tun, sondern mit der Frage, was braucht der Mensch? Er braucht eben mehr als ein Dach über dem Kopf. Es geht darum, sich heimisch zu fühlen. Der Mensch muss im Vordergrund stehen und nicht die Frage, wie maximiere ich meine Rendite.
Ist die Gartenstadt die Plattform, wo Sie wenigstens ein bisschen das kulturelle, religiöse und politische Chaos heilen können?
Ja, aber Operation gelungen, Patient tot. Die Erfolge, die wir auf der Mikroebene herzerwärmenderweise haben, spiegeln sich auf der Makroebene nicht wider. Das erleben wir seit dem 7. Oktober mit „Tod den Juden und Tod Israel“. Das ist weltweit der Fall, und leider setzten sich die illusionsfreien Verständigungsbereiten nicht durch.
Ist die Macht der Worte also passé?
Das Judentum ist eine Wortreligion und das Schicksal der Juden zeigt, dass diese Worte nicht sehr mächtig sind.
Keine Hoffnung?
Wenig.