 Zum zweiten Mal ist Olaf Scholz an einen Ort geeilt, den die Wassermassen bedrohen. Das musste er auch, denn als Katastrophen die Elbe und Ahr heimsuchten, wurden Karrieren beschleunigt und beendigt.
Zum zweiten Mal ist Olaf Scholz an einen Ort geeilt, den die Wassermassen bedrohen. Das musste er auch, denn als Katastrophen die Elbe und Ahr heimsuchten, wurden Karrieren beschleunigt und beendigt.
Heute ist unser aller Bundeskanzler in das Städtchen Sangerhausen gereist und stand am Deich an der Helmebrücke, begutachtete ihn kritisch und riet ihm dringend, doch gefälligst den Wassermassen standzuhalten. Ob sich der Deich davon beeindrucken lässt? Na ja, warum nicht. Kameras sind besonders dann unbarmherzig, wenn sich ein herausgehobener Mann des Staates in Gummistiefeln und Regenjacke der Flut nähert, die Deutschland öfter als früher heimsucht.
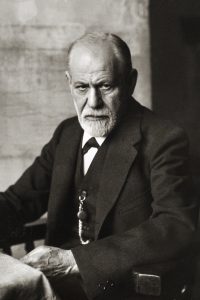
Sigmund Freud 1926
Zum geflügelten Wort wurde der Aphorismus von Karl Kraus, wonach die Psychoanalyse jene Geisteskrankheit sei, für deren Therapie sie sich halte – einigermaßen zu Recht, beschreibt er damit doch eine kassenwirksame Grundmodalität vieler Tätigkeiten nicht nur im psychologisch begründeten Beratungs-, Consulting- oder Coaching-Geschäft der modernen Gesellschaft.
Zwar hätte der berühmte österreichische Publizist Kraus (1874–1936) es auch wegen seiner justizkritischen Schriften oder seines erstaunlich großen Einflusses auf die Sprachphilosophie verdient, von jeder Generation im deutschsprachigen Raum neu entdeckt zu werden.
Bekannt bleibt aber vor allem seine scharfe Polemik gegen den Versuch, die menschliche Geistestätigkeit mit der Freud’schen Lehre und ihren populär gewordenen Elementen erklären zu wollen – unter anderem der Traumdeutung, der Fixierung auf frühkindliche Erinnerungen, dem Ödipuskomplex oder der dämonischen Wirkungsmacht des Unbewussten, volkstümlich gern „Unterbewusstsein“ genannt. Über die Mode, die eigenen, meist bürgerlichen Kinder mit seelenkundlichen Mitteln verstehen zu wollen, schrieb (unser Mitarbeiter Karl) Kraus schon im Jahr 1912: „Kinder psychoanalytischer Eltern welken früh.
 In diesem Abschnitt des Jahres wird viel geredet, viel versprochen und auch ein wenig gehadert. Was schenkt man dem Kollegen zum Geburtstag, falls der gefeiert wird?
In diesem Abschnitt des Jahres wird viel geredet, viel versprochen und auch ein wenig gehadert. Was schenkt man dem Kollegen zum Geburtstag, falls der gefeiert wird? Man möcht es nicht glauben, man fasst es nicht: In Bern wurde das Konzert einer weißen Reggae-Band abgebrochen. Der Grund: Zuschauer beschwerten sich, es handle sich um kulturelle Aneignung. Das Kulturzentrum verteidigt die Entscheidung, die Band versteht die Welt nicht mehr – (wir auch nicht) –
Man möcht es nicht glauben, man fasst es nicht: In Bern wurde das Konzert einer weißen Reggae-Band abgebrochen. Der Grund: Zuschauer beschwerten sich, es handle sich um kulturelle Aneignung. Das Kulturzentrum verteidigt die Entscheidung, die Band versteht die Welt nicht mehr – (wir auch nicht) – Das sogenannte Königreich Deutschland wirbt bundesweit massiv um neue Mitglieder. Recherchen zeigen, mit welchen zweifelhaften Inhalten die Gruppe auf Mitgliederfang geht. Behörden sprechen von einem „starken Expansionsdrang“.
Das sogenannte Königreich Deutschland wirbt bundesweit massiv um neue Mitglieder. Recherchen zeigen, mit welchen zweifelhaften Inhalten die Gruppe auf Mitgliederfang geht. Behörden sprechen von einem „starken Expansionsdrang“. Eine brandgefährliche Liaison:
Eine brandgefährliche Liaison: 