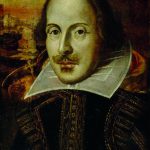 Am Freitag, den 25. November, ab 20:00 Uhr, veranstaltet das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) Heidelberg im Rahmen der Reihe Slow Reading Room eine Nacht zu Ehren von William Shakespeare. Zu Gast sind dann sowohl Shakespeare-Übersetzer und -Experte Frank Günther als auch die Schauspieler Marion Jeiter, Württembergische Landesbühne Esslingen, und Andreas Seifert, Theater Heidelberg.
Am Freitag, den 25. November, ab 20:00 Uhr, veranstaltet das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) Heidelberg im Rahmen der Reihe Slow Reading Room eine Nacht zu Ehren von William Shakespeare. Zu Gast sind dann sowohl Shakespeare-Übersetzer und -Experte Frank Günther als auch die Schauspieler Marion Jeiter, Württembergische Landesbühne Esslingen, und Andreas Seifert, Theater Heidelberg.
Auf dem Programm stehen ein Vortrag zur Poesie Shakespeares und die Darstellung von Szenen aus dem Werk des großen Dichters.
 Die Herbstkonzertreihe der Musik- und Singschule Heidelberg bietet auch in diesem Jahr im kleinen Rahmen große Musik. In den einstündigen Konzerten sind hautnahe kammermusikalische Klangerlebnisse garantiert. Renommierte Musiker der Region und Lehrkräfte der Musik- und Singschule Heidelberg gestalten diese Reihe von Freitag, 11. November, bis Sonntag, 13. November 2016, in Solo-, Duo-, und Triobesetzung. Der Bogen wird von der Musik des 16. Jahrhunderts im ersten Konzert bis zur Musik des 20. Jahrhunderts im letzten Konzert gespannt.
Die Herbstkonzertreihe der Musik- und Singschule Heidelberg bietet auch in diesem Jahr im kleinen Rahmen große Musik. In den einstündigen Konzerten sind hautnahe kammermusikalische Klangerlebnisse garantiert. Renommierte Musiker der Region und Lehrkräfte der Musik- und Singschule Heidelberg gestalten diese Reihe von Freitag, 11. November, bis Sonntag, 13. November 2016, in Solo-, Duo-, und Triobesetzung. Der Bogen wird von der Musik des 16. Jahrhunderts im ersten Konzert bis zur Musik des 20. Jahrhunderts im letzten Konzert gespannt.
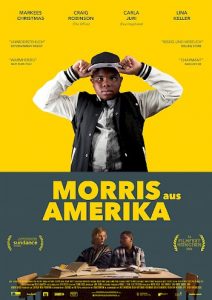 „Heidelberg ist mit seiner pittoresk-niedlichen Altstadt, deren bunten Fassaden, dem über ihr thronenden, putzigen, fast ein wenig ins rosafarbene spielenden Schloss von Amerika aus betrachtet vermutlich eine Art Essenz des alten Europa. Das schaut ein wenig mehr als garnicht übertrieben, fast aufdringlich europäisch aus, zudem ist alles niedlich herausgeputzt und blank poliert, die ebenfalls sehr europäische Tendenz zum Verfall, zum Bröckelnden, Morschen hat in der nordbadischen real-life-Disney-Märchenstadt keine Chance.“
„Heidelberg ist mit seiner pittoresk-niedlichen Altstadt, deren bunten Fassaden, dem über ihr thronenden, putzigen, fast ein wenig ins rosafarbene spielenden Schloss von Amerika aus betrachtet vermutlich eine Art Essenz des alten Europa. Das schaut ein wenig mehr als garnicht übertrieben, fast aufdringlich europäisch aus, zudem ist alles niedlich herausgeputzt und blank poliert, die ebenfalls sehr europäische Tendenz zum Verfall, zum Bröckelnden, Morschen hat in der nordbadischen real-life-Disney-Märchenstadt keine Chance.“
In diese aus einer Innenperspektive vermutlich nur allzu leicht als einengend empfundene Kulisse setzt der Regisseur Chad Hardigan einen schwarzen amerikanischen Jungen: Den 13-jährigen Morris (Markees Christmas) hat es wegen seines Vaters (Craig Robinson, bekannt aus dem amerikanischen „The Office“), der bei einem örtlichen Fußballverein im Trainerstab arbeitet, nach Deutschland verschlagen.
 „Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar – es tut uns leid“: Diese Botschaft bekamen YouTube-Nutzer immer wieder zu sehen, wenn sie sich Musikvideos auf dem Portal anschauen wollten. Damit soll es nun vorbei sein. YouTube und die Rechteverwertungsgesellschaft Gema haben sich nach langem Streit auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Beide Seiten bestätigten die Einigung gestern (am „Allerheiligen“ Dienstagmorgen). Zuerst hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ über den Deal berichtet.
„Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar – es tut uns leid“: Diese Botschaft bekamen YouTube-Nutzer immer wieder zu sehen, wenn sie sich Musikvideos auf dem Portal anschauen wollten. Damit soll es nun vorbei sein. YouTube und die Rechteverwertungsgesellschaft Gema haben sich nach langem Streit auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Beide Seiten bestätigten die Einigung gestern (am „Allerheiligen“ Dienstagmorgen). Zuerst hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ über den Deal berichtet.
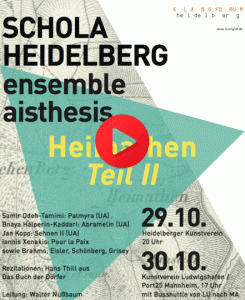 Woran denken wir beim Begriff „Heimathen“? An einen bestimmten Ort? An ein bestimmtes Gefühl? Dieses Wochenende präsentieren die SCHOLA HEIDELBERG und das ensemble aisthesis verschiedene Aspekte von „Heimathen“. Als großer Plural bezeichnet das Wort nicht nur ein altes, reales und kartographiertes Dorf, sondern weit mehr: Ziele, Träume, Ideen und Heime nämlich, Fluchtpunkte in der Zukunft. Wie vielfältig sie durch Sprache und Musik, aber auch durch den Reichtum interkultureller Migration zusammenhängen, wird sich im Konzertverlauf zeigen.
Woran denken wir beim Begriff „Heimathen“? An einen bestimmten Ort? An ein bestimmtes Gefühl? Dieses Wochenende präsentieren die SCHOLA HEIDELBERG und das ensemble aisthesis verschiedene Aspekte von „Heimathen“. Als großer Plural bezeichnet das Wort nicht nur ein altes, reales und kartographiertes Dorf, sondern weit mehr: Ziele, Träume, Ideen und Heime nämlich, Fluchtpunkte in der Zukunft. Wie vielfältig sie durch Sprache und Musik, aber auch durch den Reichtum interkultureller Migration zusammenhängen, wird sich im Konzertverlauf zeigen.
Die drei Komponisten – Samir Odeh-Tamimi aus Palästina (Palmyra), Bnaya Halperin-Kaddari aus Israel (Abramelin) und Jan Kopp aus Baden (Sehnen II), setzen sich mit ihren eigenen und mit vielen Heimathen auseinander: mit all den durch Vertreibung verlorenen oder neu gewählten oder als Zuflucht gefundenen, vielleicht sogar in der Kunst selbst neu geschaffenen.
 Im Oktober präsentieren die SCHOLA HEIDELBERG und das ensemble aisthesis (Bild: Üben von Luigi Nono’s Prometeo: ….“HA-HU“) verschiedene Aspekte von „Heimathen“. Als großer Plural bezeichnet das Wort nicht nur ein altes, reales und kartographiertes Dorf, sondern weit mehr: Ziele, Träume, Ideen und Heime nämlich, Fluchtpunkte in der Zukunft. Wie vielfältig sie durch Sprache und Musik, aber auch durch den Reichtum interkultureller Migration zusammenhängen, wird sich im Konzertverlauf zeigen.
Im Oktober präsentieren die SCHOLA HEIDELBERG und das ensemble aisthesis (Bild: Üben von Luigi Nono’s Prometeo: ….“HA-HU“) verschiedene Aspekte von „Heimathen“. Als großer Plural bezeichnet das Wort nicht nur ein altes, reales und kartographiertes Dorf, sondern weit mehr: Ziele, Träume, Ideen und Heime nämlich, Fluchtpunkte in der Zukunft. Wie vielfältig sie durch Sprache und Musik, aber auch durch den Reichtum interkultureller Migration zusammenhängen, wird sich im Konzertverlauf zeigen.
„Heimathen II“ bildet dabei den Abschluss zu zwei Festivalwochenenden (Juli/Oktober), die 2016 den Themenschwerpunkt des KlangForum Heidelberg bilden.
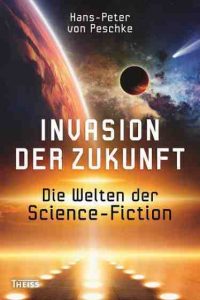 „Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis …“ Schon immer hat es uns Menschen fasziniert, andere Welten zu erschaffen – mit übernatürlichen Fähigkeiten, Außerirdischen, Utopien und Dystopien. So sind die Universen von ›Star Wars‹, ›X-Men‹, ›Dune‹ oder ›Perry Rhodan‹ entstanden und mit ihnen das populäre Genre der Science-Fiction. In seinem neuen Buch »Invasion der Zukunft« stellt Hans-Peter von Peschke diese faszinierenden Welten vor. Sein Buch erschien am 12. September 2016.
„Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis …“ Schon immer hat es uns Menschen fasziniert, andere Welten zu erschaffen – mit übernatürlichen Fähigkeiten, Außerirdischen, Utopien und Dystopien. So sind die Universen von ›Star Wars‹, ›X-Men‹, ›Dune‹ oder ›Perry Rhodan‹ entstanden und mit ihnen das populäre Genre der Science-Fiction. In seinem neuen Buch »Invasion der Zukunft« stellt Hans-Peter von Peschke diese faszinierenden Welten vor. Sein Buch erschien am 12. September 2016.
Gigantische Städte, in denen Raumschiffe herumflitzen und Roboter jeden Wunsch erfüllen, Superhelden mit übernatürlichen Kräften und Zeitreisen in die Vergangenheit oder Zukunft – das alles ist Science-Fiction. Doch zur Science-Fiction gehören auch existenzielle Alpträume von der totalen Kontrolle, der Allmacht der Computer und dem Leben nach dem Atomkrieg. Hans-Peter von Peschke bietet in seinem pointiert geschriebenen Buch »Invasion der Zukunft« einen konkurrenzlos umfassenden Überblick zu allen Themen der Science-Fiction,
 Noam Chomsky ist einer der bekanntesten linken Intellektuellen der USA. Sein neues Buch stellt die titelgebende Frage: „Was für Lebewesen sind wir?“ Die Antworten sind nicht so klar, wie man vermuten würde. Chomsky liest sich wie eine Mischung aus Sisyphos und Karl Marx. Fortschritt sei langsam, aber über lange Zeithorizonte hinweg dramatisch, befand er vor ein einigen Jahren. Der Linguist, politische Aktivist und weltweit vielzitierte Wissenschaftler gilt selbst als lebendes Beispiel für den Siegeszug geistiger Aufklärung.
Noam Chomsky ist einer der bekanntesten linken Intellektuellen der USA. Sein neues Buch stellt die titelgebende Frage: „Was für Lebewesen sind wir?“ Die Antworten sind nicht so klar, wie man vermuten würde. Chomsky liest sich wie eine Mischung aus Sisyphos und Karl Marx. Fortschritt sei langsam, aber über lange Zeithorizonte hinweg dramatisch, befand er vor ein einigen Jahren. Der Linguist, politische Aktivist und weltweit vielzitierte Wissenschaftler gilt selbst als lebendes Beispiel für den Siegeszug geistiger Aufklärung.
 Die 22. Auflage des erfolgreichen Festivals ‚Heidelberger Literaturtage‘ wurde im Juni 2016 realisiert. Das jährliche, jeweils fünftägige Festival im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Heidelberger Literaturtage durchgeführt. Im Gegensatz zu vergleichbaren Festivals verfügten die Heidelberger Literaturtage nicht über eine ganzjährig arbeitende Geschäftsführung, sondern der von Beginn an über Jahrzehnte ehrenamtlich tätige Festivalleiter steuerte die Organisation des Festivals gemeinsam mit wechselnden jungen Koordinatorinnen und Koordinatoren. Das Programm wurde von allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft gemeinsam kuratiert.
Die 22. Auflage des erfolgreichen Festivals ‚Heidelberger Literaturtage‘ wurde im Juni 2016 realisiert. Das jährliche, jeweils fünftägige Festival im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Heidelberger Literaturtage durchgeführt. Im Gegensatz zu vergleichbaren Festivals verfügten die Heidelberger Literaturtage nicht über eine ganzjährig arbeitende Geschäftsführung, sondern der von Beginn an über Jahrzehnte ehrenamtlich tätige Festivalleiter steuerte die Organisation des Festivals gemeinsam mit wechselnden jungen Koordinatorinnen und Koordinatoren. Das Programm wurde von allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft gemeinsam kuratiert.
 Dies mag, das vorweg, kein Manifest sein, geschweige denn das einer wie auch immer verfassten Gruppe; verstanden werden möchte das Folgende als Kurzfassung meiner Überzeugung, die mich hin und wieder fleißger sein läßt, als ich eigentlich sein will. Es werde Schluß gemacht mit dieser es war einmal Schizophrenie – es war einmal eine Art weißer Magie: Journalisten verwandelten die Reputation, die sie mit ihren Texten erworben hatten, in politische Kompetenz. Wo Texte gut waren, waren sie oft aufs Sprachliche fixierte politische Beiträge, oftmals aber ohne kommunikative Oberfläche, manchmal hermetisch. Politische Tendenz meist in Richtung Massen? In Richtung staatstragende Revolution? – In Richtung „veritas“? Das nenne ich: anders schreiben als reden. So etwas funktionierte.
Dies mag, das vorweg, kein Manifest sein, geschweige denn das einer wie auch immer verfassten Gruppe; verstanden werden möchte das Folgende als Kurzfassung meiner Überzeugung, die mich hin und wieder fleißger sein läßt, als ich eigentlich sein will. Es werde Schluß gemacht mit dieser es war einmal Schizophrenie – es war einmal eine Art weißer Magie: Journalisten verwandelten die Reputation, die sie mit ihren Texten erworben hatten, in politische Kompetenz. Wo Texte gut waren, waren sie oft aufs Sprachliche fixierte politische Beiträge, oftmals aber ohne kommunikative Oberfläche, manchmal hermetisch. Politische Tendenz meist in Richtung Massen? In Richtung staatstragende Revolution? – In Richtung „veritas“? Das nenne ich: anders schreiben als reden. So etwas funktionierte.
Allerdings nur solange, wie Journalisten noch an die Menschen- und Gesellschaftsbilder politischer Gruppen andocken konnten. Man stand, ein stets widerständiger Zwerg, auf den Schultern des Zeitgeschehens, schrie Partei- und anderen Funktionären in die Ohren, biß auch schon mal habituell eine einen fütternde Hand, die einen natürlich auch führen wollte. Tatsächlich galt einmal: „Wer nicht Partei ergreifen kann, der hat zu schweigen.“