 Die britische Premierministerin, Margret Thatcher, war schockiert. Sie meinte, das sei doch der Mann, der diese ‚schrecklichen Bilder‘ male. In der Tat: der britische Maler Francis Bacon stieß mit seinen Werken in die Abgründe der menschlichen Seele vor (Foto: Kalle Kuikkaniemi – „Bacon“ von Nanine Linning). Die Beziehungen zugrundeliegender Mechanismen von Begehren, Dominanz und Ausgrenzung stellte er auf eine schonungslos ehrliche Weise dar, die von schmerzhafter Schönheit zeugt.
Die britische Premierministerin, Margret Thatcher, war schockiert. Sie meinte, das sei doch der Mann, der diese ‚schrecklichen Bilder‘ male. In der Tat: der britische Maler Francis Bacon stieß mit seinen Werken in die Abgründe der menschlichen Seele vor (Foto: Kalle Kuikkaniemi – „Bacon“ von Nanine Linning). Die Beziehungen zugrundeliegender Mechanismen von Begehren, Dominanz und Ausgrenzung stellte er auf eine schonungslos ehrliche Weise dar, die von schmerzhafter Schönheit zeugt.

Guy Stern ist im Jahr 2017 95 Jahre alt. Wenige Tage nach dem d-day vor 73 Jahren fanden es „Die Richie Boys“ noch beinahe lustig, mit einer erbeuteten Fahne des verhassten Hitler-Regimes, das sie in die Emigration trieb, vor der Kamera zu posieren, wir hoffen dies Bild wird nicht indiziert.
Sie hießen Werner Angress, Fritz Ehrlich, Günther Stern, Si Lewen, Klaus Mann, Hans Habe, Stefan Heym oder Georg Kreisler. Blutjung, oftmals noch nicht einmal zwanzig Jahre alt, flohen sie vor den Nazis in die USA und fanden dort eine neue Heimat. Obschon sie – wie alle Flüchtlinge nach dem Kriegseintritt Amerikas 1941 – als „Enemy Aliens“, als feindliche Ausländer galten, hatte das Pentagon das Potential der jungen Exil-Elite rasch erkannt. Was sie einte, war der Haß auf Hitler. „Ich wollte den Faschismus bekämpfen, Hitler musste besiegt werden“, erinnert sich Günther Stern. Niemand kannte den Feind, seine psychologische Befindlichkeit und Sprache besser als die deutschen und österreichischen Exilanten, unter denen sich viele Juden befanden.
In den Bergen Marylands wurden sie in Camp Ritchie, einer Schule für Propaganda, Aufklärung und psychologische Kriegsführung, ausgebildet. In amerikanischer Uniform kehrten sie nach dem D-Day im Juni 1944 schließlich nach Europa zurück.
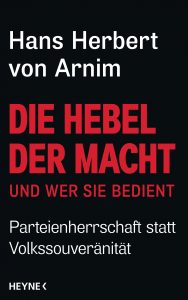 Wenn immer mehr Menschen glauben, Politik werde über ihre Köpfe hinweg gemacht und sei ihrem Einfluss entzogen – ist das ein populistischer Trugschluss? Oder ist der Eindruck der Bürger, sie seien entmachtet, womöglich zutreffend?
Wenn immer mehr Menschen glauben, Politik werde über ihre Köpfe hinweg gemacht und sei ihrem Einfluss entzogen – ist das ein populistischer Trugschluss? Oder ist der Eindruck der Bürger, sie seien entmachtet, womöglich zutreffend?
Soviel Sprengstoff diese Fragen bergen, so analytisch-nüchtern geht der Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim in seiner Systemdiagnose vor. Er belegt: Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt.
Arnim deckt auf, welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten!
 Eines Morgens fühlt der alte Fischer Johannes die Schwäche seines Körpers nicht mehr; er begegnet seiner verstorbenen Frau, seinem toten Freund, geht unsichtbar an seiner Tochter vorüber.
Eines Morgens fühlt der alte Fischer Johannes die Schwäche seines Körpers nicht mehr; er begegnet seiner verstorbenen Frau, seinem toten Freund, geht unsichtbar an seiner Tochter vorüber.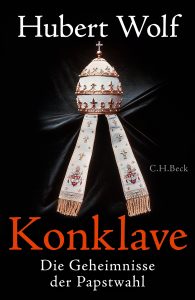 Hubert Wolf erzählt, was hinter den verschlossenen Toren des Vatikan vor sich geht. Er erläutert, wie die Regeln und Rituale entstanden sind, und macht deutlich, welche Traditionsbrüche, gerade auch in jüngster Zeit, sich hinter der Fassade der uralten heiligen Handlung verbergen.
Hubert Wolf erzählt, was hinter den verschlossenen Toren des Vatikan vor sich geht. Er erläutert, wie die Regeln und Rituale entstanden sind, und macht deutlich, welche Traditionsbrüche, gerade auch in jüngster Zeit, sich hinter der Fassade der uralten heiligen Handlung verbergen.
Keine andere Wahl wird weltweit von so großer Anteilnahme begleitet wie die Wahl des Papstes. Doch die Zuschauer sehen immer nur die Außenseite: den Einzug der Kardinäle ins Konklave, den Schornstein der Sixtinischen Kapelle, aus dem schwarzer oder endlich weißer Rauch aufsteigt, die Präsentation des Gewählten mit den Worten „Habemus papam“. Dieses Buch erklärt, was wirklich passiert: wie die Wahl im Detail abläuft, von welchem Moment an der Gewählte Papst ist, warum das Konklave erfunden wurde und wie die Kardinäle zu den einzigen Wählern und schließlich auch zu den einzig Wählbaren wurden. Zur Sprache kommt auch der Papstrücktritt, der zur Regel werden und die Aura des Amtes beschädigen könnte.
Das bedeutende Festival für zeitgenössische Dramatik und neue Autoren findet in diesem Jahr vom 28. April – 07. Mai 2017 am Theater und Orchester Heidelberg statt. Gespielt, gelesen, diskutiert und gefeiert wird in den Zwinger-Spielstätten, im Alten- und Marguerre-Saal, im Sprechzimmer (Friedrich5) sowie in den Theaterfoyers.
Andreas Gurskys (*1955) intensives Nachtpanorama „Heidelberg Ost“ zeugt von dieser Faszination. Wie Achim von Arnim und Clemens Brentano in „Des Knaben Wunderhorn“ lässt auch er den nächtlichen Sternenhimmel nach eigenen Vorstellungen glänzen. Selbstbewusst stellt er damit sein Werk an die Seite der romantischen Naturauffassung.
In den Campus-Bildern des Schweizer Künstlers Beat Streuli (*1957) wird Kunst als „Spiegel des menschlichen Geistes“ (Christopher Marlowe) sichtbar. Die mittels eines Teleobjektivs aufgenommenen Porträts halten den unverstellten Gesichtsausdruck junger Studenten aus New York und Marseille im beiläufigen Strom der Massen fest.
 Der mit 10.000 Euro dotierte Clemens Brentano Preis für Literatur der Stadt Heidelberg geht an Jan Snela. Er erhält den Preis für seinen Erzählband „Milchgesicht. Ein Bestiarium der Liebe“ (Klett-Cotta Verlag, 2016).
Der mit 10.000 Euro dotierte Clemens Brentano Preis für Literatur der Stadt Heidelberg geht an Jan Snela. Er erhält den Preis für seinen Erzählband „Milchgesicht. Ein Bestiarium der Liebe“ (Klett-Cotta Verlag, 2016).
Jan Snela, geboren 1980 in München, studierte Komparatistik, Slawistik und Rhetorik in München und Tübingen, wo er auch heute noch lebt. Seine Texte erschienen in zahlreichen Anthologien und Literaturzeitschriften und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem gewann er den Open-Mike-Wettbewerb für junge Literatur. „Milchgesicht“ ist sein Debüt.



