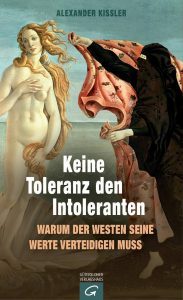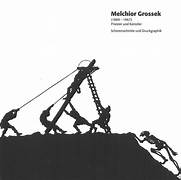 Zumindest scheint es den starken Drang zum Wandel in sich zu tragen – vor allem aber verwandeln sich die Menschen. Je nach Blickwinkel in Gesichtslose, Untertanen, Denunzianten, oder in Wutbürger, Rechte, Querulanten. Dem Ausmaß an naiver Gutgläubigkeit und Folgsamkeit der einen Seite steht das entsprechende Ausmaß an Resignation und stereotyper Ablehnung der anderen Seite gegenüber.
Zumindest scheint es den starken Drang zum Wandel in sich zu tragen – vor allem aber verwandeln sich die Menschen. Je nach Blickwinkel in Gesichtslose, Untertanen, Denunzianten, oder in Wutbürger, Rechte, Querulanten. Dem Ausmaß an naiver Gutgläubigkeit und Folgsamkeit der einen Seite steht das entsprechende Ausmaß an Resignation und stereotyper Ablehnung der anderen Seite gegenüber.
Zumindest ist das die scherenschnittartige Sichtweise einer Frontbildung, die mitten durch die Gesellschaft verläuft und beiden Seiten als Feindbild dient.

Der Kunst-Parcours „Folkwang und die Stadt“ (Bild: Faksimile von Rodins „Das Eherne Zeitalter“ in dem Werk „The Educational Complex or The Awakening Man?“) findet sein Zentrum ausgerechnet auf einer Insel. Um dieses von Abgas und Lärm umtoste grüne Eiland erreichbar zu machen, spendete die Stadt Essen sogar eine Fußgängerampel.
Jetzt ist aus dem Nicht-Ort, der Verkehrsinsel auf dem Pariser Platz in der Essener City ein Kunst-Ort geworden. Wer sich aus dem Auge des Kreisverkehrs umsieht, erblickt in der umgebenden imposanten Architektur Vertreter zentraler Institutionen und Interessen der Stadtgesellschaft.
Unterhaltung als Multiplexkino, das Logo der Jobagentur, ein Theater, eine Shopping-Mall für den Konsum und die Zentrale der Funke-Mediengruppe.
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allem ihn trennt.
Hermann Hesse

Kein „Lerchenlied“ – aber wunderschön von Johann Sebastian Bach in der Originalhandschrift. Spielen sie das mal auf dem Klavier …
Naja: Nur einmal bringt des Jahres Lauf, uns Herbst und Lerchenlieder. Nur einmal blüht die Rose auf, und dann verwelkt sie wieder; nur einmal gönnt uns das Geschick, so jung zu sein auf Erden: Hast du versäumt den Augenblick, jung wirst du nie mehr werden. Drum lass von der gemachten Pein, um nie gefühlte Wunden! Der Augenblick ist immer dein, doch rasch entfliehn die Stunden. Und wer als Greis im grauen Haar, vom Schmerz noch nicht genesen, der ist als Jüngling auch fürwahr, nie jung und frisch gewesen. Nur einmal blüht die Jugendzeit, und ist so bald entschwunden; und, wer nur lebt vergangnem Leid, wird nimmermehr gesunden.
(Richard von Wilpert 1862-1918)
Schweinefleisch verschwindet aus Schulbüchern, die Moschee von der Seifenpackung – die Selbstzensur des Westens treibt absurde Blüten. Zwar werden Presse- und Meinungsfreiheit beschworen, aber Terror wirkt:
Nach Anschlägen wird hier und da gefordert, man müsse Blasphemie stärker unter Strafe stellen … Muss man wirklich?
Müssen wir Verständnis dafür haben, dass „besonders Fromme“ besonders reizbar sind? Wollen wir die Freiheit opfern für die Illusion, dadurch die Freiheitsfeinde zu besänftigen?
Alexander Kisslers Buch ist ein entschiedener Aufruf, die Meinungs- und Religionsfreiheit selbstbewusst zu stärken; dennoch gehört Kissler keineswegs zu den Eiferern, hingegen will er für bestimmte Absurditäten im Toleranzdiskurs sensibilisieren:
Falsch verstandene Toleranz ist leicht erkennbar, etwa, wenn Kissler von drei jungen Palästinensern berichtet, denen ein Gericht nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge explizit keinen Antisemitismus anlasten wollte.
 Der Filmd“ taucht Nan Goldins Kampf gegen den Pharmakonzern der Sacklers in ein goldenes Licht, das an das gegenkulturelle New York der 1970er und 1980er erinnern soll. Doch die Instant-Nostalgie des Films kann nicht verschleiern, dass Goldin und Poitras weniger an politischen Auswegen aus der Opioid-Krise interessiert sind als an einer glamourösen Inszenierung von Kapitalismuskritik. Manchmal sind es vermeintliche Kleinigkeiten, die einen im Kino auf die Palme bringen. (mehr …)
Der Filmd“ taucht Nan Goldins Kampf gegen den Pharmakonzern der Sacklers in ein goldenes Licht, das an das gegenkulturelle New York der 1970er und 1980er erinnern soll. Doch die Instant-Nostalgie des Films kann nicht verschleiern, dass Goldin und Poitras weniger an politischen Auswegen aus der Opioid-Krise interessiert sind als an einer glamourösen Inszenierung von Kapitalismuskritik. Manchmal sind es vermeintliche Kleinigkeiten, die einen im Kino auf die Palme bringen. (mehr …)
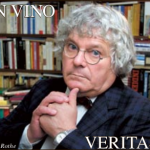
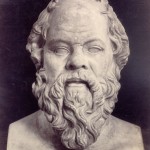 Derweil er dem Bildungsbürger – ungemach schnell – zum Outsider geworden war, schien er den Kleinbürgern alsbald ein Bourgeois zu sein – wobei er sich keines der ihm offenen Wege bediente: Er hätte schnell zugrunde gehen können, hätte ihn die materialistisch-bürgerliche Gesellschaft als unbrauchbares Glied einfach absterben lassen. Auch zum Clown und Unikum der Heidelberger Gesellschaft hätte er werden können, erlaubte die sich den Luxus solcher Existenz in ihrem Schoß. Sie tat es, auch wenn sie über ihn oft genug meinte, den Kopf schütteln zu müssen:
Derweil er dem Bildungsbürger – ungemach schnell – zum Outsider geworden war, schien er den Kleinbürgern alsbald ein Bourgeois zu sein – wobei er sich keines der ihm offenen Wege bediente: Er hätte schnell zugrunde gehen können, hätte ihn die materialistisch-bürgerliche Gesellschaft als unbrauchbares Glied einfach absterben lassen. Auch zum Clown und Unikum der Heidelberger Gesellschaft hätte er werden können, erlaubte die sich den Luxus solcher Existenz in ihrem Schoß. Sie tat es, auch wenn sie über ihn oft genug meinte, den Kopf schütteln zu müssen:
 Jede dritte Kirche, Gemeinde- und Pfarrimmobilie wird bald überflüssig sein. Das sind 40.000 Immobilien. Was geschieht dann mit den Gotteshäusern? Beispiele für kreative Umnutzungen – wenn der Denkmalschutz mitspielt. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, folglich werden sie immer leerer. Ist eine Gemeinde zu stark geschrumpft, wird sie mitunter mit einer Nachbargemeinde zusammengelegt. Die Kirche im eigenen Ort bleibt dann ungenutzt und wird irgendwann profaniert, also entweiht. Damit wird sie für nichtreligiöse Zwecke freigegeben. Mehr als 1000 Kirchengebäude sollen die Evangelische und Katholische Kirche in den vergangenen 30 Jahren aufgegeben haben.
Jede dritte Kirche, Gemeinde- und Pfarrimmobilie wird bald überflüssig sein. Das sind 40.000 Immobilien. Was geschieht dann mit den Gotteshäusern? Beispiele für kreative Umnutzungen – wenn der Denkmalschutz mitspielt. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, folglich werden sie immer leerer. Ist eine Gemeinde zu stark geschrumpft, wird sie mitunter mit einer Nachbargemeinde zusammengelegt. Die Kirche im eigenen Ort bleibt dann ungenutzt und wird irgendwann profaniert, also entweiht. Damit wird sie für nichtreligiöse Zwecke freigegeben. Mehr als 1000 Kirchengebäude sollen die Evangelische und Katholische Kirche in den vergangenen 30 Jahren aufgegeben haben.

Während „die Kirche“ den Providenzgarten bebauen möchte, wollen die Anwohner den Freiraum erhalten.
Foto: Philipp Rothe, 12.07.2019
Stadt und Evangelische Kirche in Heidelberg sind sich (waren sie jedenfalls „im Jahr des Herrn 2019)“ noch einig über die Nutzung des „Providenzgartens“ : Die Freifläche hinter der Providenzkirche in der Altstadt bleibt erhalten und steht den Bürgern künftig als öffentlich nutzbare Grünfläche zur Verfügung. Die Stadtverwaltung und die Evangelische Kirche in Heidelberg konnten nach konstruktiven Verhandlungen eine grundsätzliche Einigung über die Nutzung als Bürgerpark erzielen. Das Erbbaurechtsgrundstück soll eine Fläche von circa 1.200 Quadratmetern aufweisen. Die Gestaltung der Gartenfläche wird dabei eng mit den Planungen der Kirche über die Außenflächen ihres neuen Gemeindezentrums abgestimmt
In diesem Mai feiert das Berliner Theatertreffen seinen 60. Geburtstag, und dafür macht es ganz schön auf jung. Nicht nur, dass die Berliner Festspiele mit Matthias Pees einen neuen Intendanten haben. Sondern das Theatertreffen wird nun von drei Leiterinnen organisiert, Olena Apchel, Carolin Hochleitner und Joanna Nuckowska. Dazu kommen umfängliche neue Zusatzprogramme.
Im Kern aber bleibt es bei den zehn bemerkenswerten Inszenierungen, auf die man sich doch Jahr für Jahr wieder freut. Die Festspiele wollen nach eigenem Bekunden am Auswahlgremium der Kritikerinnen und Kritiker festhalten, die entscheiden, wer eigeladen wird zur Leistungsschau der deutschsprachigen Bühnen. Doch vieles deutet auf Veränderung hin.
Das Treffen in Berlin
Das Theatertreffen findet in diesem Jahr vom 12. bis 29. Mai statt. Hauptspielort ist das Haus der Berliner Festspiele. Zehn Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum, darunter zwei aus Berlin, bilden das Hauptprogramm. Info: www.berlinerfestspiele.de
Allgemein ist das Verhältnis von Theaterkünstlern und Kritik schwieriger geworden. Die Attacke eines durchgeknallten Choreographen auf eine oft überhart einsteigende Kritikerin stieß international auf große Resonanz. Viele waren entsetzt, andere im Stillen amüsiert, aber im Grunde lenkte die Dackelkacke nur ab von nivellierenden Tendenzen hier wie dort und den tieferen Verwerfungen.
Nur keine Ironie!
Claus Peymann hat auch immer schon behauptet, Kritik sei unwichtig und würde von Theaterleuten nicht gelesen. Er wusste es besser. Einst haben Kritiker seine Karriere und die so vieler anderer damals sehr befördert, man schätzte und brauchte einander im alten Machtsystem. Der Umgang hatte etwas Sportlich-Ironisches. Aber Ironie scheint verschwunden, verlangt wird eindeutige Positionierung.
Kritik an der Kritik hört man jetzt häufiger. Vor einem Jahr haben Amelie Deuflhard, Chefin von Kampnagel in Hamburg, und der Berliner Kurator Matthias Lilienthal in einem Beitrag für die Berliner Festspiele Theaterkritik grundsätzlich relativiert. Lilienthal nimmt Kritik wahr „als ein Anschreiben gegen den Verfall und die Gewissheit, dass es so etwas wie Printmedien in fünf bis zehn Jahren praktisch nicht mehr geben wird.“ Gleichzeitig werde dem Kulturjournalismus noch der Wert zugeschrieben, den er vor einem Jahrhundert hatte. Deuflhard verweist auf die Sozialen Medien, mit denen die klassische Kritik zwar nicht hinfällig, aber längst nicht mehr so wichtig sei.
Nur nicht altmodisch wirken
Man könnte hinzufügen, dass die Theater- und Kulturberichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien stark zurückgegangen ist und es Nachwuchsprobleme gibt. Viele Medien wollen Service bieten und lieber keine Verrisse.
Deuflhard und Lilienthal haben recht – wenn man in ihrem Text „Kritik“ einmal durch „Theater“ ersetzt. Keine Frage, Printmedien verändern sich und nehmen ab zugunsten digitaler Formen; aber dort gibt es auch seriöse und professionelle Kritik. Theater war einmal die Königsdisziplin des Feuilletons. Lange her: Aber das liegt auch am Theater selbst. Es hat schreckliche Angst, altmodisch zu wirken. Es nimmt nicht mehr die selbstverständliche gesellschaftliche Stellung ein wie zu der Zeit, als das Theatertreffen blühte, in den siebziger, achtziger Jahren. Seine neuen Texte besitzen kaum mehr Sprengkraft oder wenigstens, wie Stuckrad-Barres Medienroman, das Potenzial für ein ordentliches Strohfeuer.
Theater ist die moralische Anstalt des 21. Jahrhunderts. Über ästhetische Fragen wird nicht gern debattiert, obwohl in Gesprächen mit Zuschauern und auch Theaterleuten ein tiefes Bedürfnis nach künstlerischen Fragen zu spüren ist. Im Theater arbeiten vielerorts die Guten mit der richtigen Botschaft, und Kritik steckt häufig in dem Dilemma, Gesinnung beurteilen zu sollen, und da gerät man schnell auf die falschen Seite, wenn man den missionarischen Eifer nicht teilt: Was die jüngere Kritikergeneration auch schon meist mit Überzeugung tut.
Und womöglich steht der Mediendarwinismus erst am Anfang. das Theater kümmert sich um alle möglichen gesellschaftlichen Themen, aber der eigene Spielplatz ist kleiner geworden. Theater und Kritik, ein altes Paar, misstrauen einander, weil sie den Mangel und den Verlust spüren. Kritik kann à la longue doch auch nur so gut sein wie ihr Gegenüber.