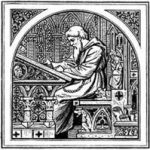
 Medienrealität bietet Forschern, Medien-Beobachtern und Medienkritikern eine Diskussionsplattform. In diesem Beitrag fragen wir, was vom Trubel um den „konstruktiven Journalismus“ geblieben ist – und bleiben könnte. Sollte „Konstruktiver Journalismus“ – 2015 der Branchen-Hype – einen Weg zu globaler Gerechtigkeit weisen können? In allen großen deutschen Redaktionen wurde das neue Buch des dänischen TV-Journalisten Ulrik Haagerup zum Thema gelesen (Haagerup 2015), und von Spiegel Online bis ZDF heute versuchten sich viele an dem neuen Berichterstattungsmuster, das positive Emotionen beim Publikum hervorrufen soll:
Medienrealität bietet Forschern, Medien-Beobachtern und Medienkritikern eine Diskussionsplattform. In diesem Beitrag fragen wir, was vom Trubel um den „konstruktiven Journalismus“ geblieben ist – und bleiben könnte. Sollte „Konstruktiver Journalismus“ – 2015 der Branchen-Hype – einen Weg zu globaler Gerechtigkeit weisen können? In allen großen deutschen Redaktionen wurde das neue Buch des dänischen TV-Journalisten Ulrik Haagerup zum Thema gelesen (Haagerup 2015), und von Spiegel Online bis ZDF heute versuchten sich viele an dem neuen Berichterstattungsmuster, das positive Emotionen beim Publikum hervorrufen soll:
Robert Miessner nimmt die deutsche Veröffentlichung von Simon Reynolds‚ dicker Abhandlung über den Glam-Rock freudig zum Anlass, um in der taz selbst ausführlich über das Genre zu schreiben: „Zu Glam gehört, erst nachgeordnet über den knalligen rockistischen Sound zu sprechen. Er hatte in der Struktur mit den Exerzitien von Progrockern und Späthippies wenig gemein. Seine Technik war durchaus modern, doch nicht modernistisch, wie Reynolds luzide ausführt: ‚Glam und Glitter führten zurück zu den simpleren musikalischen Strukturen von Rock ’n‘ Roll in den 1950ern und der 1960er-Beatgruppen vor dem Aufkommen von Psychedelic-Rock, die aber durch die Aufnahmetechnik der späten 1960er und frühen 1970er auf den neuesten Stand gebracht worden waren.'“
Weiteres: Für die Berliner Zeitung unterhält sich Anne Lena Mösken mit Dhani Harrison, der als Sohn von Beatle George Harrison jetzt sein Debütalbum aufgenommen hat. Thomas Schacher spricht in der NZZ mit der Sopranistin Regula Mühlemann über das Geheimnis ihres Erfolgs. Ueli Bernays bilanziert in der NZZ das Jazzfestival Unerhört in Zürich. Arne Hartwig porträtiert in der Jungle World den israelischen Musiker Gili Yalo.
Besprochen werden das neue Morissey-Album (Freitag), ein Auftritt von DAF (Standard), Neil Youngs neues Album „The Visitor“ (FR), Hannes Waders Berliner Abschiedskonzert (FR) und ein Auftrit der Fleet Foxes (FAZ).
Und Pitchfork kürt seine Lieblingsvideos 2017 – auf der Spitzenposition: Björk.
Erleben Sie Björk – „The Gate“ – das Lieblingsvideo der Rundschau-Redaktion 2017
auf Youtube
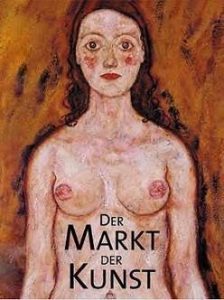 Das „Superkunstjahr“ 2017 verlief anders, als viele es vorab erwartet haben dürften. Zwar gab es – eher auf den Märkten als bei Besucherzahlen – ein paar der Rekorde, die das Präfix ’super-‚ rechtfertigen, aber zumindest ebenso sehr kam es zu Unruhe und zu Enttäuschungen. Vor allem jedoch zeichnen sich neue Fronten innerhalb des Kunstbetriebs, aber auch neue Verhältnisse zwischen der Kunst und anderen Feldern der Gesellschaft ab. Das scheint mir so brisant zu sein, dass ich hier – der Titel deutet es bereits an – die These in den Raum stellen werde, dass gerade der Kunstmarkt infolge jener Verschiebungen im Kunstbetrieb einen Rollenwechsel erfährt und dabei an Bedeutung, aber vielleicht sogar auch an Sympathie gewinnt.
Das „Superkunstjahr“ 2017 verlief anders, als viele es vorab erwartet haben dürften. Zwar gab es – eher auf den Märkten als bei Besucherzahlen – ein paar der Rekorde, die das Präfix ’super-‚ rechtfertigen, aber zumindest ebenso sehr kam es zu Unruhe und zu Enttäuschungen. Vor allem jedoch zeichnen sich neue Fronten innerhalb des Kunstbetriebs, aber auch neue Verhältnisse zwischen der Kunst und anderen Feldern der Gesellschaft ab. Das scheint mir so brisant zu sein, dass ich hier – der Titel deutet es bereits an – die These in den Raum stellen werde, dass gerade der Kunstmarkt infolge jener Verschiebungen im Kunstbetrieb einen Rollenwechsel erfährt und dabei an Bedeutung, aber vielleicht sogar auch an Sympathie gewinnt.
 Rechtsradikale grölen antisemitische Parolen und im Bundestag sitzen wieder Rechtspopulisten, während die Holocaust-Zeitzeugen immer weniger werden. Das hat Folgen für das deutsche und europäische Selbstverständnis. Auschwitz gehört zur Weltsicht des Hasses von Rechten gegenüber Andersdenkenden, Fremden und Flüchtlingen.
Rechtsradikale grölen antisemitische Parolen und im Bundestag sitzen wieder Rechtspopulisten, während die Holocaust-Zeitzeugen immer weniger werden. Das hat Folgen für das deutsche und europäische Selbstverständnis. Auschwitz gehört zur Weltsicht des Hasses von Rechten gegenüber Andersdenkenden, Fremden und Flüchtlingen.
 Die Stimmungslage im deutschen Herbst 2017, mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall, wenige Tage vor der Bundestagswahl, hat viele Verursacher. Es sind die Jobverlagerer, die ihre eigene Haut retten, die Regierung, der es an handwerklicher Sorgfalt beim Formulieren der Gesetzestexte gebrach, auch die Krisenverschärfer, in deren Augen Deutschland bereits Schauplatz einer gewaltigen Gerechtigkeitskatastrophe geworden ist, das Opfer der kapitalistischen Entzivilisierung.
Die Stimmungslage im deutschen Herbst 2017, mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall, wenige Tage vor der Bundestagswahl, hat viele Verursacher. Es sind die Jobverlagerer, die ihre eigene Haut retten, die Regierung, der es an handwerklicher Sorgfalt beim Formulieren der Gesetzestexte gebrach, auch die Krisenverschärfer, in deren Augen Deutschland bereits Schauplatz einer gewaltigen Gerechtigkeitskatastrophe geworden ist, das Opfer der kapitalistischen Entzivilisierung.
(mehr …)
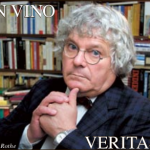 Nehmen wir doch einfach den Dingen, vor denen wir uns fürchten, die Maske ab, gehen wir (es lebe die veritanische Akademie) dem Tod, vor dem wir uns nicht zu fürchten haben, entgegen. Nähern wir uns ihm allein in der Sokrates zugesprochenen unkünstlichen Kühnheit. Nehmen wir dem Tod das „Metaphysische“, denken wir nicht an Hölle, nicht an Teufel, die Erbsünde oder das Paradies. Nehmen wir den Tod als diesseitiges, als irdisches Geschenhen, als Geschenk! Verzichten wir dabei getrost auf alle antiken oder vulgärbiologischen Tröstungen einer „Rückkehr in die Natur“. Das menschliche Leben – dieses menschliche Leben, hört auf.
Nehmen wir doch einfach den Dingen, vor denen wir uns fürchten, die Maske ab, gehen wir (es lebe die veritanische Akademie) dem Tod, vor dem wir uns nicht zu fürchten haben, entgegen. Nähern wir uns ihm allein in der Sokrates zugesprochenen unkünstlichen Kühnheit. Nehmen wir dem Tod das „Metaphysische“, denken wir nicht an Hölle, nicht an Teufel, die Erbsünde oder das Paradies. Nehmen wir den Tod als diesseitiges, als irdisches Geschenhen, als Geschenk! Verzichten wir dabei getrost auf alle antiken oder vulgärbiologischen Tröstungen einer „Rückkehr in die Natur“. Das menschliche Leben – dieses menschliche Leben, hört auf.
Der Tod ist schrecklich, ein Werk des Bösen: so, sagt man, und so dachten die Menschen des Mittelalters – was (unter anderem) die Maßlossigkeit erklärt, die Wildheit ihrer Liebe zum Leben: irdische Jenseitsvorstellungen komplementieren ein irdisches Leben.
 An Ermunterung und anteilnehmendem Interesse durch den damaligen Vorzeige-Herrscher der Aufklärung Friedrich den Großen an Voltaires Stück, das von einem Kameltreiber handelt, der vorgeblich Kontakt zu einem Erzengel hatte und sich fortan Prophet nannte, fehlte es wahrlich nicht: Für den Westen geht es seit geraumer Zeit ans Eingemachte. Dass der Chefredakteur von „France Soir“ entlassen wurde, weil er Kritik am muslimischen Religionsstifter zu üben wagte, genauer: weil er Dokumente dieser Kritik zur Veröffentlichung freigab -, das (und vieles Andere auch) wird von westlichen Journalisten mit Sorge gesehen und, zumal von dessen Kollegen zu Recht als ein Schlag ins Gesicht der französischen Identität betrachtet.
An Ermunterung und anteilnehmendem Interesse durch den damaligen Vorzeige-Herrscher der Aufklärung Friedrich den Großen an Voltaires Stück, das von einem Kameltreiber handelt, der vorgeblich Kontakt zu einem Erzengel hatte und sich fortan Prophet nannte, fehlte es wahrlich nicht: Für den Westen geht es seit geraumer Zeit ans Eingemachte. Dass der Chefredakteur von „France Soir“ entlassen wurde, weil er Kritik am muslimischen Religionsstifter zu üben wagte, genauer: weil er Dokumente dieser Kritik zur Veröffentlichung freigab -, das (und vieles Andere auch) wird von westlichen Journalisten mit Sorge gesehen und, zumal von dessen Kollegen zu Recht als ein Schlag ins Gesicht der französischen Identität betrachtet.
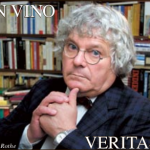 Gleichermaßen aber unausrottbar wie die Lüge ist auch das Verlangen nach Wahrheit. Bei allen unzähligen Versuchen, Kontrollmöglichkeiten für sowohl die Verlässlichkeit von Aussagen, Erklärungen, Ehrenworten oder Schwüren zu entwickeln, stehen Publikum und Richter immer noch dort, wo auch die Geschichte des Betrugs begann: vor dem Fiasko, dem Zusammenbruch. Dies zu ändern, müsste man schon die Schöpfung verklagen, was immerhin ein kleiner Gott aus dem dritten oder vierten Glied jener Unsterblichen im Mythos der Antike bereits wagte:
Gleichermaßen aber unausrottbar wie die Lüge ist auch das Verlangen nach Wahrheit. Bei allen unzähligen Versuchen, Kontrollmöglichkeiten für sowohl die Verlässlichkeit von Aussagen, Erklärungen, Ehrenworten oder Schwüren zu entwickeln, stehen Publikum und Richter immer noch dort, wo auch die Geschichte des Betrugs begann: vor dem Fiasko, dem Zusammenbruch. Dies zu ändern, müsste man schon die Schöpfung verklagen, was immerhin ein kleiner Gott aus dem dritten oder vierten Glied jener Unsterblichen im Mythos der Antike bereits wagte:

