 Wo sind wir? Im Paradies? In der Hölle? Irgendwo dazwischen? Näher am (Bild: Hieronymus Bosch): „Heuwagen und“ an der „Hölle“? Und, wie war unser Befinden vor der Pandemie? Paradiesisch? Infernalisch? Oder beides zugleich, «als ob Hochzeits- und Beerdigungsglocken sich vermischt hätten» (Robert Schumann)? Und wen umfasst dieses «wir»? Existiert es überhaupt noch? Kann es eine Gemeinschaft geben, die diese Bezeichnung verdient, wenn schon die zarteste Geste von Fürsorge, das Tragen einer Maske zum Schutz der Mitmenschen, für Spaltung sorgt?
Wo sind wir? Im Paradies? In der Hölle? Irgendwo dazwischen? Näher am (Bild: Hieronymus Bosch): „Heuwagen und“ an der „Hölle“? Und, wie war unser Befinden vor der Pandemie? Paradiesisch? Infernalisch? Oder beides zugleich, «als ob Hochzeits- und Beerdigungsglocken sich vermischt hätten» (Robert Schumann)? Und wen umfasst dieses «wir»? Existiert es überhaupt noch? Kann es eine Gemeinschaft geben, die diese Bezeichnung verdient, wenn schon die zarteste Geste von Fürsorge, das Tragen einer Maske zum Schutz der Mitmenschen, für Spaltung sorgt?
ψ
Wie nachhaltig sind die zaghaften Blüten der Solidarität, über die wir uns im ersten Lockdown noch gefreut haben, in einer Gesellschaft, die aus der Summe ihrer Einsamkeiten besteht?
ψ

Von Deutschen „zur Erfassung“ zusammengetriebene Juden auf dem Tarnówer Marktplatz im Juni 1942.
Bild: Belarussisches Nationalarchiv
Eine Ausstellung in der Stiftung Topographie des Terrors zeigt „rassenkundliche“ Fotografien jüdischer Familien aus einer polnischen Kleinstadt. Im Mittelpunkt stehen die Opfer und ihr Schicksal: Im März 1942 reisen die jungen Anthropologinnen Elfriede Fliethmann und Dora Maria Kahlich in die südpolnische Kleinstadt Tarnów. Fliethmann kommt aus Krakau, wo sie am Institut für Deutsche Ostarbeit mit der Erfassung von Rassemerkmalen bei Juden und Polen beschäftigt ist. Kahlich hat sich in Wien als Zuarbeiterin der Reichsstelle für Sippenforschung und Gutachterin in Abstammungsfragen einen Namen gemacht. In Tarnów, wo seit der deutschen Besetzung Polens dreißigtausend Juden, darunter viele Flüchtlinge aus Krakau, auf engem Raum leben müssen, wollen die beiden Frauen eine „rassenkundliche“ Studie an jüdischen Familien durchführen.
 Wo man den unerhört umtriebigen Autor, Filme- und Hörspielmacher, Medienkünstler und Juristen Alexander Kluge überhaupt orten kann – wer das schon immer wissen wollte – der bekommt in seinem jüngsten Hörspiel „Das neue Alphabet“ die ersehnte Antwort: „Ich sitze unterm Tisch, während die Erwachsenen reden. Das ist meine Lebensposition.“ (mehr …)
Wo man den unerhört umtriebigen Autor, Filme- und Hörspielmacher, Medienkünstler und Juristen Alexander Kluge überhaupt orten kann – wer das schon immer wissen wollte – der bekommt in seinem jüngsten Hörspiel „Das neue Alphabet“ die ersehnte Antwort: „Ich sitze unterm Tisch, während die Erwachsenen reden. Das ist meine Lebensposition.“ (mehr …)
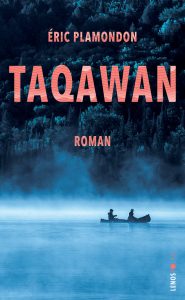 Taqawan“ ist nicht eigentlich ein Roman und die kriminalistischen Elemente sind absolut zweitrangig. Der Frankokanadier Eric Plamondon erzählt von einem historischen Unrecht, und er tut dies mit allen Mitteln der Poesie. Es geht um den großen Lachskrieg von 1981, als sich die kanadischen Ureinwohner gegen das Verbot stemmten, in den Flüssen mit Netzen Lachs zu fangen. Die Mi’gmaq sind eine der großen indianischen Nationen in Kanada, sie leben zurückgedrängt auf der Gaspésie-Halbinsel von Québec, der Fluss Restigouche bildet die Grenze ihres Reservats, aber auch zugleich ihre Ernährungsgrundlage.
Taqawan“ ist nicht eigentlich ein Roman und die kriminalistischen Elemente sind absolut zweitrangig. Der Frankokanadier Eric Plamondon erzählt von einem historischen Unrecht, und er tut dies mit allen Mitteln der Poesie. Es geht um den großen Lachskrieg von 1981, als sich die kanadischen Ureinwohner gegen das Verbot stemmten, in den Flüssen mit Netzen Lachs zu fangen. Die Mi’gmaq sind eine der großen indianischen Nationen in Kanada, sie leben zurückgedrängt auf der Gaspésie-Halbinsel von Québec, der Fluss Restigouche bildet die Grenze ihres Reservats, aber auch zugleich ihre Ernährungsgrundlage.
Die großen Trawler vor der Küste haben die Lachsbestände minimiert, am oberen Flusslauf beschweren sich die luxuriösen Anglerressorts, sie könnten ihren Gästen aus New York, Washington und Toronto keine Beute mehr bieten.
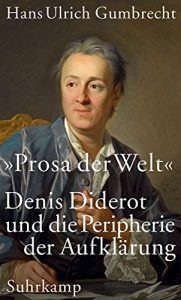 Philosoph und Übersetzer, Kritiker und Schriftsteller, Kunstagent und Enzyklopädist:
Philosoph und Übersetzer, Kritiker und Schriftsteller, Kunstagent und Enzyklopädist:
Denis Diderot, 1713 in der Champagne geboren, 1784 in Paris gestorben, war eine der prägenden Figuren jener Bewegung, die als europäische Aufklärung in die Geschichte eingegangen ist.
Doch was ist der Fluchtpunkt seines vielgestaltigen Euvre, das anders als die Werke seiner Zeitgenossen Voltaire und Rousseau, Schiller, Kant und Hume von einer geradezu zentrifugalen Dynamik gekennzeichnet ist Entlang von Szenen aus Diderots bewegtem und bewegendem Leben und in genauen Lektüren seiner Schlüsselwerke geht Hans Ulrich Gumbrecht in seinem Buch dieser Frage nach und entwickelt einen neuen Zugang zu diesem außergewöhnlichen Intellektuellen.
Die Hochschulen seien zu islamfreundlich: Das hat der französische Bildungsminister den Universitäten vorgeworfen. Thomas Römer hält die Kritik für verfehlt. Der Leiter des prestigeträchtigen Collège de France erklärt im Gespräch, was der Bildung in seinen Augen fehlt:
? Herr Römer, Sie sind Hochschullehrer – Mitte Oktober ist ein Lehrer ermordet worden. Sie sind Theologe – jüngst wurden drei Kirchgänger umgebracht. Was haben diese islamistischen Attentate bei Ihnen ausgelöst?
Albrecht von Lucke versprüht viele politische Visionen – Realutopien kommen aber auch nicht zu kurz:
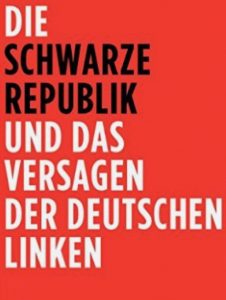 Mit diesem Titel weist der Jurist und Politologe Albrecht von Lucke nach, dass die These, der ehemalige SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder habe mit seiner „agenda 2010“ und weiteren so genannten „Reformgesetzen“ die deutschen Interessen mutig und erfolgreich vertreten und allenfalls seiner Partei geschadet, nur halb richtig ist.
Mit diesem Titel weist der Jurist und Politologe Albrecht von Lucke nach, dass die These, der ehemalige SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder habe mit seiner „agenda 2010“ und weiteren so genannten „Reformgesetzen“ die deutschen Interessen mutig und erfolgreich vertreten und allenfalls seiner Partei geschadet, nur halb richtig ist.
Zwar stimme es, dass Schröder damit sowohl die Mitglied- als auch die Wählerschaft der SPD halbiert habe, es sei aber falsch, diese Gesetze als positiv für Deutschland zu bewerten.
Mit nämlich dem Verschwinden der SPD als potentiell regierungsführende Volkspartei in der deutschen Parteienstruktur sei derzeit eine Lage eingetreten, in der nur noch die Volkspartei CDU (einschließlich der CSU) mit dem Anspruch auf die Kanzlerschaft auftreten kann und die anderen deutschen Parteien lediglich als Mehrheitsbeschaffer dienen.
Bestseller
Die Stille
Roman
Die Welt im Ausnahmezustand – Don DeLillos neuer Roman ist das Buch der Stunde. Nur wenige Wochen vor Ausbruch der Corona-Pandemie schloss Don DeLillo die Arbeit an seinem neuen Roman ab. Ein Werk mit verblüffenden Parallelen zur aktuellen Situation in der Welt. Ein literarischer Meilenstein.

Einst im innersten Kreis um Hitler, sollte der frühere „Kronprinz“ von Schirach, hier bei einem Spaziergang in Berchtesgaden, zunehmend in Ungnade fallen.
Bei einem Besuch der Schirachs auf dem Berghof 1943 kippte das Verhältnis, wie Rathkolb in seinem neuen Buch zeigt.
In seinem neuesten Buch „Schirach. Eine Generation zwischen Goethe und Hitler“ zeichnet der Zeithistoriker Oliver Rathkolb die Aufstiegsgeschichte des NSDAP-Reichsjugendführers Schirach nach, wie von Schirach, aus dem rechtskonservativen Milieu Weimars stammend, sehr früh zu einem begeisterten Nazi wurde und rasch ins engere Umfeld von Adolf Hitler aufsteigen wollte, was ihm, auch dank einiger publizistischer Leistungen für den „Führer“, gelungen war.
Schon als Reichsjugendführer des „Dritten Reichs“ habe von Schirach, wie Rathkolb sehr detailliert zeigt, die Kulturagenden genutzt, um etwa Johann Wolfgang von Goethe zum Sinnbild deutschen Führertums und deutscher Größe zu stilisieren. (mehr …)

