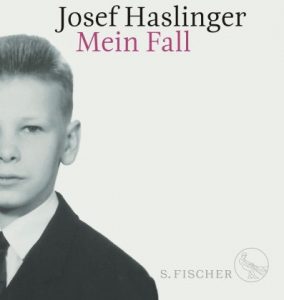Aus dem himmlischen Paradies mit Zorn und Schwert vertrieben, fristen Sterbliche fortan eine kummervolle Existenz. So lehrt es die Genesis, und bis tief in das 19. Jahrhundert dachten nun Denker – Philosophen, Theologen, Mystiker verschiedenster Couleur – über die Entfremdung von der Gottheit nach. Erst die Früchte vom Baum der Erkenntnis brachten, nach biblischem Verstand, einen Prozess in Gang, der den Mangel an Glück und Fülle zur Theorie von dieser Welt erhob.
Aus dem himmlischen Paradies mit Zorn und Schwert vertrieben, fristen Sterbliche fortan eine kummervolle Existenz. So lehrt es die Genesis, und bis tief in das 19. Jahrhundert dachten nun Denker – Philosophen, Theologen, Mystiker verschiedenster Couleur – über die Entfremdung von der Gottheit nach. Erst die Früchte vom Baum der Erkenntnis brachten, nach biblischem Verstand, einen Prozess in Gang, der den Mangel an Glück und Fülle zur Theorie von dieser Welt erhob.
Denken müsse, wurde uns seit je beigebracht, mache traurig. Sobald wir unserer Grenzen und Unvollkommenheiten innewerden, wenn wir einsam über vielerlei Ungenügen reflektieren, wenn wir uns nach innen wenden und ins Stocken geraten, herrscht das Klima der Melancholie.
Dieses Phänomen aus langer Tradition ist uns vertraut. Der Literaturwissenschafter Steiner, Kritiker, Essayist und Schriftsteller verkörpert in einem gerade im Carl-Hanser Verlag erschienenen Essay ein Nachsinnen, das Wirkliches als Idee wie als geschichtliche Realität immer wieder unter dem Aspekt der Hinfälligkeit vermisst. Steiners Schriften sind oftmals kluge und zugleich persönliche Melodien über das Thema des Verschwindens oder jedenfalls der verlorenen Illusionen.
 Vor etwa 40 Jahren – Bukowski war damals in Heidelberg auf „Lesereise“ und bei mir in der „GraGa 9“ zu Besuch – misslang ein (wie er meinte) „jungspundiges Interview“ mit ihm nicht ausschließlich.
Vor etwa 40 Jahren – Bukowski war damals in Heidelberg auf „Lesereise“ und bei mir in der „GraGa 9“ zu Besuch – misslang ein (wie er meinte) „jungspundiges Interview“ mit ihm nicht ausschließlich.