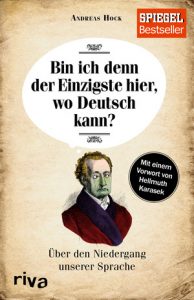 Die erste Pisa-Studie vor mehr als zwanzig Jahren war ein Weckruf. Doch das Sprachdefizit ist seither noch grösser geworden. Als Ende 2001 die Resultate der ersten Pisa-Studie veröffentlicht wurden, löste dies in Deutschlland und der Schweiz Schockwellen aus.
Die erste Pisa-Studie vor mehr als zwanzig Jahren war ein Weckruf. Doch das Sprachdefizit ist seither noch grösser geworden. Als Ende 2001 die Resultate der ersten Pisa-Studie veröffentlicht wurden, löste dies in Deutschlland und der Schweiz Schockwellen aus.
Die im Vorjahr durchgeführte Erhebung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stellte den Fähigkeiten der Schüler im deutschsprachigen Raum gerade bei der Lesekompetenz ein schlechtes Zeugnis aus.
Nur die Österreicher hatten mit Resultaten über dem OECD-Durchschnitt Grund zum Feiern. Bis auch hier der Kater einsetzte: Wie sich 2007 herausstellte, waren die Daten falsch erhoben worden, und die Kompetenzen waren deutlich geringer.
Die Sorge um den Zerfall der Gesellschaft und den Niedergang der Jugend zieht sich zwar durch die Geschichte aller Kulturen. Doch in den Ländern des deutschsprachigen Raums ist die Angst besonders ausgeprägt, es könnte durch nachlassende Fähigkeiten in den Schulen zum Abbruch der humanistischen Bildungstradition kommen.
Bildung begründet einen Wert in sich
Bildung ist die Voraussetzung für gesellschaftlichen Fortschritt, das Verhältnis von Hochsprache und Dialekt stiftet Identität und Integration. Entsprechend kontrovers waren die Diskussionen in den letzten zwei Jahrzehnten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wenn in Deutschland von der deutschen Sprache die Rede ist, wittern (sic: wir in diesem Casus) Untergangspropheten regelmässig den allgemeinen Kulturverfall. Die schriftlichen Fertigkeiten der Jugend sind seit je Gegenstand grösster Sorgen um die Bildung des Landes, und seit es Social Media gibt, gesellt sich zur Diagnose einer drastisch gesunkenen Allgemeinbildung sowie nachlassender Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen das Phänomen von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen. Dazu kommt der zunehmende Gebrauch der gendergerechten Sprache, der bei Befürwortern wie Gegnern Auslöser eines regelrechten Kulturkampfes geworden ist.
Wer bestimmt, wie gesprochen und geschrieben werden darf – und auf welche Weise auf keinen Fall –, hat die Deutungshoheit; nicht nur über ein Mittel zur Verständigung, sondern über einen kulturellen Wert, mit dem sich das Land idealerweise identifiziert.
Die Pisa-Studie attestierte deutschen Schülern schon 2001 gravierende Mängel in Deutsch und Mathematik. Die schlechten Ergebnisse diverser Bildungsstudien und Lernstandserhebungen rissen seitdem allerdings nicht ab. Die Klagen über fehlende Kenntnisse der Rechtschreibung und Defizite im Rechnen sind nicht etwa leiser, sondern lauter geworden. Längst betreffen sie auch Abiturienten und Studenten.
So ist nicht jede Sorge um den Verlust an Bildung unbegründetem Kulturpessimismus geschuldet. Der «Dritte Bericht zur Lage der deutschen Sprache» vom vergangenen Herbst ist dennoch von dem Bemühen getragen, einen konstruktiven Umgang mit sprachlichen Änderungen zu finden.
Herausgegeben wird der Bericht von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. Die Projektleiterin Ursula Bredel attestiert den Grundschülern mit Gymnasialempfehlung etwa «einen grösseren Wortschatz und flexiblere Ausdrucksmöglichkeiten», während die Sicherheit in der Rechtschreibung nachgelassen habe.
Der Bericht weiss um die Defizite der sprachlichen Fertigkeiten, warnt aber vor einer fehlenden Differenzierung der Debatte. Weder gebe es in den Schulen einen einheitlichen Sprachgebrauch noch eindeutige Erklärungen, warum die Leistungsunterschiede teilweise so gross seien.
Die Autoren widersprechen der Diagnose eines allgemeinen Sprachverfalls. Es habe vielmehr eine Verschiebung «von formaler auf funktionale Sprachbildung» gegeben. Mit anderen Worten: Die Schüler schreiben lange Texte, beherrschen aber die Interpunktion und korrekte Grammatik nicht mehr.
Fraglich ist, ob es reicht, auf eine «Sprache im Werden» zu verweisen, wie die Autoren des Akademie-Berichts es tun, wenn die Schreib- und Sprachdefizite genau das verhindern, was Bildung eigentlich bewirken soll: die grundlegenden Kulturfertigkeiten zu erlernen, um sich die Welt erschliessen zu können.
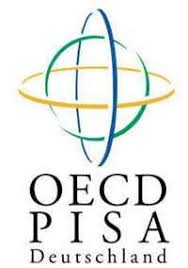 Die Pandemie hat gezeigt, welche Folgen es hat, wenn eine Anleitung durch den Schulunterricht, der genau diese Fertigkeiten vermittelt, monatelang ausfällt. Die soziale Ungleichheit – seit Jahrzehnten ein zentrales Problem der Bildungspolitik im gesamten deutschsprachigen Raum – wächst, die Leistungsunterschiede werden grösser. Während Kinder mit bürgerlichem Hintergrund die aufgrund geschlossener Schulen angehäuften Lerndefizite eher durch besorgte Eltern und Nachhilfe ausgleichen konnten, fehlte es vielen sozial Benachteiligten an ruhigen Orten für Hausaufgaben oder gar an eigenen Computern.
Die Pandemie hat gezeigt, welche Folgen es hat, wenn eine Anleitung durch den Schulunterricht, der genau diese Fertigkeiten vermittelt, monatelang ausfällt. Die soziale Ungleichheit – seit Jahrzehnten ein zentrales Problem der Bildungspolitik im gesamten deutschsprachigen Raum – wächst, die Leistungsunterschiede werden grösser. Während Kinder mit bürgerlichem Hintergrund die aufgrund geschlossener Schulen angehäuften Lerndefizite eher durch besorgte Eltern und Nachhilfe ausgleichen konnten, fehlte es vielen sozial Benachteiligten an ruhigen Orten für Hausaufgaben oder gar an eigenen Computern.
Eine zentrale und bisher ungelöste Herausforderung ist der Stellenwert der Digitalisierung im Schulalltag. Unzweifelhaft führt die Dauerpräsenz von Smartphones, sozialen Netzwerken und permanenter Kommunikation auf Bildschirmen zu Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen. Bereits vor knapp einem Jahrzehnt forderte der amerikanische Wissenschaftsjournalist Daniel Goleman in seinem Buch angesichts der wachsenden Ablenkungen durch die digitale Welt: «Konzentriert euch!»
Im Kontext der Schule sollte es dennoch nicht um die Frage gehen, wie man die digitale Entwicklung überwinden oder ausblenden kann, sondern darum, wie sich digitale Fähigkeiten für die Sprachvermittlung nutzen lassen. So berechtigt manche Kulturkritik ist, so wenig ist eine Verbesserung der Lage zu erwarten, wenn man die Modernisierung ablehnt, statt konstruktiv mit ihren Techniken zu arbeiten.
Österreich: Immerhin Mittelmass
Es sagt einiges aus über Österreichs neue Bescheidenheit nach den Kontroversen um die Datenfehler der ersten Pisa-Studie, dass sich der ORF 2018 fast darüber freute, dass Österreich bezüglich Deutschkenntnissen «diesmal nicht statistisch signifikant unter dem OECD-Schnitt» liege. Einen Erfolg stellt dies zwar nicht wirklich dar, aber immerhin vollzieht sich der generelle Abwärtstrend der Industrieländer bei den Lesefähigkeiten etwas langsamer. Österreich hat zwar eines der teuersten Bildungssysteme der Welt, produziert aber mit Ausnahme der hervorragenden Berufsbildung eher mittelmässige Resultate.
Die Beziehung des Landes zur deutschen Sprache ist dabei eine durchaus ambivalente, die sich irgendwo zwischen dem grossen Nachbarland und der Schweiz verorten lässt: So gilt der Dialekt in urbanen, weltgewandten Kreisen tendenziell ebenso als Zeichen von Provinzialität wie auf dem weiten Land als Trutzburg der Identität. Zur Spaltung tragen zusätzlich die Unterschiede zwischen dem alemannischen Dialekt im Westen und den bairischen Idiomen im Osten bei, die eine veritable Sprachbarriere darstellen.
Das österreichische Deutsch stellt zudem eine von drei anerkannten Varianten der Hochsprache dar. Es ist mit regional spezifischen Ausdrücken gespickt, die gerade im Osten oft aus slawischen Sprachen oder dem Ungarischen importiert wurden. Der wachsende Einfluss der deutschen Populärkultur befeuert dabei latente Assimilierungsängste. Sofern sie nicht gleich auf Englisch umstellt, redet die Wiener Jeunesse dorée «Bundesdeutsch», was traditionalistische Kreise mit Schrecken erfüllt.
Die durch die Pisa-Studien offengelegten Sprachdefizite der Jungen vertiefen somit bestehende Gräben zwischen Regionen, sozialen Schichten und Generationen. Die öffentliche Diskussion macht nicht ohne populistische Anwandlungen, aber mit einer gewissen Berechtigung die Migration verantwortlich: Der Anteil der Schüler mit nichtdeutscher Umgangssprache hat stark zugenommen und macht in Wien mehr als die Hälfte aus. Diese schneiden in der Pisa-Studie beim Lesen deutlich schlechter ab, auch im Vergleich zu anderen Ländern.
Bei Menschen mit Migrationshintergrund verfestigen sich in Österreich sprachliche Defizite besonders stark durch strukturelle sozioökonomische Benachteiligungen. Experten beobachten, dass hierzulande Vor- und Nachteile bei der Bildung überdurchschnittlich häufig «vererbt» würden. Verschiedene Reformen, auch als Reaktion auf «Pisa», haben daran nichts geändert.
Dass Kinder aus bildungsfernen migrantischen Milieus mehr Unterstützung bei der Sprachbildung benötigen, ist politisch unbestritten. Die dafür 2018 von einer Rechtsregierung eingeführten separaten Deutschförderklassen bleiben aber heftig umstritten: Laut Kritikern vergrössern sie durch die Trennung von «autochthonen» Schulkollegen im Alltag die Unterschiede eher noch. Für Österreich wie für Deutschland und die Schweiz gilt, dass die Corona-Pandemie die Ungleichheit zwischen stärkeren und schwächeren Schülern auch bezüglich sprachlicher Fähigkeiten vertieft hat.
Schweiz: Nach dem Weckruf die Schere
Die erste Pisa-Studie war für die Schweiz ein Weckruf. Das Land, das sich eines der teuersten Bildungssysteme der Welt leistet, war wie selbstverständlich davon ausgegangen, die besten Schulen der Welt zu haben. Doch bei der Erhebung im Jahr 2000 erzielte es nur mittelmässige Resultate. In der Mathematik und bei den Naturwissenschaften schnitten die Schweizer Schüler zwar gut ab. Doch beim Lesen haperte es. Ein Fünftel verstand selbst einfache Texte kaum.
Der Stolz des Bildungslandes Schweiz war angeknackst. Manche warfen den Studienautoren unfaire Testmethoden vor, die Schweiz werde benachteiligt, man sei «Opfer eines Kulturimperialismus», hiess es gar. Manche sahen die Dialektsituation als Ursprung allen Übels. In der Deutschschweiz sprechen die Leute im Alltag Dialekt, jüngere Generationen schreiben private Nachrichten zunehmend ebenfalls auf Mundart. Hochdeutsch hingegen wird lediglich im offiziellen Schriftverkehr, in der Literatur oder in den Medien verwendet und von einigen deshalb als Fremdsprache bezeichnet. Andere wiederum gaben den Sparübungen in den neunziger Jahren die Schuld am schlechten Abschneiden.
Die Politik reagierte mit einer breit angelegten Leseoffensive. Der Aufwand schien tatsächlich zu fruchten, rund zehn Jahre nach deren Start erreichte die Schweiz in der Lesekompetenz einen neuen Höchstwert. Doch der Trend hielt nicht lange an. Im Gegenteil: Bei der letzten Erhebung im Jahr 2018 war das Resultat sogar noch schlechter als beim ersten Test achtzehn Jahre zuvor.
Auffällig an den Resultaten ist, dass sich die Schere zwischen starken und schwächeren Jugendlichen weiter geöffnet hat. Während viele Schüler sehr gut abschnitten, war rund ein Viertel abgehängt. Laut Andrea Erzinger, Leiterin des Pisa-Projekts in der Schweiz, sind diese Schüler beim Lesen nicht kompetent genug, um «Herausforderungen im Alltag oder Berufsleben bewältigen zu können».
Trotz solchen besorgniserregenden Warnungen sorgten die Resultate nicht für einen neuerlichen Weckruf. Das lag einerseits daran, dass die Lesekompetenz nicht nur in der Schweiz schwächer wurde, sondern in vielen anderen OECD-Ländern auch. Man glaubte sich gewissermassen in guter Gesellschaft. Andererseits schoben viele die schwachen Resultate den Kindern der Migranten in die Schuhe.
Diese Analyse greift aber zu kurz. Zwar benennt der neueste Schweizer Bildungsbericht die Migrationsfrage neben der Digitalisierung als eine der wichtigsten Herausforderungen. Ein Drittel der 15- bis 17-Jährigen in der Schweiz weist einen Migrationshintergrund auf. Doch einzig die Herkunft als Ursache schulischer Benachteiligung anzugeben, sei zu einfach, schreiben die Verfasser. Das zeige allein der Fakt, dass es unter den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund grössere Leistungsunterschiede gebe als unter jenen mit fremder Herkunft.
Statt die drängenden Probleme anzugehen, wurde in den letzten Jahren häufig auf Nebenschauplätzen gekämpft. Bestes Beispiel war eine Reihe von kantonalen Volksinitiativen der Schweizerischen Volkspartei, die das Hochdeutsch aus den Kindergärten verbannen und dafür den Dialekt als einzige zulässige Unterrichtssprache einführen wollte. Mehrere Kantone, darunter auch Zürich, nahmen die Vorlagen an.
Ob die Initiativen der Sprachförderung zuträglich sind, sei dahingestellt. Der Vorstoss kann aber als Zeichen der widersprüchlichen Schweizer Sprachsituation gelesen werden: Einerseits ist man stolz auf seine Dialekte, andererseits aber leidet das Land gleichzeitig unter einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem nördlichen Nachbarn.
