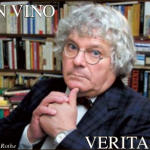Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen“. Kant sagte (frei nach Math. 18,3) im Alter alberne Reime auf, Leonardo da Vinci schleppte seine Staffelei wie einen Teddy hinter sich her. Alsdann: Was passiert, wenn bald Millionen sind wie die Kinder?
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen“. Kant sagte (frei nach Math. 18,3) im Alter alberne Reime auf, Leonardo da Vinci schleppte seine Staffelei wie einen Teddy hinter sich her. Alsdann: Was passiert, wenn bald Millionen sind wie die Kinder?
Hätte Charlton Heston vielleicht mehr Kreuzworträtsel lösen sollen? Wäre Georges Simenon mit Sudokus zu helfen gewesen? Betrieb Iris Murdoch zu wenig Gehirnjogging? Hätte Ronald Reagan nur mehr denken müssen, um etwas später in die Abenddämmerung seines Lebens zu driften? Vermutlich nicht. Mit den Denkern und Geistesgrößen ist es auch nicht weit her. Immanuel Kant, der Prediger gehobener Selbstverantwortung, begann in späten Jahren, die Liedertexte seiner Kindheit in kleiner Runde vorzutragen. Gäste und Schüler reagierten mild verwundert, applaudierten besorgt und versuchten, das Gespräch auf die Metaphysik zu lenken.
Anfangs gelang das, bald jedoch immer seltener. Schließlich mussten sie einsehen, dass der Philosoph größeres Interesse an Abzählversen hegte als an den Fragen von Vernunft und Ethik. Aus heutiger Sicht mögen die Übungen mit schlichten Reimen ein intuitiver Versuch der Vorbeugung gewesen sein. Ob dieser Versuch etwas genützt hat, und sei es nur im Sinne einer Verzögerung, ist mehr als fraglich. Sicher ist, dass Kant mit den Kategorien seines Denkens bald nichts mehr anzufangen wusste. Mit „erschröcklicher Heiterkeit“, notierte ein Schüler, „trug er uns närrische Reime vor“. Heiterkeit, ja, närrisch auch, aber warum erschröcklich?
Der Philosoph Ralph Waldo Emerson – so jedenfalls ist das überliefert – stürzte seine Schüler in eine Interpretationskrise, als er im hohen Alter mit seinem Wanderstock immer den gleichen Halbkreis auf den Boden zeichnete, auf den Sandboden vor seiner Lieblingsbank im Kiefernwald von Concord, Massachusetts, und bei Regen auf die Dielen seines Hauses, wo die Einkerbungen bis heute zu besichtigen sind. Die Aufsicht führenden Schwestern aus der Florence-Nightingale-Schule ließen es ehrfürchtig geschehen. Beharrlich zog der von Gedanken befreite Denker einen Halbkreis um seine Füße. Er sprach nicht mehr. Was er geschrieben hatte, hatte er vergessen. Wer er war, interessierte ihn nicht mehr. Fragen beantwortete er mit einem Lächeln. Aber schrapp, schrapp, hin und zurück, schurrte die metallbeschlagene Spitze über die Maserung der Dielen, regelmäßig wie das Pendel einer Uhr.
Wollte er, der so enthusiastisch indische Mystik studiert hatte, mit seinen unablässigen Halbkreisen auf stellare Bahnen und den Einfluss des Kosmos hinweisen, wie seine Verehrerin Louisa May Alcott hoffte? Oder eher auf die Wiederkehr des Ewiggleichen, wie sein Schüler Walt Whitman fürchtete? Beides möglich. Am ehesten aber wies er auf die Bedeutungslosigkeit jeder Wiederkehr oder Nicht-Wiederkehr hin.
Es gibt noch keine Kulturgeschichte der Vergesslichkeit, doch die Philosophen wären zahlreich in ihr vertreten. Ausgerechnet diejenigen, die ihr Leben dem Gehirntraining gewidmet haben. Aus unserer Zeit käme wahrscheinlich Walter Jens darin vor. Der Altphilologe befände sich in bester Gesellschaft mit einigen seiner bewunderten Meistern der Antike. Aus überlieferten Viten, voran denjenigen von Plutarch, haben Neurologen herausgelesen, dass Koryphäen wie Cato der Ältere in Rom oder Aristeides in Athen im Lebensabend keine Auskunft mehr darüber geben konnten, was sie geschaffen hatten, wie alt sie waren oder wie sie hießen. Wie der alte Epikur – „schick mir ein Stück Käse, damit ich einmal richtig essen kann“ – waren sie vollkommen genügsam geworden.
Und wie steht es mit Diogenes von Sinope, jenem Enkelschüler des Sokrates, der mit einem einzigen Satz zu bleibendem Ruhm gelangte? Er muss um die siebzig gewesen sein, als er ihn äußerte. Als skurriler Hagestolz hätte er sich beizeiten im Pflegeheim befunden, wenn es damals ein solches gegeben hätte. So lebte er in einer aus Fassbrettern gezimmerten Bude am Strand. Als er Besuch von – w i r erinnern uns – sozusagen dem Vertreter des Staates Alexander bekam und dieser Diogenes nach seinem dringendsten Wunsch befragte, zahnlos nuschelte: „Geh mir aus der Sonne.“
Tüddelig, aber „normal …“
So! Und dafür bekam er – was Wunder – keine staatliche Unterstützung. Allerdings benötigte er sie wohl auch nicht. Wenn er als Weiser galt, wurde er – auch jenseits seiner Weisheit – mit Almosen versorgt, wie es heute in Indien den Sadhus und Gurus widerfährt. Und wenn er nicht gänzlich ohne Familie war, wurde er ernährt, gekleidet und mitgezogen, wie es heute noch üblich ist in allen Ländern mit festen Familienverbänden. Auch bei uns blieben bis vor einem halben Jahrhundert all diejenigen, denen Namen und Orientierung abhanden gekommen waren, im Haus bei den anderen, zumindest auf dem Dorf und in den kleinen Städten. Sie saßen auf der Abendbank. Wurden sie als krank eingestuft? Nein. Sondern allenfalls als sonderlich, närrisch, kindisch, tüddelig oder wunderlich. Das fand man normal.
Wer berühmt genug war, musste ohnehin nie fürchten, zur Vernunft gebracht zu werden. Der greise preußische Friedrich schuf im Flackerlicht einzig für ihn entzündeter Lüster und, weit nach Mitternacht neue Schlachtordnungen. Einen nachvollziehbaren Sinn ergaben sie nie. Nacht für Nacht inspizierte er die nachgebauten Heeresaufstellungen siegreicher Feldzüge, und niemals schienen sie ganz gelungen.
Zuerst versuchte ein fachkundiger Adjutant, dem König seine historische Strategie in Erinnerung zu rufen, und anfangs schienen solche Korrekturen zu fruchten, bald jedoch seltener; und schließlich ließ man ihn gewähren. Sobald er sich zur Ruhe begeben hatte, beeilten sich die Diener, die ursprüngliche Ordnung wieder aufzubauen, wie eine Mutter das Spielzimmer ihres Kindes aufräumt. Doch auch im Falle des Königs hielt die Ordnung, die alte preußische Ordnung, nur, solange er schlief.
Niemand hinderte Leonardo daran, den Besuchern auf dem Schloss in Amboise den Schlaf zu rauben, wo er als Gast des Königs von Frankreich seine letzten Jahre verbrachte. Er malte kaum noch, aber nachts fand er Gefallen daran, seine Staffelei rumpelnd hinter sich her zu schleppen wie ein Kind seinen abgewetzten Teddybären.
Flaubert wanderte nach Schilderung seiner Nachbarn stundenlang in seinem Haus in Croisset am Ufer der Seine auf und ab; man hielt sein Gehen für schöpferische Meditation, wenn auch nichts Erkennbares mehr zutage kam. Hölderlin spazierte im Kreis; die Form des Turmes, in dem sein Gönner ihn untergebracht hatte, legte das nahe; die Tür war von außen verschlossen. „Die Schwärmerische, die Nacht kommt“, hatte er als junger Mann gedichtet; nun war sie da, und er schwärmte. „Sein Geist wird schwärmerisch“, heißt es ebenbürtig vom König Lear, als er sich hinaus in die Nacht begibt, in Begleitung seines Spiegelbildes, des Narren.
Es sind die anderen, die darüber der Schrecken erfasst, nicht die Narren und Schwärmer selbst. „Die Erinnerung ist das einzige Gefängnis, aus dem man nicht befreit werden kann“, notierte Schnitzler in Abwandlung eines Zitates von Jean Paul. Ein Irrtum. Die Befreiung findet statt. Für die von ihrer Erinnerung Erleichterten wird das Leben nach einer Anfangsphase der Irritation immer einfacher. Weil das Erlernte und Erworbene rückwärts gelöscht wird, ist das Leben am Ende in der Tat so einfach und kreatürlich wie das eines Kindes.
Das beste wissenschaftliche Buch zum Thema, das Hauptwerk des holländischen Forschers Huub Buijssens, heißt deshalb treffend: „Die Einfachheit der Demenz“. Der „Simplify“-Boom ist versickert; niemand konnte den immer komplizierteren Regeln zur Vereinfachung folgen. Die kindlich Werdenden sind die Einzigen, die das Ideal – wirklich – verwirklichen. Für sich selbst – nicht für die anderen. Für die Partner, die Verwandten, die Aufsichtspersonen, die nun wie die Eltern eines Kindes notwendig sind, wird es freilich anstrengend.
Wallis Simpson hielt den greisen Herzog von Windsor davon ab, an Sommerabenden seine längst verblichene Urgroßmutter zu besuchen, die Königin Viktoria, die ihn einst verhätschelt hatte und die ihn nun zurückbringen sollte auf den englischen Thron. Yves Montand gab acht auf Simone Signoret, F. Scott Fitzgerald auf Zelda, John Bayley auf Iris Murdoch.
Doch meist ist die Frau die Kindergärtner*In des Mannes. Gala Éluard hielt bis zu ihrem Hinscheiden den glücklich verwirrten Dalí davon ab, Liebeserklärungen an die Diktatur zu veröffentlichen; stattdessen ließ sie ihn – vermögensbildend – leere Blätter signieren. Als Sartre absonderlich wurde und in philosophischer Runde bei seinen Ausführungen steckenblieb, griff Simone die in der Luft hängenden Sätze auf und führte sie zu Ende. Sie kannte seine Weisheiten zu Leben und Tod so gut, wie eine Ehefrau die Kommentare ihres Mannes zu den Fernsehnachrichten kennt.
Auf Pflege angewiesen zu sein, nicht mehr selbst über das Leben gebieten zu können, die Kontrolle zu verlieren: Das steht an der Spitze deutscher Ängste. Ich teile diese Angst nicht. Was heißt denn hier Demenz? Allenfalls eine gesunde Mischung mit Rislingschorle ist das. Wer schließlich auch sollte mich nächtens fragen wollen, woher ich ich gerade komme, wenn ich meinen Nachhauseweg aus der Unteren Straße in die Grabengasse angetreten habe. Und, warum sollte ich das wissen sollen: Oder gar wollen … ?
Angerichtet an auch sehr persönlichen Zutaten habe ich diese Beispiele dafür gesammelt, wie man auch in fortgeschrittenem Alter mit Lücken im sowohl Nah- als auch Ferngedächtnis vortrefflich leben kann.
Mit Verlaub, ich, mit Hilfe meiner wenngleich manchmal darob etwas mehr oder weniger ratlosen Freunde – ich tu das!