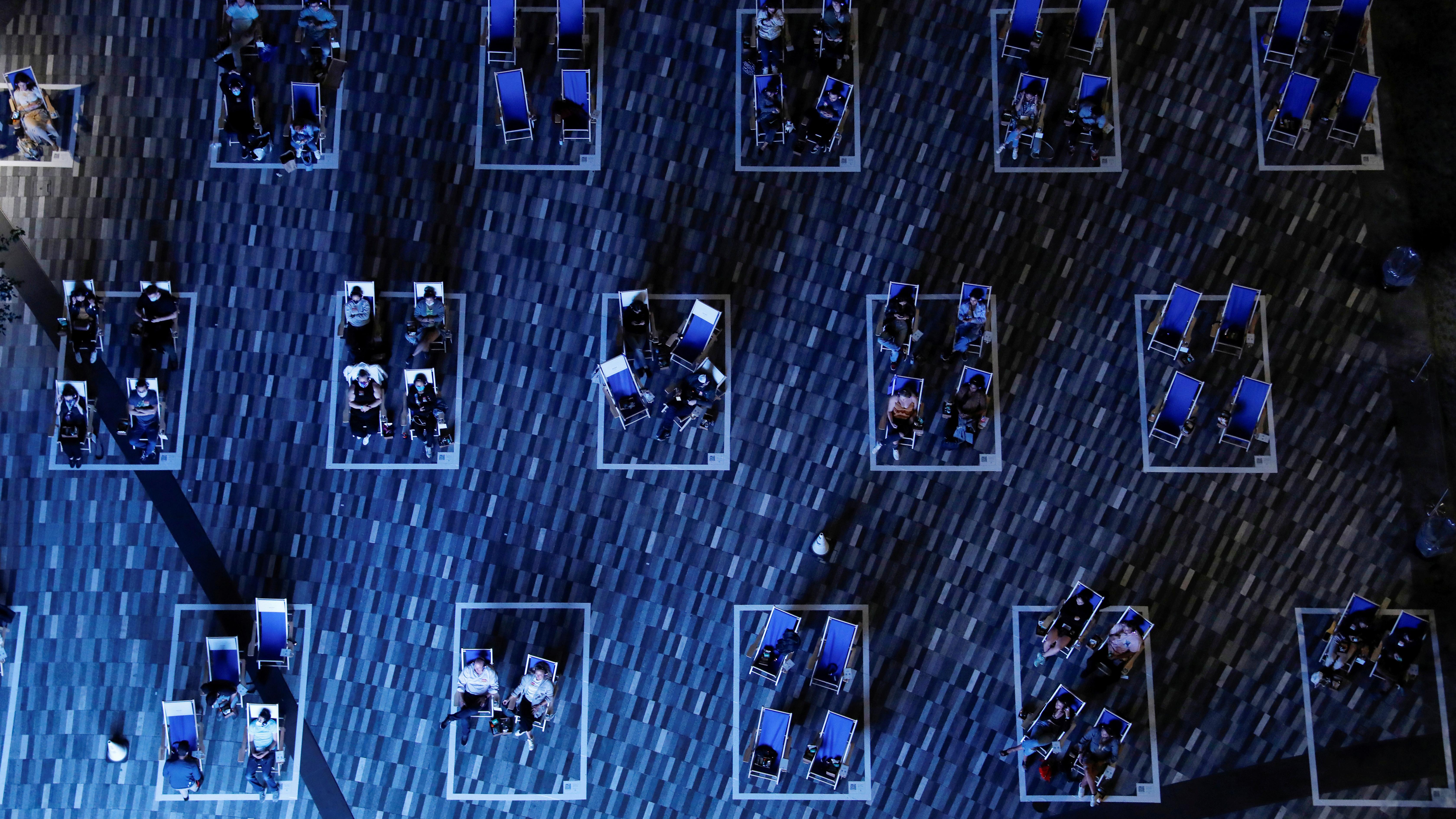
Geht das jetzt immer so weiter? – Seite 1
Statt klare Botschaften zu senden, verliert sich Deutschland gerade in einem Klein-klein aus Corona-Maßnahmen. Was fehlt, ist eine Langzeitstrategie. Wie könnte die aussehen? Trifft man Amtsärzte, spricht mit Virologinnen und Ausbruchsforschern, zeichnen sie im Wesentlichen drei Ansätze: Die Kontrollstrategie, die Null-Fälle-Strategie und die Wellenbrecher-Methode. Wie viel von welchem Weg sollten wir gehen?
Patrick Larscheid hat noch nicht seine Motorradmontur abgelegt, da hat ihn die Pandemie schon wieder eingeholt. Es ist Montag vergangener Woche, kurz vor neun Uhr, Larscheid steht im Innenhof des Gesundheitsamtes von Berlin-Reinickendorf, dem Amt, dessen Leiter er ist. Um ihn haben sich rund 60 Menschen versammelt: Mitarbeiter, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, Helfer aus anderen Behörden. Es geht um Neuinfektionen, Ausbruchsherde, Infektionsketten. Die Lagebesprechung im Hof dauert zehn Minuten, dann gehen alle an die Arbeit.
Drinnen, in seinem Büro, schildert Larscheid die Lage. Sein Team sehe seit Wochen dabei zu, wie die Zahl der Neuinfektionen stieg und Infektionsketten rissen. Mittlerweile schafften sie es nicht mehr, alle Kontaktpersonen Infizierter selbst anzurufen. Larscheid hofft, dass durch den neuerlichen Teil-Lockdown, der seit Anfang des Monats gilt, die Fallzahlen bald sinken werden. Dass etwas Ruhe einkehrt. Aber er sagt auch: „Ich denke, wir werden mit den Beschränkungen bis ins neue Jahr leben müssen. Statt Weihnachten retten zu wollen, sollten wir das Ziel haben, so vielen Menschen wie möglich ein nächstes Weihnachten überhaupt zu ermöglichen.“
Impfstoffe in Entwicklung
-
Präklinik
>160
-
Phase I + II
45
-
Phase III
11
-
Antrag Zulassung
2
-
Zugelassen
2
Quellen: Kreis- und Landesbehörden, RKI, ECDC, Impfstoff-Zentrum London School of Hygiene & Tropical Medicine, WHO.
Ein Blick in die USA, in die Stadt New York, zeigt, wie so ein Szenario aussehen kann. Florian Krammer ist dort Virologie-Professor an der Icahn School of Medicine, einer Medizin-Uni. In seiner Stadt gelten seit dem Ende des ersten New Yorker Lockdowns im Frühjahr strengere Regeln als in Deutschland. Sie wurden im Sommer auch nicht wesentlich gelockert. An vielen Orten gilt eine strenge Maskenpflicht. Restaurants wurden für lange Zeit geschlossen. Fast alle Bars sind zu. Erst seit Kurzem dürfen New Yorker Gastronomen in Innenräumen wieder wenige Gäste beherbergen. Deutschlands Gastwirte können bis auf Weiteres nicht weitermachen.
Krammer hält es für möglich, dass das erstmal so bleibt. Er rechnet damit, dass in Deutschland wie in New York nun längere Zeit strenge Beschränkungen gelten werden. „Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass im Dezember wieder alles normal wird. Großveranstaltungen und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen – auch mit Maske – sehe ich im Dezember, Januar und Februar nicht. Genau so wenig wie Kulturveranstaltungen und Konzerte.“
Mit dieser Einschätzung ist der Virologe nicht allein. „Selbst wenn der Wellenbrecher erfolgreich ist und die Infektionszahlen gesenkt werden, sind wir im Dezember im besten Fall in der Situation von zwei oder drei Wochen vor den Maßnahmen“, sagt auch Jürgen May, Epidemiologe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Wenn man nicht von Lockdown zu Lockdown stolpern wolle, brauche es dringend eine „nachhaltige Strategie“.
Eine solche Strategie hat Angela Merkel an diesem Montag nun angekündigt. Doch wie sollte sie aussehen? Was wäre der beste Weg, um zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet, sich die Intensivstationen bis zur Überforderung füllen, Zehn- oder Hunderttausende sterben?
Erstens: Die Kontrollstrategie
Deutschlands bisherige Strategie lässt sich am ehesten so zusammenfassen: Die Infektionszahlen unter einer gewissen Schwelle halten – und mit harten Maßnahmen gegensteuern, wenn das Infektionsgeschehen außer Kontrolle zu geraten droht. Der Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche habe weiter Gültigkeit, bekräftige vergangene Woche Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI). Alle müssten noch ein paar Monate die „Pobacken zusammenkneifen“.
Das Problem an diesem Vorgehen: Selbst wenn es gelingt, die Fallzahlen zu senken: Wie lässt sich verhindern, dass sie wieder steigen, sobald die Maßnahmen ausgesetzt sind? Das Entscheidende sei, dass gewisse Kipppunkte nicht erreicht werden (arXiv: Contreras et al., 2020, Preprint), sagt hierzu Viola Priesemann. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation an Modellen, mit denen sich die Entwicklung des Corona-Ausbruchs abschätzen lässt. Ein solcher Kipppunkt sei immer dann erreicht, wenn sich so viele Menschen mit dem Virus infizieren, dass Labore und Gesundheitsämter nicht mehr hinterherkommen. In den Laboren stauen sich dann unbearbeitete Abstriche, die Gesundheitsämter schaffen es nicht mehr, die Kontaktpersonen positiv Getesteter zügig zu ermitteln und in Quarantäne zu schicken. Die so wichtige Trias aus Testen, Nachverfolgen, Isolieren bricht zusammen.
In diesem Fall beginnt ein Teufelskreis: Immer mehr Menschen wissen nicht, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Sie begeben sich nicht in Quarantäne und verhalten sich nicht vorsichtig genug. Diese unerkannten Virusträger treiben dann die Pandemie, das Virus verbreitet sich unkontrolliert, und die Labore und Gesundheitsämter kommen noch schlechter hinterher.
Genau das ist in Deutschland zuletzt geschehen. Noch im Sommer gab es sehr wenige unerkannte Träger des Virus. Im Oktober war der Kipppunkt in vielen Landkreisen erreicht. Die jetzigen Kontaktbeschränkungen sollen diese Entwicklung umkehren, damit die Kontrollstrategie wieder funktioniert.
„Ab 600 Clustern verlieren wir die Kontrolle“
Die Frage ist bloß: Wo beginnt die Grenze der Kontrollierbarkeit? Wann sind die Ämter wieder schneller als das Virus? Die Größenordnung von 50 pro 100.000 hält Priesemann für „nicht unsinnvoll“. Besser allerdings seien deutlich niedrigere Werte, ähnlich denen vom Sommer, also etwa fünf bis zehn Neuinfektionen pro Woche je 100.000 Einwohner. Es sei „im Prinzip machbar, innerhalb eines Monats deutlich unter die 50er-Marke zu kommen“, wenn alle mitzögen und deutlich all die Sozialkontakte einschränken, bei denen es zu Übertragungen kommen kann.
Die bisherige Grenze von 50 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner ist dabei keinesfalls eine feste Größe. Sie hängt etwa davon ab, wie gut die Gesundheitsämter ausgestattet sind. Je mehr Personen die Kontaktverfolgung in einem Landkreis unterstützen, desto mehr Fälle kann sich das lokale Gesundheitsamt leisten. Deshalb wünscht sich Ute Teichert, Direktorin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, dass die Gesundheitsämter mehr Personal bekommen, dazu am besten noch eine bessere digitale Ausstattung. Endlos steigern lässt sich die Kapazität der Ämter aber nicht. Laut dem Berliner Amtsleiter Larscheid könne seine Behörde gar nicht so viel Personal einstellen, um den aktuellen Infektionszahlen Herr zu werden.
Auch zusätzliche Funktionen in der Corona-Warn-App könnten helfen, Infektionsketten besser nachzuverfolgen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Südkorea, das vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen ist. Das Problem: Das Land sammelt große Mengen an Bewegungsdaten und nutzt sogar Kreditkarten bei der Fallverfolgung – ein massiver Eingriff in die Privatsphäre der Menschen. In Deutschland wäre das kaum zu vermitteln. Ein Kompromiss könnte sein, einige Datenschutzrichtlinien zeitweise außer Kraft zu setzen. Schließlich würde man damit verhindern, dass andere Grundrechte im Zuge noch strengerer Kontaktbeschränkungen eingeschränkt würden.
Zudem könnte die deutsche Corona-Warn-App um eine Art Kontakttagebuch erweitert werden. Das könnte helfen, Infektionscluster ausfindig zu machen. „Es kommt auf die Cluster an“, schrieb der Virologe Christian Drosten schon im August in einem Gastbeitrag auf ZEIT ONLINE. „Sie treiben die Epidemie.“
Japan konzentriert sich deshalb seit dem Beginn des Ausbruchs auf solche Cluster. Die Situation dort ist jener in Deutschland ähnlich. Japan ist ein dicht besiedeltes, hochentwickeltes Land mit einer sehr alten Bevölkerung. Und Japan hat – ähnlich wie die deutschen Gesundheitsämter – 469 Zentren für öffentliche Gesundheit, mit insgesamt 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das System geht auf das Jahr 1937 zurück, als Japan eine Tuberkulose-Welle erlebte.
Kazuto Suzuki ist Professor für internationale Politik an der Universität in Hokkaido. Er sagt, die Zahl der Cluster sei heute in Japan eine der wichtigsten Kennzahlen der Pandemie: „Der R-Wert interessiert uns nicht so sehr.“ Das ist die Reproduktionszahl, also die Anzahl anderer, die ein Corona-Infizierter im Durchschnitt ansteckt.
Entscheidend seien nicht die Einzelübertragungen, nicht die Mehrzahl der Infizierten, die das Virus kaum weitergeben, die aber in Deutschland trotzdem im Mittelpunkt der Fallverfolgung stünden. Sondern die wenigen, die viele andere anstecken. Schätzungen zufolge könnten etwa zehn Prozent der mit Sars-CoV-2 Infizierten für 80 Prozent der Folgefälle verantwortlich sein. Das heißt, das Virus wird in Clustern übertragen. Suzuki kann sofort sagen, wie viele Cluster es in Japan gerade gibt: 450. Eine Zahl, die auch im Fernsehen und in Zeitungen auftaucht.
Auch in Japan ist es mit großem Aufwand verbunden, diese Cluster aufzudecken. Anders als man vermuten könnte, funktioniert das noch sehr analog. Die sogenannten Contact Tracer arbeiten bis heute wie Detektive in den Achtzigerjahren, mit Whiteboards, Aktenordnern und vielen Stunden am Telefon. Und auch in Japan kann das System an seine Grenzen kommen. Suzuki sagt: „600 Cluster sind die Grenze. Ab dieser Zahl verlieren wir die Kontrolle.“
Inzwischen suchen zwar auch in Deutschland Gesundheitsämter nach Clustern. Doch die Kontakt-Rückverfolgung, die dafür nötig ist, funktioniere bei den aktuellen Fallzahlen nicht mehr, sagt etwa Gesundheitsamtsleiter Larscheid. Sie sei aber die Grundlage für eine solche Strategie. „Woher soll ich sonst wissen, ob es ein Cluster gibt?“, fragt der Amtsarzt. Wenn sich bei der Recherche ergebe, dass es ein Quellcluster gibt, dass sich also mehrere Personen auf einem Event angesteckt haben, „dann bitten wir die Mitglieder dieses Clusters sowieso, in Quarantäne zu gehen“.
Die Expertin für öffentliche Gesundheit, Ute Teichert, sieht noch ein anderes Problem bei der Clusterverfolgung: Zum einen erlaube das Infektionsschutzgesetz den Amtsärzten bisher nicht, Menschen auch ohne Symptome oder positiven Test in die Quarantäne zu schicken. Nur in Berlin sei das möglich – geht es nach den Beschlüssen vom Montag, soll es nun aber bundesweit gelten.
Teichert bringt außerdem das Beispiel einer Party: 300 Leute, wenig Abstand, geschlossene Räume, viele Aerosole. Eine klassische Clustersituation. „Würden wir die japanische Strategie übernehmen, würde das bedeuten, dass bei einem positiven Fall alle 300 Besucher sofort in Quarantäne müssten. Es interessiert niemanden, ob sie tatsächlich Kontakt mit dem Infizierten hatten oder eine Maske getragen haben. Alle 300 sofort in Quarantäne. Glauben Sie wirklich, dass die Leute das machen würden?“
Dreimal G und nicht nur AHA-Regeln
Der Erfolg der japanischen Strategie beruht nicht nur auf einer anderen Art der Nachverfolgung. Die Regierung kommuniziert auch anders als die deutsche. Seit Beginn der Pandemie rufen die japanischen Behörden die Menschen auf, Clustersituationen zu vermeiden. Es gibt Plakate und Listen, was klassische Situationen sind oder sein könnten, etwa Essen gehen in Restaurants, Workout im Fitnessstudios oder ein Plausch im Pausenraum. Japan warnte vor allem vor den drei Cs: closed spaces, crowded places, close-contact settings.
Geschlossene Räume, Gruppen und Gedränge, Gespräche – inzwischen haben es die drei Gs auch in Deutschland in die Alltagsregeln geschafft: AHA+L+A-GGG heißen die nun. Noch immer aber ist fast überall nur von den AHA-Regeln (Abstand, Handhygiene, Alltagsmaske), dem Lüften (L) und der Corona-Warnapp (A) die Rede. Auf der Plattform zusammengegencorona.de des Gesundheitsministeriums und auf Plakaten findet man die Buchstaben AHA in ganz Deutschland, und sogar die Fußballmannschaft von Hertha BSC trägt die drei Buchstaben in einer Sprechblase auf der Brust. Fragt man die Deutschen, kennen die allermeisten diese Regeln, doch bei den drei G gibt es Wissenslücken. Das gilt insbesondere bei der Aerosolübertragung, wie regelmäßige repräsentative Befragungen der Deutschen seit Beginn des Ausbruchs zeigen.
Ganz entscheidend dafür, wie viele Infektionen man zulassen kann, ist aber noch etwas anderes: unser aller Verhalten, jenseits aller Einschränkungen. Entscheidend wird in den kommenden Monaten sein, wie sehr Menschen sich auch freiwillig beschränken, wie sehr sie auf – physische – Sozialkontakte verzichten, vor allem in geschlossenen Räumen. Denn je höher die Zahl der Kontaktpersonen eines Infizierten ist, desto schlechter kommen die Gesundheitsämter hinterher. „Zu Beginn der Pandemie“, sagt Ute Teichert, „hatten die Leute drei bis fünf Kontakte, jetzt sind es 20 bis 40, manchmal sogar mehrere Hundert.“
Zweitens: Die Null-Fälle-Strategie
Eine Öffnung, sagt Viola Priesemann, lasse sich bei niedrigen Fallzahlen viel besser kontrollieren als bei hohen. Stecken sich nur wenige Menschen mit Sars-CoV-2 an, könne sich jeder Einzelne wieder mehr Freiheiten erlauben. Noch mehr gilt das für eine Strategie, die auch andere Länder haben, und für die sich auch Priesemann und andere Modellierer während der ersten Corona-Welle ausgesprochen hatten: das Virus nicht nur einzudämmen, sondern es auszurotten. In Neuseeland war dieser Punkt im Juni erreicht.
Damals trat die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern vor die Mikrofone und sagte: „Wir haben in den vergangenen 17 Tagen fast 40.000 Menschen auf Covid-19 getestet, und keiner wurde positiv getestet. Wir hatten seit zwölf Tagen keinen Covid-19-Patienten im Krankenhaus.“ Eine Reporterin fragte: „Was war ihre erste Reaktion darauf?“ – Ardern: „Ich habe einen kleinen Tanz hingelegt.“
Die Regierung Neuseelands hatte zunächst wie Deutschland auf eine Eindämmung gesetzt. Dann aber schwenkte sie um. Sie zog einen notwendig gewordenen Lockdown so lange durch, bis es praktisch keine neuen Fälle mehr gab, kontrollierte alle einreisenden Menschen an der Grenze und reagierte immer dann, wenn es neue Fälle gab mit aller Härte, notfalls mit kurzen, strengen lokalen Beschränkungen.
Neuseeland ist mit dieser Strategie nicht allein. Auch Australien und viele asiatische Länder wie Taiwan, China und Vietnam haben das Virus, wenn nicht eliminiert, so doch weitgehend im Griff. In diesen Ländern gab es mehrere Erfolgsfaktoren: strenge Kontaktbeschränkungen und Stilllegungen von Bereichen des öffentlichen Lebens, eine mehr oder weniger freiwillig disziplinierte Bevölkerung, gute technische Lösungen und ein strenges Durchsetzen der Quarantäne.
In Deutschland und im Rest Europas entschied man sich im Frühjahr gegen das Ziel, die Neuinfektionen auf Null zu bringen. Der Physiker Matthias F. Schneider von der Uni Dortmund hält ein solches Vorgehen jedoch weiterhin für denkbar. Im September hatte er in einem Gastbeitrag für ZEIT ONLINE dargelegt, wie das Ziel von null Neuinfektionen erreicht werden kann.
Teil davon: Die Idee von einer Ampel
Schneider schlägt das Modell des theoretischen Physikers Yaneer Bar-Yam vor. Dieses sieht vor, dass Gebiete in grüne und rote Zonen aufgeteilt werden. Regionen, in denen der Mittelwert der Neuinfektionen unter einer bestimmten Schwelle liegt, sollen grün sein, solche mit überdurchschnittlich vielen Neuinfektionen rot. In den grünen Zonen gelten weniger Einschränkungen, in den roten Zonen mehr. Menschen aus Regionen mit überdurchschnittlich hohen Fallzahlen dürften zum Beispiel nicht in grüne Regionen einreisen. Je konsequenter die Maßnahmen in roten Regionen umgesetzt würden, desto schneller gelänge es diesen Zonen, grün zu werden. Am Ende würde sich die Regionen gegenseitig anstacheln, möglichst wenig Fälle zu haben. Man kann sich das vorstellen wie ein Wettrennen in Richtung Null.
Das Problem an der Idee: Mittlerweile sind die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland so stark gestiegen, dass der Weg zur Null weit wäre. Auch Schneider sagt, dass es derzeit eher darum gehe, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Ansonsten laufe man Gefahr, gleich in die nächste Welle zu laufen. Schaffe man es aber, die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich unter 50 zu drücken, sei die Null im Prinzip nicht mehr weit.
„Höchste Zeit, Pläne zu kommunizieren“
Doch was, wenn Menschen das Virus aus dem Ausland wieder einschleppen? Schneider hält das für ein überschätztes Problem. Bei niedrigen Infektionszahlen seien deutlich mehr Kapazitäten vorhanden, um an Grenzen Menschen zu testen. Die Beamten könnten vor allem Einreisende aus Ländern konsequent kontrollieren, in denen die Zahlen hoch sind. Natürlich könne man nicht alle Infizierten an der Grenze herausfischen. „Aber das ist nicht so dramatisch, wenn danach die nächsten Schutzschilde kommen“, sagt Schneider und verweist auf die Schweizer-Käse-Strategie des Analysten Thomas Pueyo. Mit der Vermeidung größerer Menschenmengen, Maskenpflicht und einer funktionierenden Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter habe man alles, was man brauche, um die mühsam erkämpften kleinen Zahlen langfristig zu stabilisieren.
Das klingt nicht besonders spektakulär, gibt auch der Physiker zu. Aber der Kern dieser Vorschläge ist, dass ihre Effekte nicht linear sind. Das heißt: Zieht man zwei Schutzschilde ein, dann addieren sich ihre Wirkungen nicht, sondern sie multiplizieren sich.
Drittens: Die Wellenbrecher-Strategie
Was aber, wenn es nicht funktioniert, dauerhaft sehr kleine Zahlen oder gar die Null zu erreichen? Klar scheint, dass ein halbherziges Eindämmen zu einem Auf und Ab der Infektionszahlen führt. Was wiederum die Bevölkerung verunsichert und auch der Wirtschaft schadet. Es könnte dann ein Szenario drohen, vor dem sich viele wohl am meisten fürchten: „Wenn nach einem Wellenbrecher zu früh zu viele Maßnahmen zurückgenommen werden, könnten wir schnell wieder vor dem nächsten Wellenbrecher stehen“, sagt Viola Priesemann.
Wellenbrecher werden aber nicht nur als kurzfristige Notbremse, sondern auch als Teil einer längerfristigen Strategie diskutiert. Und zwar als zeitlich befristete Lockdowns, die geplant und rechtzeitig vorher angekündigt werden, um die Fallzahlen zu senken und in Richtung Kontrolle zu drücken, damit andere Maßnahmen überhaupt erst wieder wirken können.
Die Idee: Wenn jeder Bürger und jede Bürgerin vorher wüsste, dass in zwei Wochen das öffentliche Leben für vierzehn Tage heruntergefahren wird, könnte man sich besser darauf einstellen. Womöglich ließen sich diese Maßnahmen dann auch mit den Schulferien kombinieren. Solche Bremsmanöver, schreiben die Autoren um Matt Keeling von der Universität Warwick, seien allerdings nur unter drei Bedingungen sinnvoll: Wenn die Planung dazu beiträgt, den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden niedrig zu halten. Wenn die sinkende Fallzahl genutzt wird, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und wenn die gesamte Bevölkerung mitzieht (medRxiv: Keeling et al., 2020, Preprint).
Welche Strategie die Bundesregierung am Ende auch wählen wird: Sie muss gut kommuniziert sein. Die Gesundheitspsychologin Cornelia Betsch befragt seit dem Frühjahr Menschen zu ihrem Wissen über das Sars-CoV-2 und darüber, was sie von den Maßnahmen halten. Sie sagt, es sei höchste Zeit, der Bevölkerung mögliche Pläne für die Zeit nach dem Dezember zu kommunizieren. Vor allem dürfte die Regierung den Menschen keine falschen Hoffnungen machen. Viele wünschten sich zudem, dass die Regeln möglichst einheitlich sind. Um einen langfristigen Plan zu finden und umzusetzen, hält Betsch auch eine Bürgerbeteiligung für sinnvoll.
Die Wissenschaftlerin plädiert dafür, den Menschen Handreichungen zu geben, darüber wie man sich in Situationen verhält, in denen keine strengen Regeln gelten. Zum Beispiel, was man tun soll, wenn in der Kita des eigenen Kindes ein Corona-Fall auftritt. Oder wie man die Risiken gut abwägen kann, wenn es darum geht, Freunde oder Angehörige zu besuchen.
Auf der Folie einer Präsentation, die Cornelia Betsch vor dem Gespräch schickt, stehen noch zwei Sätze: „Weihnachten ist ein sensibles Thema mit hohem Kommunikationsbedarf; Vorsicht beim Schüren von Erwartungen scheint geboten.“
