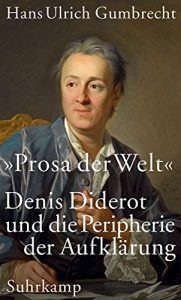 Philosoph und Übersetzer, Kritiker und Schriftsteller, Kunstagent und Enzyklopädist:
Philosoph und Übersetzer, Kritiker und Schriftsteller, Kunstagent und Enzyklopädist:
Denis Diderot, 1713 in der Champagne geboren, 1784 in Paris gestorben, war eine der prägenden Figuren jener Bewegung, die als europäische Aufklärung in die Geschichte eingegangen ist.
Doch was ist der Fluchtpunkt seines vielgestaltigen Euvre, das anders als die Werke seiner Zeitgenossen Voltaire und Rousseau, Schiller, Kant und Hume von einer geradezu zentrifugalen Dynamik gekennzeichnet ist Entlang von Szenen aus Diderots bewegtem und bewegendem Leben und in genauen Lektüren seiner Schlüsselwerke geht Hans Ulrich Gumbrecht in seinem Buch dieser Frage nach und entwickelt einen neuen Zugang zu diesem außergewöhnlichen Intellektuellen.
Worauf beruht die seltsam dauerhafte Präsenz von Denis Diderot seit über 200 Jahren, mit jeweils treuen Lesern wie derzeit Hans Magnus Enzensberger in Deutschland? Anders als Voltaire oder Rousseau, Kant und Schiller hat dieser Autor keine kurz zu benennende Hauptidee formuliert und, abgesehen von der „Enzyklopädie“, kein über das Œuvre hinausragendes Einzelwerk hinterlassen, ja nicht einmal ein klares zentrales Anliegen zu erkennen gegeben. Alles schien den Enzyklopädisten gleichermaßen zu interessieren, die Malerei seiner Epoche wie das Denkvermögen von Blinden, die Kontroverse über die Determiniertheit oder Unvorhersehbarkeit des Weltgeschehens wie die sprunghafte Empfindungswelt eines musikalischen Genies.
„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion“ ? Die Gretchenfrage stellt sich nicht erst in Goethes „Faust“, sie ist ein Motiv, das sich durch die gesamte Epoche der Aufklärung zieht, zumal der französischen. Jenseits des Rheins geriet das rationalistische Denken des Siècle des Lumières deutlich kompromissloser. Dort dominierte gleichzeitig der radikale Materialismus eines Helvétius („Vom Geist“, 1758) oder La Mettrie („Der Mensch eine Maschine“, 1748), der den Menschen zum rein mechanischen Wesen reduziert und Atheismus und Religionskritik nach sich zieht.
Als Kontrastfolie dient ihm auch hierbei das Systemdenken Hegels, der von Diderots Texten ebenso irritiert wie fasziniert war und sie unter den Begriff einer „Prosa der Welt“ brachte. Gumbrecht zeigt, wie radikal sich Diderot auf die Konkretheiten und Kontingenzen der Welt eingelassen hat, womit er ins Zentrum einer intellektuellen Peripherie gelangt ist, in die es noch andere zog: Goya zum Beispiel, aber auch Lichtenberg und Mozart. Die Denkbewegungen dieser Peripherie erreichen uns heute als die von Zeitgenossen.
Hans Ulrich Gumbrecht:
„Prosa der Welt“. Denis Diderot und die Peripherie der Aufklärung. Aus dem Englischen von Michael Bischoff
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2020.
398 Seiten 36 Euro.
