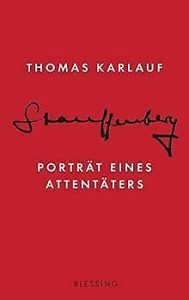Was hat Claus Schenk Graf von Stauffenberg zum Attentat auf Hitler bewogen? Eines jedenfalls steht fest: Seine Tat ist nicht zu trennen vom deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
Was hat Claus Schenk Graf von Stauffenberg zum Attentat auf Hitler bewogen? Eines jedenfalls steht fest: Seine Tat ist nicht zu trennen vom deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
Das Urteil der Deutschen über Bismarck seit 1945 ist ein Beispiel dafür, dass sich das Bild einer historischen Gestalt grundsätzlich wandeln kann. Steht uns mit dem Bild des Mannes, der beim Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 die entscheidende Rolle gespielt hat, ähnliches bevor?
Thomas Karlauf unternimmt in seiner kürzlich erschienenen Biografie, «Stauffenberg. Porträt eines Attentäters», eine Neuinterpretation und nennt den 20. Juli „ein deutsches Missverständnis“.
Die Konsequenzen aus einer Neubewertung Stauffenbergs à la Karlauf würden weitreichend sein: Der deutsche Widerstand gegen Hitler nämlich müsste grundsätzlich neu bewertet werden, die ritualisierte Form des Erinnerns überdacht, der Geschichtsunterricht zum Widerstand neu konzipiert, die Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand überarbeitet und, zu guter Letzt, müsste der Traditionserlass der Bundeswehr ergänzt werden.
Karlauf schildert Stauffenberg als Wirrkopf, als standesbewussten Vertreter des Adels und als Nationalisten, der zeit seines Lebens unter dem Eindruck des Denkens von Stefan George gestanden sei. Bis 1942 habe Stauffenberg in den aussenpolitischen Zielen mit Hitler übereingestimmt. Erst als sich die militärische Niederlage abzeichnete, habe er zur Opposition gefunden.
Wie kommt Karlauf zu dieser Einschätzung? Und trifft sie tatsächlich zu? Karlauf beruft sich auf die Quellen und einen neuen methodischen Zugang. Sein Buch versuche nicht, nach einer moralischen Motivation zu fragen, hält er fest. Er wolle auf Stauffenberg als Offizier fokussieren und neben dem Einfluss Stefan Georges die familiären Prägungen in den Blick nehmen, die den jungen Offizier geformt haben. Damit muss jede Auseinandersetzung mit Karlaufs Buch an diesen beiden Punkten ansetzen: bei der Quellendiskussion und beim methodischen Zugriff.
Im Zerrspiegel
Zunächst zur Quellenlage: Jeder Stauffenberg-Biograf steht vor dem Problem, dass sie ausgesprochen dünn ist. Zeugnisse politischen Inhalts hat seine Frau, Nina von Stauffenberg, unmittelbar nach dem 20. Juli 1944 weitgehend vernichtet. Weitere, von der Gestapo beschlagnahmte Zeugnisse sind 1944 verbrannt. Wenn Karlauf den Nachkriegszeugnissen und Briefen von Freunden und Weggefährten äusserst skeptisch begegnet, ist dies grundsätzlich angebracht. Persönliche Erinnerungen können verblassen, sie sind mitunter auf eine bestimmte Sicht hin verfasst. Zudem kann sich Erlebtes im Rückblick mit Gelesenem vermischen.
Diese Skepsis hindert Karlauf freilich nicht daran, sich über weite Strecken an den Nachkriegsaussagen von Stauffenbergs Bruder Alexander zu orientieren. Woher aber nimmt er die Gewissheit, dass dessen Aussagen mit der Sichtweise von Claus identisch sind?
Quellenkritik zählt zum Handwerkszeug des Historikers. Genau dies lässt Karlauf vermissen, wenn er ausgerechnet die «Kaltenbrunner-Berichte», einen «Zerrspiegel des 20. Juli» (Hans Rothfels), als Grundlage für die Ausführungen zu den Überlegungen Stauffenbergs unmittelbar vor dem Attentat nimmt. Dabei übersieht er, dass diese Zusammenfassung von Stauffenbergs Gedankengängen eine höchst dubiose Quelle ist. Sie basiert auf Gestapo-Verhören von Weggefährten, die sich in einer menschlichen Extremsituation befanden, und auf nicht mehr überprüfbaren, verlorengegangenen Aufzeichnungen.
Das moralische Motiv
Der zweite, nicht minder gravierende Vorwurf, den Karlauf sich gefallen lassen muss, ist derjenige, Tendenzhistorie zu schreiben, indem er Stauffenberg eine moralische Motivation völlig abspricht. Karlauf sagt explizit, es gehe ihm nicht darum, «nach einer moralischen Motivation zu fragen, die es in der uns heute selbstverständlich gewordenen, der Schreckensherrschaft des ‹Dritten Reiches› angemessenen Form bei Stauffenberg nicht gab». Wie er in Bezug auf eine moralische Motivation zu einem Ergebnis gelangen kann, wenn er gar nicht danach gefragt haben will, bleibt Karlaufs Geheimnis.
Offen bleibt auch, welche Form der heute selbstverständlichen (für wen eigentlich selbstverständlichen?) moralischen Motivation mit Blick auf die Schreckensherrschaft des «Dritten Reiches» als angemessen bezeichnet werden kann – wo doch gerade Karlauf in seiner Generalkritik am ritualisierten Gedenken an den 20. Juli die herkömmliche Erinnerungspraxis ins Visier nimmt.
Karlauf zoomt Stauffenbergs Entschluss zum Widerstand auf eine rein militärisch-politische Motivation herab. Er überhöht den Einfluss des 1933 verstorbenen Stefan George auf Stauffenberg auf ein durch die Quellen nicht gedecktes Mass und verzeichnet mit generalisierenden Bemerkungen die Rolle des Militärischen in der Weimarer Republik.
„Ein universeller Mensch“
Die Reichswehr war zu politischer Zurückhaltung verpflichtet. Daraus zu schliessen, ihre Angehörigen seien „unpolitisch“ gewesen, ist ebenso ungerechtfertigt wie die Schlussfolgerung, die „unpolitische“ Haltung der Reichswehr sei identisch gewesen mit „national“. Vom jungen Reichswehroffizier Stauffenberg wird berichtet, er habe die Mahlzeiten im Kasino jeweils mit der Lektüre der Tageszeitung beschlossen.
Wie Stauffenberg politisch gedacht hat, können wir nur aus den wenigen Zeugnissen von Weggefährten und Familienangehörigen rekonstruieren. Das ist unbefriedigend, aber in der Zeitgeschichte nichts Ungewöhnliches. Methodisch unhaltbar indes ist es, aus Mutmassungen eine Anklage zu basteln. Was wir über Stauffenberg wissen, lässt den Schluss zu, dass er eben gerade nicht als sturer Kommisskopf gesehen werden darf.
Nach dem übereinstimmenden Zeugnis von Weggefährten und Zeitzeugen war er eine charismatische, vielseitige Persönlichkeit. „Bei aller verstandesmässigen Klarheit“, hiess es sogar in einem – von Karlauf nicht herangezogenen – SS-Bericht über den 20. Juli, „war er ein Feuergeist und von faszinierender und suggestiver Wirkung auf seine Umgebung . . . ein wirklich universeller Mensch, keineswegs ein einseitiger Militär.“
Wann genau bei Stauffenberg der Entschluss gereift ist, dem Hitler-Regime aktiv ein Ende zu setzen, lässt sich nicht mit Sicherheit festlegen. Vieles spricht dafür, dass die Entscheidung während des Lazarettaufenthalts nach einer schweren Kriegsverwundung im Afrikafeldzug um Ostern 1943 gefallen ist. Wesentliche Voraussetzungen dafür sind während Stauffenbergs Dienst in der Operationsabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht seit Juni 1941 geschaffen worden. Damals verfestigte sich bei ihm die Einsicht in die Untauglichkeit der militärischen Spitzengliederung im Krieg.
Politische Verantwortung
Mit dem Satz, auch in den „authentischen Quellen“ bis August 1942 sei kein Beleg dafür zu finden, dass Stauffenberg ein Komplott gegen Hitler in Erwägung gezogen habe, zeigt sich Karlauf erstaunlich weltfremd. Offenkundig will er den Eindruck erwecken, die Vorbereitung eines ordentlichen Staatsstreichs müsse damit beginnen, einen Aktenvermerk zuhanden nachgeborener Publizisten zu verfassen und unter Verschluss der Nachwelt zu hinterlassen.
Eine zentrale Quelle, der Bericht des Majors i. G. Joachim Kuhn, dem Stauffenberg im August 1942 in einem langen Gespräch in Winniza Einblick in seine Motivlage gab, widerspricht in wesentlichen Punkten Karlaufs Grundthese. In Kuhns Bericht führt Stauffenberg glasklar die politische Verantwortung des Generalstabs, die täglichen Berichte über „die Behandlung der Bevölkerung in den besetzten Gebieten“ und „die Judenbehandlung“ als Gründe für seine Opposition an. Zudem wird die Entscheidung Hitlers, Russland anzugreifen, ausdrücklich als Fehler benannt, von dem an der Krieg „auch bei bester Führung gar nicht durchzustehen“ sei.
Der krampfhafte Versuch, aus den überlieferten Äusserungen Stauffenbergs eine bellizistische Konzeption abzuleiten, misslingt Karlauf ebenso wie die Interpretation des von Stauffenberg unmittelbar vor Kriegsausbruch überlieferten Satzes „Der Narr macht Krieg!“ – bei Karlauf mutiert er zu „Der Narr macht Krieg – ohne uns einzubinden“. Zweifellos hatte sich die Disharmonie zwischen Politik und Wehrmachtführung nach Kriegsbeginn immer weiter vergrössert, und Stauffenberg forderte, wie andere Offiziere auch, eine bessere Abstimmung. Aber die Interpretation, Stauffenberg wäre bei einer anderen Wertschätzung der Wehrmachtführung durch Hitler zu einem willfährigen Instrument der nationalsozialistischen Aussenpolitik geworden, ist durch die Quellen nicht gedeckt.
Die Treuepflicht gilt nicht mehr
Es kann auch nicht die Rede davon sein, dass sich Stauffenberg in einer Art historischer Mission als Einziger dazu ausersehen sah, Hitler zu töten. Noch im Januar 1944 hatte er auf Ewald von Kleist eingeredet, das Attentat auszuführen. Das Problem von Eid und Gehorsam war aus Sicht der Verschwörer von entscheidender Bedeutung. Für Stauffenberg bestand jedoch ebenso, wie es Hans Bernd von Haeften vor dem Volksgerichtshof für sich selbst ausgedrückt hat, keine Treuepflicht mehr, weil er Hitler als einen Vollstrecker des Bösen sah. Hitler selbst war es, der den Eid tausendfach gebrochen hatte.
Karlauf lässt eine durchgängige Quellenkritik vermissen, zieht Literatur nach Gutdünken heran, er überzeichnet den Einfluss von Stefan Georges Denken auf Stauffenberg und verzerrt das Bild des deutschen Widerstands. Dies wird besonders deutlich, wenn er im Schlusskapitel schreibt, Stauffenbergs letzter Ruf habe «Es lebe das geheiligte Deutschland» gelautet – unmittelbar bevor ihn im Bendlerblock die Schüsse des Exekutionskommandos trafen. Den Beleg dafür bleibt er schuldig. Die Zeugnisse sind nicht ganz klar. Aber es stellt eine grobe Verzeichnung dar, wenn Karlauf betont, der Schlussruf sei „nicht als Botschaft an die Nachlebenden zu verstehen, sondern als Beschwörung der Welt, aus der er kam“. Als was anderes denn als Appell ist in einer derartigen Extremsituation der letzte Ruf zu betrachten?
Wenn Karlauf einen Keil zwischen Stauffenberg und die zivil-militärischen Gruppen vom 20. Juli 1944 treibt, ist dies das Narrativ, das es ihm ermöglicht, Stauffenbergs Charakter auf die Prägung durch George zu verengen. Dafür nimmt er einen Geschichtsrevisionismus in Kauf, der nicht bei der Beurteilung Stauffenbergs haltmachen wird, sondern auf das ganze Bild des 20. Juli und die gängige Erinnerungspraxis zielt. So schärft er unfreiwillig den Blick für die Defizite der Geschichtsaufarbeitung und die offenen Fragen zum deutschen Widerstand gegen Hitler. Der 75. Jahrestag könnte ein guter Anlass sein, diese Fragen in den Blick zu nehmen.
Rechtzeitig zum Jubiläum erscheint eine neue Biografie über Stauffenberg. Bemerkenswert ist ihr Autor: Thomas Karlauf – kein Militärhistoriker, aber ein Stefan-George-Kenner.
Claus Schenk Graf von Stauffenberg an Stefan Georges Sterbebett
Wer über Stauffenberg schreibt, kann von Stefan George nicht schweigen. Es fragt sich nur: Wie viel George steckte in Stauffenberg? Wie Thomas Karlauf das Verhältnis sieht, verrät er im Prolog: Indem er 20 Seiten lang die Szene am Tessiner Sterbebett Georges schildert, an das Stauffenberg und sein Bruder Berthold im Dezember 1933 eilen. Dann folgt eine forsche Einführung, in der Karlauf erklärt:
„Ich konzentriere mich auf die wenigen authentischen Dokumente und versuche im Übrigen, die Haltung Stauffenbergs über Analogien und Indizienketten zu erschließen. Stauffenberg dürfte ähnlich gedacht haben“, heißt es dann im Text oder auch: „Vermutlich wäre Stauffenberg der gleichen Auffassung gewesen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ein solches Verfahren aus Sicht des Historikers problematisch ist.“
Zu solchen Sätzen gehört gesundes Selbstbewusstsein, fegen sie doch Jahrzehnte historischer Forschung zum militärischen Widerstand gegen Hitler beiseite. Das ist aber nur in einer Hinsicht gerechtfertigt: Es sind tatsächlich zu viele Elogen über Beteiligte und Mitwisser des 20. Juli geschrieben worden. Dabei wurde das Menschliche, auch das allzu Menschliche gerne wegpoliert.
____________________________________________________________________________
Dass Karlauf die Sekundärliteratur nicht kenne, das kann man dieser Biografie nicht vorwerfen. Karlauf kennt sie. Er ist in der Frage, was Stauffenberg und andere zu Widerständlern machte, sehr nahe bei der Ansicht jüngerer Militärhistoriker, die die Offiziers-Widerständler nicht zur weltanschaulichen Opposition gegen Hitler rechnen.
_____________________________________________________________________________
„Stauffenberg war weit davon entfernt, die drohende militärische Katastrophe als eine gerechte Strafe für die deutsche Barbarei anzusehen. Aber auch bei ihm setzte im Frühjahr 1942 ein Bewusstwerdungsprozess ein, der ihn über die soldatische Verantwortung und die Bedingungen des Krieges nachdenken ließ“.
Motiv des Stauffenbergschen Sinneswandel bleibt unklar
Als Leser aber hätte man schon gerne gewusst, wieso der charismatische Stauffenberg ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt vom Glauben an den Endsieg abfiel. Da aber ist Karlauf leider ziemlich blank. Militärgeschichte und -soziologie sind ihm nämlich fremd. Er sieht alles durch die Brille der George-Anbetung – und geht hier weiter als Stauffenberg-Biografien bisher. Stefan George ein „Dichter der Tat“, Stauffenberg sein Adept – das führt zu der These, dass es dem Attentäter nicht um den Systemwechsel ging:
„Das Ethos der Tat lässt sich weder mit politischen noch mit moralischen Kriterien angemessen beschreiben. Es kann ebenso zur Charakterisierung von Tyrannenmord wie zur Begründung von Anarchie hilfreich sein. Das Ethos der Tat sucht weder Ruhm noch Ehre, sein einziger Zweck ist die Tat um ihrer selbst willen.“
Zu den berühmten letzten Worten Stauffenbergs – „Es lebe unser heiliges Deutschland!“ – die seit Jahrzehnten in keinem Film zum 20. Juli 1944 fehlen, hält die neue Biografie auch eine eigene These parat. Sie sägt an geschichtspolitischer Symbolik, die dem Umsturz gerne beigemessen wird.
„Eines waren sie mit Sicherheit nicht: Chiffre für ein politisches Programm. Welches Deutschland auch immer Stauffenberg vor Augen stand: Sein letzter Ruf ist nicht als Botschaft an die Nachlebenden zu verstehen, sondern als Beschwörung der Welt, aus der er kam.“
Glänzend geschrieben – wissenschaftlich unbefriedigend
Ein Schluss – passend zum Unterton des Querdenkers, den Karlauf über 300 Seiten kultiviert: Sicher Sätze, die gegen das erwartbare Pathos zum 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats wappnen können. Da Karlauf glänzend schreiben kann, mag er Laien beeindrucken. Wissenschaftlich aber befriedigt seine biografische Skizze nicht: Sie tritt Stefan George breit. Der Soldat Stauffenberg bleibt ihr aber ein Rätsel – und das hilft dem Leser wenig. Aber, dies historische Kolleg vielleicht?