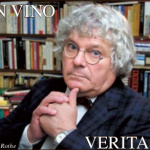 Meinungsbildung?
Meinungsbildung?
Meinungsmache?
Kritischer Journalismus?
Für uns ist das Ungehorsam!
Ist Emanzipation und
Mündigkeit zugleich!
„Wahre Worte sind nicht angenehm –
Angenehme Worte sind nicht wahr“ Laotse
Guten Tag, evangelischer Heidelberger Stadtkirchenrat zur Sitzung (KI) am 10. November 2018:
Erst einmal gelernt, den Mund aufzutun, wird Diktat durch Diskurs blamiert werden. Kritischer Journalismus sei der Tod von Dogmen und ihren (sic!) Verwaltungen, die Devisen der Aufklärung (und die der Rundschau) „sapere aude“ – „wage zu wissen“ – und „de omnibus dubium est“ – „es ist alles in Zweifel zu ziehen“ – haben die Welt auf den Kopf gestellt – und lassen Taten folgen!
Indem aber kritischer Journalismus auf Veränderung, auf Öffnung für Neues zielt, erweist sich dieser Stand auch als eine Methode der Bewahrung des Bewährten. Bewährtes nämlich bewahren wir nur, wenn wir auch darauf achten, dass Bewahrtes sich bewährt. Nicht also in der Vergangenheit leben, sondern aus der Vergangenheit, Tradition und Veränderung schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander. Wenn etwas dasselbe bleiben will, muß es anders werden. Wenn das Frühere, das Einstige, das Vertraute verweigert, was das Künftige benötigt, dann ist „nicht das Getane zu tun, sondern das Zu-Tuende“. Kritische Journalisten prüfen, scheiden, sichten, trennen, wählen, klagen an und klagen ein, beurteilen und verurteilen. Was Wunder, dass jener Journalismus, dessen Funktion Kritik ist, immer schon als zumindest unbequem empfunden wurde. Ein kritischer Journalist ist ein Störenfried, ein Zwischenrufer, ist einer, der nicht zuläßt, dass Konflikte zu eitern, sondern einer, der daran schabt und für eine sauber zuwachsende – sei es denn auch erst einmal wieder eine neue – Wunde zu sorgen versucht. Der Geist kritischer Journaille ist unheilbar, kritisches Denken ist, einmal in Gang gekommen, nicht aufzuhalten, schließt eine von manchen ersehnte Rückkehr in „vorkritische Mentalität“ aus.
Sucht oder Flucht?
Der Tag, das Tägliche ist die Domäne des Journalisten, hier ist die Zwiespältigkeit seines Wirkens zu suchen. Was wird, tritt nicht ohne Verlust ein. Ohne Bereitschaft zur Trennung aber bleibt Entwicklung aus. „Der“ Journalist hat eine Vorliebe für das Neue, das er mit detektivischer Witterung aufspürt. Soll, was er berichtet, Information heißen, dann darf es möglichst nicht bereits bekannt sein.
Was aber wäre das: Das absolut Neue? Knüpft nicht Neues immer auch an Altes an? Wie ist die Beunruhigung, die Verunsicherung zu erklären, welche manche Information, also die Kundgabe einer Neuigkeit, wie ein Schatten zu begleiten pflegt? Das Neue: derweil sie bei einem eine Sucht bewirkt, schlägt sie andere in die Flucht.
In der Tat erreicht Information auch dunkle Schichten, ist sie doch Wissen, das auch auf Unbewußtes trifft. Sie ist Enthüllung, Aufdeckung, Offenbarung.
Und wir – die Heidelberger Neue Rundschau?
Rundschau, das bedeutet für uns Entlarvung, Enttarnung durch Information und Kommentar. Information ist kein harmloser Vorgang. Sie kann, wie die Geburt, mit Wehen verbunden sein. Sie bringt etwas an den Tag, Verstecktes oder Verkanntes, Ungewolltes oder Ungewohntes. Sie kann einen Vorhang zerreißen, rücksichtslos ein neues Kapitel aufschlagen, obgleich man doch noch am alten hing, und so einen heftigen Widerstand erzeugen. Ihre Wirkung ist bei jedem Empfänger verschieden. Jeder reagiert anders, mit einem unterschiedlichen Vorrat an Voreinstellungen.
Information ist nicht gradlinig oder gar eindeutig, sie wird immer beeinflußt, umgeleitet, verbogen, überfremdet, gesteigert, ergänzt, verkürzt.
Den Menschen, manchen Lesern sowie einigen Oberkirchenräten eignet eine merkwürdige Neigung zur Verschlossenheit und Verheimlichung. Sie schauen blinzelnd ins Licht der Welt und suchen gern Unterschlupf im Halbdunkel, im Dämmerschein, im Mutterschoß.
Es ist wohl so, wie Bertrand Russel einmal meinte: „Der Mensch fürchtet das Wissen viel mehr als das Nichtwissen“. Information – vom Kommentar zu schweigen – kann doch auch als eine Attacke auf unsere Bequemlichkeit einherkommen, als Hinweis auf unsere Beschränktheit, als Nötigung zur Auseinandersetzung.
Lassen wir doch Information für etwas mehr Wissen, für etwas weniger Unwissen sorgen, lassen wir sie gegen den Hang protegieren, den Kopf in den Sand zu stecken, für eine Tendenz der Aufgeschlossenheit, der Transparenz, der Offen- der Bloßlegung.
Wichtigmacher? Wichtigtuer?
Aber ja doch, wir Journalisten sind Wichtigmacher. Das ist – es war einmal – jedenfalls sein Beruf.
Aber trotz unbestrittener Meriten unserer Publizistik scheint sie derzeit auch ein Nährboden für Wichtigtuer zu sein. Ein Trend der Bevorzugung, der Begünstigung der geläufigen, der gefälligen, der attraktiven oder sensationellen, eben der am besten zu verkaufenden Information ist zu beklagen. Information, von Haus aus im Dienst des Wahren, ist in die Nähe der Ware gerückt: Kommerzialisiertes Denken verleitet manche Journalisten ebenso wie Politiker, mit der Mehrheit zu liebäugeln, statt nach der Wahrheit Ausschau zu halten. Journalistik ist ihrer Natur nach ein Medium des Interessanten. Aber sie ist in höchster Gefahr, zu einem Instrument von Interessen zu verkommen. Wenn sie nicht mehr die „res publica“ im Sinn hat, verkommt sie:
Zu public relations, zum PR!
Gewiß, Informationen lassen sich nicht mehr ganz leicht unterschlagen, die wir lange schon in der „HEIDELBERGER RUNDSCHAU“ mit der nunmehr und schon lange nicht mehr „Neuen“ Rundschau vehement und ungeschönt unter die Leute zu bringen versuchen – und keineswegs nur in der Kolumne „in vino veritas“ als Wahrheit bis hin zur streitbar-scharfen Polemik.
Wir meinen, dass providenziert – pardon: provoziert werden müsse. Und tun es …
und nehmen in Kauf, hin und wieder auch mal falsch verstanden zu werden. Mit den Mitteln aber der Dosierung und der Akzentuierung, der Zu- statt der Mitteilung kann man jedoch ihre Wirkungen fast unmerklich dirigieren. Und mit diesen Mitteln bekommt die geschönte, die schonende, die angenehme, die gern vernommene, die vertraute, rasch verdaute Information, die zu Selbstkritik und Selbstkorrektur dienende Wirkung, die zu Um- und Ausbau unseres Weltbildes zur Entfaltung eines zukunftsgerechten Denkens einlädt. Unangepasste Information mutet uns die Einsicht zu, dass wir nicht mehr in einer Konsens-, sondern in einer Konfliktwelt leben.
Und die, die verlangt nun mal
neue Umgangsformen.
Tut sie das? Tut sie: So!
Leitgedanken der Aufklärung
Zum Beispiel: Toleranz und Weltbürgertum – das sind zwei Leitgedanken der Aufklärung, die oft verpönt worden sind. Sie stimmen überein mit dem Effekt, der eintritt, wenn Informationen frank und frei ihren Lauf nehmen können. Durch – und erst recht durch unbequeme – Informationen werden Trennwände porös, und es kann eine Bereitschaft heranreifen, dem Anderen, dem Fremden, dem anormal erscheinenden, ja dem Gegner und allem, was sich jenseits der Trennwände abspielt, ein wenig gerecht zu werden, also dem Unverstandenen sein Recht zu geben. Vielleicht ist die vornehmste journalistische Aufgabe, Informationen so zum Adressaten gelangen zu lassen, dass er beginnen kann, das Andere, das Fremde, das anormal erscheinende, ja das Gegnerische von dessen eigenen Voraussetzungen her zu verstehen und sogar zu vertreten.
Zwischen Sprache und Wirklichkeit
Welche Aufgaben sollten denn nun eigentlich Zeitungen, sollen heute Medien erfüllen? Karl Kraus schon nahm wie kein anderer den Vorgang wahr, wie vor seinen Augen das erste Massenmedium, die Tagespresse, sich zwischen Sprache und Wirklichkeit schob, wie das Surrogat sich als Dichtung und Wahrheit aufbläht. Kraus zieht aus dem Anspruch die Konsequenz: Er nimmt die Zeitung beim Wort und haut es ihr um die Ohren. Wenngleich heutzutage (da sind wir lieber altmodisch) polemische Feldzüge insofern schon unmöglich scheinen, als der Unterschied zwischen öffentlicher und privater Person nicht mehr gemacht wird, bleiben wir erst recht und dennoch dabei: Nur wer sich mit der zynischen Spießerweisheit zufrieden gibt, Politik werde von Schuften, Presse von Schmierfinken und Lügnern gemacht, bleibe zufrieden hinterm Ofen sitzen. Wenn aber auch nur Einer bei diesen stillen Übereinkünften nicht mitmacht, es wasche doch ohnehin eine Hand die andere, und wenn alle mitmachten, falle es keinem auf: Und die Medien, diese anfälligen Treffpunkte von Phrase und Geschäft mit (ja, das meinen wir!) raffinierter Naivität und ständig begleitende Grille des Pinocchio am moralischen und sprachlichen Standard des bürgerlichen Kulturerbes messen – dann wird es kritisch.
Pressefreiheit
Es ist ein Teil der deutschen Tradition, ein Wort wie Freiheit nicht für sich allein stehen zu lassen. Ruft da einer „Freiheit!“, schon gesellt ein anderer „Ordnung!“ dazu; wer da klug ist, redet gleich von „Freiheit und Verantwortung“ oder preist die Freiheit, warnt jedoch im gleichen Atemzug vor ihrem Missbrauch.
Diese Angst vor der Freiheit, der Verdacht, dass sie gar zu leicht zu Anarchie und Zügellosigkeit entarte, trifft merkwürdigerweise nur die friedsamen Anhänger des Rechtsstaates. Ihnen gilt die Obsorge unseres demokratischen Obrigkeitsstaates, der alles reglementiert, vom Autogurt über den Führerschein bis zum Ladenschluss, Freiheit in Festreden großzügig austeilt, in der Praxis aber allenfalls häppchenweise.
Ein besonderer Argwohn der machthabenden ordnungsamtrigen Beamten hat – was Wunder – schon immer der Pressefreiheit gegolten, weil sie deren Wahrnehmungen am stärksten zu fürchten haben. In den Anfangsjahren der Bundesrepublik hatte das Bundesverfassungsgericht einiges dazu getan, die Presse- und Informationsfreiheit zu sichern. Inzwischen nähern wir uns einem Zustand, in dem die Journalisten als Stand von steuerlichem Entgegenkommen bis hin zum Zeugnisverweigerungsrecht privilegiert werden, aber – nicht nur aber auch dafür steht etwa der „Lauschangriff“ – außer Stand gesetzt werden könnten, ihrem kritischen Auftrag noch nachzugehen.
Ach, wie doch das beruhigt:
Eine Kontrolle der Presse wird lückenhaft bleiben. Zur Erzeugung von Misstrauen nämlich müßten Staat, Kirche und andere Institutionen das Prinzip der Begegnung selbst zu fassen bekommen, jenen Funken, der Achilles in Bewegung setzte, wo Patroklos nichts zu erwarten wagte. Dieser rasende Eros dann überrascht die, die er erfaßt und läßt etablierten Machthabern, Kirchenoberen und Oberlehrern keine Ruhe. Das hat, merkt Jürgen Gottschling fröhlichen Herzens an – einiges für sich. Dass nämlich gegen die „guten“ Sitten verstoßen und für Ärger muss gesorgt werden dürfen.
Und, zu guter Letzt – dass die „Neue Rundschau“ sich auch künftig als Hort der Subversion verstehen und behaupten wird, das garantieren wir: So lange wir – mit Lust ohne Frust – dies noch wollen und oder noch können.
Zur (die wir hier jedenfalls noch für einige Zeit dazu zu machen gedenken) Sache:
Unabdingbarer Neubau des Kirchenmusikalischen Instituts!
Marginalien eines Treffens: Oberkirchenrat Matthias Kreplin (“ … es gibt keine Alternativstandorte für das geplante Bauvorhaben im ehemaligen Herrengarten hinter der Providenzkirche“) mit einigen mehr oder weniger ausgewählten Gemeinderäten:
Als einziger Lokalpolitiker plädiert lediglich Matthias Kutsch (CDU) für einen Plan B“, auch Stadtrat Arnulf Weiler-Lorenz stellt kritische Fragen: „Ist es das wert?“ – Oder: „Wäre nicht eine Alternative besser?“ Derweil erklärt Hans-M. Mumm von der Grün-Alternativen Liste (RNZ): „von vornherein gegen einen Park zu sein“.
Kathegorisch: Oberkirchenrat Matthias Kreplin wird von Micha Hörnle ebenda so zitiert: Alternativstandorte für die Hochschule für Kirchenmusik gebe es nicht: Man brauche die direkte Anbindung an eine Gemeinde, eine zentrale Lage und die Nähe zu den beiden Altstadtkirchen. Warum dem so sei, erzählt der Kirchenrat nicht.
Hingegen erfahren wir direkt unter Micha Hörnles Beitrag mit der Überschrift „Stadträte geben der Kirche wenig Contra“ auf der gleichen RNZ-Seite von Denis Schnur „Die Stadt wird wieder jünger – das Semester hat begonnen“, dass sich nunmehr „Mehr als 38 000 Studenten“ in Heidelberg tummeln werden.
Nicht natürlich auch nur ein Bruchteil von sovielen „Studierenden“ – das meinen wir auch – paßt natürlich in den „Altbau des KI“ in der Weststadt. Erfahren dann aber weiter in der RNZ (wir können – und wollen – ja schließlich nicht überall dabei sein): „Das wohl kleinste höhere Lehrinstitut der Stadt bleibt aber die Hochschule für Kirchenmusik. Deren Studentenzahl reduziert sich trotz der sechs Studienanfänger von 50 auf 45 Immatrikulierte.“ – Soweit die RNZ, aber das konnte der Oberkirchenrat Kreplin ja vielleicht gar nicht wissen, der kommt ja aus Karlsruhe und liest dort die BNN. Und das, das weiß er ja vielleicht auch nicht! Soll er doch mal, zusammen mit Prof. Stegmann – er habe das Wort: einen Rundgang durch das KI machen!
Wir haben einen gemacht – und bleiben dran!
Was allerdings gar nicht so einfach geht:
Aber, versprochen ist versprochen: Nachdem die Amtskirchler offenbar Herrn Finze gebeten haben, den von Klaus Hekking (CDU) und Arnulf Weiler-Lorenz (Bunte Linke) initiierten gut besuchten Bürgerdialog im Cafe Schafheutle zum Thema „Providenz“ und so weiter nicht nur zu besuchen, sondern auch darüber zu berichten (letzteres vermute ich, jedenfalls schrieb er eifrig mit, wohl auch, als ich auf diesen obigen Rundgang durch das KI mit dem ehemaligen Rektor des KI, Kirchen-Musik-Direktor Prof. Stegmann hinwies), wurde für- und vorsorglich und von wem auch immer die gesamte Homepage des Kirchenmusikalischen Instituts vom Netz genommen …
Damit allerdings, dass ich damit gerechnet habe, haben die Herren
und Damen von der „Amtskirche“ offenkundig nicht gerechnet.
Ich habe vorgebeugt, das ganze kopiert und jetzt steht der Rundgang, der deutlich macht, wie nicht marode und wie nicht baufällig dies Institut wirklich ist, wieder zur Verfügung. Ab nämlich genau jetzt funktioniert der Link wieder. Und zwar über Youtube. Und da hat auch Amtskirche nicht so hurtig Zugriff zum Wegschalten!
Dummgelaufen, gell?
Sie sehen, wir bleiben wirklich dran. Und meinen, dass es den 45 „Studierenden“ auch künftighin dort
nicht wirklich nicht gut gut gehen wird, wenn sie bleiben dürfen, wo sie derzeit sind!
Ach ja – ich bin mal gefragt worden, ob ich nicht gelernt hätte,
Information und Kommentar zu trennen.
Ich aber sage Euch, ich habe das sehr wohl gelernt
aber: Die Rundschau i s t Kommentar!
Hier, wie auch versprochen:
„Heidelberger Neueste Nachrichten“ – „Heidelberger Anzeiger“
Dienstag, 25. September 1934 Seite 3
____________________________________________________________________
Der Herrengarten. Der älteste Garten Heidelbergs
Auf ein eigenartiges Jubiläum kann in diesem Jahr
vermutlich der Heidelberger H e r r e n g a r t e n zurückblicken,
auf sein 550jähriges Bestehen, und da dieser Garten zum Teil heute noch vorhanden ist, haben wir es mit dem ältesten Garten Heidelbergs zu tun. Freilich ist es nur noch ein Teil, der aus dem früheren großen Herrengarten uns erhalten blieb. Es ist jener Park, der hinter der Providenzkirche eingebettet liegt zwischen der Karl-Ludwig.Straße, der Landfriedstraße und der Friedrichstraße. Heute noch schauen Zeigen einstiger Herrlichkeit heraus
über die alten Mauer, ein zierlicher Brunnen, ein mächtiger Gingko, alte Eiben und Lebensbäume. Doch aus der Zeit der Anlage des Herrengartens dürfte außer dem Brunnen vielleicht nicht mehr allzuviel vorhanden sein.
Der eigentliche Herrengarten ist zur Zeit des Kurfürsten Ruprecht I. entstanden, und seine Anfänge reichen in jene Zeit zurück, als König Wenzel seinen großen Reichstag in Heidelberg abgehalten hat, der am 25 Juli 1384 stattfand. Er hatte den Zweck, dem drohenden Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den Fürsten und Herren einerseits und den Städten andererseits vorzubeugen.
Dieser alte Hofgarten bedurfte zur Anlage ein ganzes Jahr, denn er eichte (zwischen Plöck und Haupstraße) von der Märzgasse bis zum ehemaligen Kapuzinerkloster.
Der Herrengarten diente zunächst zur Abhaltung der festlichen Turniere. Mehr als zwei Jahrhunderte diente dieser Garten für derartige Veranstaltungen.
„Anno 1481 ward unter Churfürsten Philipsen ein Turnier gehalten von der rheinischen Ritterschaft, bei welchem viel Chur und Fürsten, Graffen und Herren mit 4000 Pferdten ganz prächtig erschienen.“
Weiter heißt es: „Anno 1524 ward von Pfalzgrafen Ludwig V. ein stattlich Stalschießen verübet, dem in die 16 Chur und Fürsten, geistlich und weltlich in der Person beygewonet.“
Den Herrengarten mit Baumanlagen, mit Brunnen- und Wasserkünstenanlagen schuf in der Haupsache aber Kurfürst Ludwig VI. Schon 1582 finden wir schöne Wasserkünste, Pomeranzen und Feigenbäume im freien Lande ausgepflanzt. Metzger sagt, sie wären in solcher Größe und Schönheit vorhanden gewesen, wie in Italien nicht besser. Diese Gewächse wurden im Herbst mit Holzhäusern überbaut, deren Inneres mit Oefen versehen, so daß geheizt werden konnte. Im Frühjahr, wenn keine nennenswerten Fröste mehr zu erwarten waren, wurden die Häuser wieder entfernt. Die Rennbahn und der Turnierplatz standen da, wo sich heute die Providenzkirche erhebt. Durch die Schöpfung des „Hortus Palatinuns“ , 1612 beginnend, wurde der Herrengarten mancher Pracht entkleidet. Leider hat der Garten dann im Dreißigjährigen Krieg sehr gelitten. Gänzlich zerstört wurde er aber im Orlean-Krieg1608 und 1603.
Als Kurfürst Karl Theodor die Heidelberger Seidenindustrie auf hohe Stufe stellte, was gegen 1770 der Fall war, da wurde der Herrengarten mit Maulbeeren bepflanzt. Es waren 170 Züchter, die ihre Ware an die Nigalsche Seidenfabrik zu liefern hatten. Durch die Mißgunst vieler, dann aber auch wegen zu geringer Vergütung wurden aber viele Bäume wieder vernichtet. Sie fielen zum Teil der erbosten Menge in die Hände, die die Bäume einfach abhackten.
Gartendirektor Metzger pflanzte auch diesen Garten zu Beginn des letzten Jahrhunderts neu, doch sind heute noch wertvolle Gewächse aus früheren Jahrhundert noch erhalten.
Heidelberg soll alles versuchen, diesen heute in Privatbesitz stehenden Herrengarten uns zu erhalten. Das ginge am einfachsten, wenn der Besitzer diese historische Stätte der Öffentlichkeit als öffentlichen Garten zur Verfügung stellen würde. – r –
Artikel aus dem Archiv der Conditorei Schafheutle im Original: 1934
