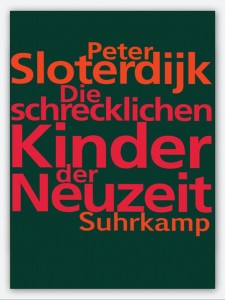Was treibt die Menschheit voran? Entwickelt sie sich von Niederem zu Höherem? Orientiert sich Fortschritt an Lehren aus der Geschichte? Ist Geschichte als Progression der und in der Freiheit zu begreifen?
Hören wir auf Peter Sloterdijk, besteht unsere Gesellschaft aus traditionslosen Gespenstern, die Moden hinterherjagen. Eine kritische Lektüre seines neuen Buchs „Die schrecklichen Kinder der Neuzeit“. Peter Sloterdijk ist (ja, ist) bekannt für seine gesellschaftskritischen Thesen – und durch zahlreiche Medienauftritte. Unter anderem moderierte er eine Gesprächsrunde im Fernsehen mit dem Titel „Das philosophische Quartett“. Nun legt er in seinem neuen Werk „Die schrecklichen Kinder der Neuzeit“ eine düstere Diagnose unseres Zeitalters vor. Im Gegensatz zum vormodernen Zeitalter verliefen Generationswechsel in der Neuzeit weitgehend ohne die Weitergabe von Traditionen, das Gegenwärtige und Zukünftige habe sich „von der Deckung durch Herkunftsbestände losgemacht“, lautet eine seiner Thesen.
Will heißen: Generationswechsel stellen Brüche dar, Diskontinuitäten, die Menschen wären laut Sloterdijk geschichtslos. Statt sich an den Denkmustern und Werten der Altvorderen zu orientieren, folgten die „Kinder der Neuzeit“ Moden und flüchtigen Trends. Ihrem Leben fehlte Halt und die Sicherheit, die ihnen einst die Familie, der Stand gaben – Improvisation dringe in all das ein, was „ständisch und stehend zu sein schien“: von Geschäfts- oder erotischen Beziehungen, über Reisen hin zu religiösen Praktiken.
Islamisten als Trendsurfer?
Wortgewaltig kommt Peter Sloterdijk einher, seine Thesen und historischen Exkurse schmücken viele Bilder und Fremdwörter. Viele Eindrücke, die Sloterdijk von der modernen Gesellschaft zu haben scheint, lassen sich teilen: dass nämlich Politik mehr repariert denn gestaltet, dass wir in einem von der Realwirtschaft fast abgekoppelten und von Logik weitgehend befreiten Finanzsystem leben, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Probleme nicht gelöst, sondern vertagt werden. Problematisch ist aber, dass Sloterdijk kaum relativiert.
Der Autor schildert die Kehrseite des westlich-liberalen Zivilisationsmodells mit seinem Wert der individuellen Freiheit, das sich ihm zufolge mehr oder weniger weltweit durchgesetzt hat. Die Freiheit der Wahl ist ihm besonders ein Dorn im Auge, öffnet sie doch Tür und Tor zur Beliebigkeit. Als die „wenigen Kulturen, die bis heute wiedererkennbar durch die Jahrtausende drifteten“ und noch in ihren Grundmustern erhalten seien, nennt er „die chinesische und die jüdische Kultur“, „Linien des Hinduismus“ und „in eingeschränkter Form die katholische Kirche“. Doch fallen nicht bei der generalisierten Argumentation Sloterdijks Zivilisationsmodelle buddhistischer Mönche in Bhutan, indigener Völker im Andenhochland oder islamistischer Strömungen im Nahen Osten durch den Rost? Denken wir mal weiter mit Sloterdijk: Wäre dann nicht auch der islamische Fundamentalismus eine Modeerscheinung? Das mag aus westlicher Sicht einleuchten. Ein islamischer Fundamentalist aber würde den Gedanken weit von sich weisen, sieht er sich doch als Wahrer einer jahrhundertealten Tradition.
Wenn wir „Westler“ so traditions- und kulturvergessen wären, wie Sloterdijk meint, wenn in modernen Gesellschaften die Traditionsfäden weitgehend abgerissen sind, warum können wir heute überhaupt Kulturkreise unterscheiden? Wie sollten wir zu derlei Differenzierung im Stande sein, uns als Deutscher oder Italiener, nicht aber als Norweger zu sehen? Das fragt man sich nach der Lektüre. Und würde dann lieber nicht gefragt haben …
Aber warum? Geht nicht dem Bruch von Normen und Denkmustern der Vorgängergeneration eine bewusste Auseinandersetzung mit ihnen voraus? Ist das Umstürzen des alten nicht eine andere Form der Wahrung von Kontinuität? Ist die Negation nicht gleichzeitig eine Form des Anknüpfens an das Vergangene, an die „Herkunftsbestände“? Und was ist von dieser These zu halten, wenn man sich vor Augen führt, dass der Bruch mit den Werten der Elterngeneration oft mit der Rückbesinnung auf genau die Werte einhergeht, von denen sich die Eltern einst distanzierten. Dass der Schritt vorwärts oft mit der Rolle rückwärts beginnt? Vielleicht sind die Kinder der 68er Generation ein Beispiel, deren Eltern feste Bindungen verschmähten, die nun ihrerseits Monogamie propagieren.
Zur Freiheit verdammt
Sloterdijk beschreibt das liberale Zivilisationsmodell mit seinem – das wir gerne mitsingen – Loblied auf die individuelle Freiheit nicht als Errungenschaft der Französischen Revolution. Sondern spricht von dem „Klima der Desorientierung“, in dem das „Pathos der Wahlfreiheit“ am besten gedeihe. Er zitiert Jean-Paul Sartre und macht ihn zum Zeugen der Anklage: Der Mensch ist dazu verdammt, frei zu sein. Das Problem: Sartres Mensch ist vor allem deshalb zur Freiheit verdammt, weil er keine andere Wahl hat, als frei zu sein und ein Mensch, dem Wahlfreiheit zugestanden wird, auch Verantwortung für sein Handeln trägt, schuldfähig ist. Sartre bewertet seine Philosophie der Freiheit aber als positiv, er versteht den Existentialismus als Humanismus. Sloterdijk meint etwas anderes: Freiheit als möglicher Irrweg zu dem Preis völliger Desorientierung. Einen Preis, den aber viele, die weltweit für Demokratie und Menschenrechte ihr Leben riskieren, gerne zu zahlen bereit sind! Menschen haben immer wieder – glücklicherweise – von ihrer Freiheit Gebrauch gemacht, mit den Wahrheiten und Werten vergangener Generationen zu brechen: Sonst wären Völkermorde nie aufgearbeitet worden, hätten wissenschaftlicher Fortschritt und Emanzipation nicht stattfinden können, besäßen wir heute noch das Ptolemäische Weltbild.
Erschienen: 06. Juli.2015
suhrkamp taschenbuch 4603, Broschur, 489 Seiten
ISBN: 978-3-518-46603-2
D: 12,00 €
A: 12,40 €
CH: 17,90 sFr
Was andere meinen:
»Fazit, dieses Buch hat es in sich.«
»Sloterdijks Ironien sind allseitig, sie richten sich gegen die Denkzumutungen der Theologie ebenso wie gegen die Monstrositäten geschichtsphilosophischer Beglückung. Dank dieser Freiheit im Schreiben kommt Peter Sloterdijk der augenblicklichen Verunsicherung so nah wie sonst kein anderer Philosoph.« Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung
»Seine frei schwebende Intelligenz macht enorm viel Spass. Er lockt, spekuliert, jongliert. Das ist großes Entertainment. Sehr gute Unterhaltung« Christine Richard, Basler Zeitung