Wilde Wiesen. So ein Buchtitel klingt natürlich programmatisch. Er klingt nach dem Paradies des Ungeregelten. Nach den Gärten der Kindheit. Und es gibt sie auch in dem neuen Buch von Ulf Erdmann Ziegler. Aber sie sind alles andere als wild. „Der Garten meiner Kindheit war ein Handtuchgrundstück auf dem holsteinischen Geestrücken, einer sandigen Ebene, gerahmt von anderen Kindheitsgärten gleichen Schnitts in einer Siedlung gleichen Schnitts … ein offenes Feld, das nach Kompass bebaut worden war …“ Geregelter und trostloser geht es eigentlich kaum.
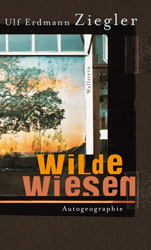
Die Desillusionierung, mit der man in diesem Buch konfrontiert wird, ist Programm. Doch dazu später. Immerhin lässt sich an dem Abschnitt aber auch schon ablesen, warum das neue Buch des 1959 geborenen Ziegler, von Beruf Kunstkritiker, Autogeographie untertitelt ist. Der spät berufene Autor, der im vergangenen Jahr mit seinem Roman-Debüt Hamburger Hochbahn auf sich aufmerksam machte, scheut ganz offenbar die klassische „Autobiographie“. Mit 48 Jahren wäre das vielleicht auch etwas früh. Trotzdem spürt er die Last dieses Materials, ohne dessen Aufarbeitung der Sprung in die andere Welt des literarischen Schreibens wohl doch nicht zu gelingen scheint. Da macht selbst ein so erfahrener Autor wie Ziegler keine Ausnahme.
Was macht der Mann also? Er zieht sich aus der Schlinge der Genrefalle, indem er das erwartbare Material anders arrangiert als normal. Ziegler erzählt nicht die übliche Wo-komme-ich-her-Geschichte. Obwohl man den Weg aus der schleswig-holsteinischen Provinz über den Bodensee bis nach Berlin schon gut verfolgen kann. Ihm geht es um eine symptomatische Vermessung der Kindheit. Ziegler verlässt sich nicht auf die selbsterklärende Kraft des Chronologischen. Er konstruiert ein Kaleidoskop.
Wenn sich an den Stationen, die Ziegler dafür auswählt, etwas auffällt, dann ist es das Periphere. Wer seine Kapitel mit Einfeld, Orschel-Hagen und Tungendorf übertitelt, von dem lässt sich ohne großes Risiko behaupten, dass es ihm um die Provinz geht, um Provinz als Lebensform oder zumindest als Prägestempel. Eine Heldengeschichte, die in der Metropole gipfelt, wird man in diesem Buch nicht finden. Denn selbst im gefährlichen Westberlin, in dem Ziegler zum Schluss landet, fühlt er sich, als sei er „an den Rand der Welt gezogen“. Doch Peripherie ist hier auch eine innere Kategorie. Was Ziegler am eigenen Beispiel beschreibt, ist eine Art postheroische Generation West im Schatten von 1968 in einem Land wie einer Vakuumkammer. Da verschwimmen selbst so aufregende Etappen wie der erste Parka oder der erste Sex im Nebel des Alltäglichen, Beiläufigen und Unentschiedenen.
In einer frühen Phase meint der junge Pubertierende sich zwischen RAF und Hitler entscheiden zu müssen. Am Schluss landet er dann bei den Jesus-People. Doch auch wenn er sich mitunter solchen Gemeinschaften zuordnet, bleibt Zieglers Generation eine Generation ohne Eigenschaften, seltsam ambitionslos, ohne ein brennendes Verlangen. Selbst als er später in der Stadt landet, die gleichbedeutend war mit dem „Neinsagen“ – Westberlin – kommt einem der inzwischen vierundzwanzigjährige Protagonist immer noch vor wie der kleine Junge, der in seiner Heimatstadt Neumünster im apfelsinenfarbenen Regencape auf dem Busbahnhof steht und darauf wartet, „dass die Zeit vorbeiginge“.
Ob es nun um den Zustand der Seele geht, oder um die Topologie der Kindheit. Immer wieder hält Ziegler sie mit kartographischer Präzision fest. Nicht realistisch, sondern mit einer Genauigkeit, die ins Malerische umschlägt und nachhaltige Bilder ins Gedächtnis brennt: „Der Garten meiner Kindheit war hellgrau, nicht ein einziges Hellgrau, sondern mausgrau und silbergrau und weiß überstrahlt, so wie auf dem kleinen Querformat im Familienalbum, das mich auf einem Sommerrasen liegend zeigt, ein Bein zum Himmel gestreckt wie ein Ausrufungszeichen, mein Flachshaar fast durchsichtig und mein reines Gesicht konzentriert auf etwas, das man in der Fotografie nicht sieht … „. Der Hang zum Manieristischen, der in seinem Debüt oft funktionslos wirkte, wird in eigener Sache zur Qualität. Zieglers neues Werk ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man aus dem Unscheinbaren ästhetische Funken schlagen kann, die zugleich immer selbstreflexiv auf den Erzähler zurückstrahlen.
Ziegler geht es in Wilde Wiesen weder um ein Loblied der Provinz, noch um das ausgestellte Leiden an ihr. Sein Buch ist keine nachgetragene Begründung einer Ambition, die erst in der fanalartigen Absage an die Provinz reifen konnte. Zwar fährt sein Protagonist schon als kleiner Junge mit dem Fahrrad durch Neumünster, „träumend von etwas Bedeutendem, das keine Gestalt annehmen wollte“. Doch es kommt einem nicht so vor, dass der Mann, der dann vom Zivi bis zur Fotografenausbildung dann doch nur denkbar unaufregende Lebensstationen absolviert, richtig unglücklich wäre. Er hat genug damit zu tun, sich illusionslos durch die wilden Wiesen zu schlagen, die unser aller Normalfall darstellen – das Dickicht der Normalität. Jürgen Gottschling
Ulf Erdmann Ziegler Wilde Wiesen. Autogeographie. Wallstein, Göttingen 2007, 154 S., 18 €