Es ist nun einmal so: Das Gegenteil des Profis ist der Dilettant, der Laie oder der Amateur, auf gut Deutsch: der Liebhaber. Der Amateur liebt seinen Gegenstand, aber er geht nicht professionell mit ihm um, sonst wäre er kein Amateur, sondern eben ein Profi. Wo dieser Gegenstand die Literatur ist, gewinnt man jedoch zunehmend den Eindruck, dass auch das Umgekehrte gilt: Der Profi geht professionell mit ihr um, aber er liebt sie nicht. Das bekannte Lied Georg Kreislers vom Musikkritiker, der maßlos leidet, wenn er in Konzerte gehen muss, enthält bei aller satirischen Übertreibung einen wahren Kern. Der Überdruss an der zum Beruf gemachten Liebhaberei übertrifft nicht selten den Genuss.
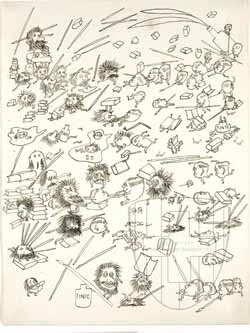 Es häufen sich in Wissenschaft und Journalismus die Literaturprofis, denen Literatur lediglich die Grundlage für eine Karriere bedeutet, die jeder andere Gegenstand ebenso gut ermöglichen könnte, oder denen die Anhäufung von Wissen, die Aura der Gelehrsamkeit ausreicht, die aber keinerlei erotische Beziehung zu ihrem Gegenstand haben. Ohne Erotik freilich kein Liebhaber. Man merkt es vielen literaturwissenschaftlichen Arbeiten und vielen Literaturkritiken an, dass ihre Autoren nicht aus Neigung, sondern aus Notwendigkeiten welcher Art auch immer niederschrieben, was den Leser wohl kaum zum Lesen dessen verführen wird, wovon sie handeln. Die „weißen Flecken“ der Forschung, deren Füllung zu einer Habilitation und womöglich zu einer Professur verhilft, sind häufiger Motive für die wissenschaftliche Beschäftigung mit einem Autor oder einem Werk als die Leidenschaft. Schon bei der Wahl einer literaturwissenschaftlichen Studienrichtung gelangt der Beobachter des öfteren zur Überzeugung, dass alles Mögliche, etwa der Wunsch, einen Beruf zu erlernen, entscheidend war, nur nicht Interesse für oder gar Liebe zur Literatur.
Es häufen sich in Wissenschaft und Journalismus die Literaturprofis, denen Literatur lediglich die Grundlage für eine Karriere bedeutet, die jeder andere Gegenstand ebenso gut ermöglichen könnte, oder denen die Anhäufung von Wissen, die Aura der Gelehrsamkeit ausreicht, die aber keinerlei erotische Beziehung zu ihrem Gegenstand haben. Ohne Erotik freilich kein Liebhaber. Man merkt es vielen literaturwissenschaftlichen Arbeiten und vielen Literaturkritiken an, dass ihre Autoren nicht aus Neigung, sondern aus Notwendigkeiten welcher Art auch immer niederschrieben, was den Leser wohl kaum zum Lesen dessen verführen wird, wovon sie handeln. Die „weißen Flecken“ der Forschung, deren Füllung zu einer Habilitation und womöglich zu einer Professur verhilft, sind häufiger Motive für die wissenschaftliche Beschäftigung mit einem Autor oder einem Werk als die Leidenschaft. Schon bei der Wahl einer literaturwissenschaftlichen Studienrichtung gelangt der Beobachter des öfteren zur Überzeugung, dass alles Mögliche, etwa der Wunsch, einen Beruf zu erlernen, entscheidend war, nur nicht Interesse für oder gar Liebe zur Literatur.
Der Literaturwissenschaftler oder Literaturkritiker, der niemals ein Theater oder gar eine Oper, ein Konzert, ein Kino besucht, ist keineswegs die Ausnahme. Seine Begeisterung gilt weit eher einer günstigen Immobilie oder einem Feinschmeckerrestaurant als einem Buch. Literatur, die sich nicht verwerten lässt, gerät nicht in seinen Gesichtskreis.
Landauf landab gibt es Zirkel von Menschen, die alle denkbaren Berufe haben außer den des Literaturprofis, die aber eines verbindet: die Liebe zur Literatur. Sie treffen sich in regelmäßigen Abständen und reden über ihre Lektüre. Was sie zu sagen haben, ist meist um ein Vielfaches anregender und gescheiter als jedes Referat in einem Germanistikseminar. Vor allem aber besticht es – nun ja, durch die Liebe zur Literatur eben.
Dies ist kein Plädoyer für Unbildung. Kenntnisse erhöhen, auch beim Umgang mit ästhetischen Produkten, das Vergnügen. Was man in seiner Machart durchschaut, was man in größere Zusammenhänge einordnen kann, was man in seinen verborgenen Schichten begreift, gewährt auch mehr Lust als das Unverstandene. Aber Wissen ohne Liebe bringt allenfalls Virtuosen der Technik hervor. Das ist im Umgang mit Literatur nicht anders als, Pardon, im Bett.
Profis mögen in unserer Gesellschaft das höhere Prestige haben. Amateure – sympathischer sind die allemal. Aber auf der Buchmesse sind das so viele. Drum gehen wir nur zu den „Profitagen“.