 Pier Paolo Pasolini, den widerständigsten unter den Dichtern Italiens, muss man feiern, wieder und wieder. Der bei Suhrkamp rechtzeitig zum hundersten Geburtstag herausgebrachte Gedichtband „Nach meinem Tod zu veröffentlichen“ ist eine Großtat.
Pier Paolo Pasolini, den widerständigsten unter den Dichtern Italiens, muss man feiern, wieder und wieder. Der bei Suhrkamp rechtzeitig zum hundersten Geburtstag herausgebrachte Gedichtband „Nach meinem Tod zu veröffentlichen“ ist eine Großtat.
Am 5. März 2022 wäre Pasolini 100 Jahre alt geworden. Davon hat er – verbleibt man in der Zahlenwelt – kaum mehr als die Hälfte auf dieser Erde verbracht. Doch solch eine Rechnung ist natürlich so falsch wie nur etwas:
Tatsächlich war Pasolini manisch produktiv und hat ein Mammutwerk hinterlassen, das aus der Antike kommend, weit in die Zukunft weisend, immer ganz gegenwärtig war, faszinierend, provokativ, der Gesellschaft (und uns) den Spiegel vorhaltend. Pasolini schrieb Gedichte, machte Filme, war Kolumnist und Romanautor und alles in einem: archaischer Katholik, ungläubiger Rebell, apokalyptischer Anarchist und Wilderer zwischen allen Welten. Er suchte im Schreiben und Filmen nach der „Transkription des exemplarischen eigenen Lebens“, er warnte vor der Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft, anders gesagt davor, dass das grelle Licht der Schweinwerfer die Glühwürmchen zum Verschwinden brächte. Und immer, immer war die Kindheit sein Elixir. Doch ist sie das nicht sowieso für uns alle?
Erwachsen? Niemals – niemals, wie das Leben
das nicht reift – es bleibt immer unausgegoren
von einem herrlichen Tag zum nächsten herrlichen Tag –
ich kann nicht anders als ihr treu bleiben,
der wunderbaren Monotonie des Geheimnisses.
Das ist der Grund, warum ich mich im Glück
nicht verloren habe – das ist der Grund,
warum ich in der Sorge um meine Schuld
niemals zu wirklicher Reue gelangt bin.
Gleichrangig, immer gleichrangig mit dem Ungesagten
am Ursprung dessen, was ich bin.
Ja, das Ich im Gedicht verweigert sich (sechs mal wird hier ein „nicht“ und „niemals“ gesetzt) den Normen des Rationalen und des Erwachsenseins, beharrt, von dem rhetorischen Mittel der Wiederholung untermauert, auf der Vorrationalität (Geheimnis, Ungesagten) jeden Daseins.
 Pasolini, 1920 in Bologna geboren, aufgewachsen im Friaul, der Herkunftsregion seiner Mutter, hatte 1942 bereits einen ersten Gedichtband im friulischen Dialekt geschrieben („Poesie a Casarse“), auch wenn er selbst den Dialekt nicht sprach. Er wollte das Leben, das in früheren und in den verschiedenen Klängen verborgen lag, erhalten wissen, vielleicht in der Tradition von Dante und dessen Widerstand gegen die Universalität des Lateinischen und gegen die Konformität jeder Einheitssprache.
Pasolini, 1920 in Bologna geboren, aufgewachsen im Friaul, der Herkunftsregion seiner Mutter, hatte 1942 bereits einen ersten Gedichtband im friulischen Dialekt geschrieben („Poesie a Casarse“), auch wenn er selbst den Dialekt nicht sprach. Er wollte das Leben, das in früheren und in den verschiedenen Klängen verborgen lag, erhalten wissen, vielleicht in der Tradition von Dante und dessen Widerstand gegen die Universalität des Lateinischen und gegen die Konformität jeder Einheitssprache.
Zu seiner Zeit war Pasolini weltberühmt, nicht nur in Italien und nicht nur der Tabubrüche wegen, die er immer wieder in seinen Kunstwerken inszenierte. In letzter Zeit ist es hierzulande fast still um ihn geworden, nun – endlich! – liegen seine späten Gedichte vor, ergänzt um Gedichte aus dem Nachlass, herausgegeben und übersetzt von Theresia Prammer. Eine Großtat: 630 Seiten, im Großformat. Ganz wundersam kann man sich hier von Gedicht zu Gedicht verlaufen, fast wie in einem Roman. Denn immer tun sich neue Welten auf. Die Politik und die Liebe, das Leben der Arbeiter und der Außenseiter – alles wird belebt durch seinen Blick und seine Sprache.
Pasolini nahm sich bekanntlich in seiner Kunst die Freiheiten, die niemand ihm je gegeben. Er löckte wider alle Stachel. Die Sehnsucht nach einem „Wirklich-Lebendig-Sein“ durchtränkt jedes Wort und brachte ihm zu Lebzeiten zahllose Prozesse ein, bevor er 1975, viel zu jung, ermordet wurde. Er stellte die eigene Person als Liebender und Leidender ins Zentrum seines Werkes, ohne sich als Person zum Chronisten der eigenen Entwicklung zu machen. Die „vibratilità“ (Zanzotto) seiner Texte ist permanente Arbeit an der Freilegung und Freisetzung der Wirklichkeit. In dem Zyklus „Eine verzweifelte Lebendigkeit“ findet sich ein typisches Ineinander von Einst und Jetzt:
Das Alter schließlich hat
aus meiner Mutter und mir
zwei Masken gemacht,
die doch nichts eingebüßt haben
von der morgendlichen Zartheit
– und das antike Schauspiel
wiederholt sich
in der Unverwechselbarkeit,
die ich nur träumend in einem Traum
bei ihrem Namen nennen könnte.
Das Leben – ein Traum, und nur dort, wo man es im Traume lebt, kann man die Dinge träumen und benennen, die sich im Ursprung vollziehen: Träumend träumen wir also, was ist, und beharren darauf, damit die normativen Kräfte uns nicht überwuchern.
Pasolinis poetische Interventionen wollen Ereignis sein, und nehmen ihrerseits auf Ereignisse Bezug, wie die Herausgeberin Theresia Prammer schreibt. Gebrochene Prosa, die mal Rudi Dutschke, mal einem Polizisten und mal auch einem Jungen gilt, der unter der Schulbank onaniert. Unter den Ereignisgedichten findet sich unter anderem eine Totenklage zum (ersten rechtsextremen) Bombenanschlag an der Piazza Fontana in Mailand, bei dem am 12. Dezember 1969 17 Menschen getötet und 88 schwer verletzt wurden. Fernab, auf der Insel Patmos, wo der Evangelist Johannes einst die Apokalypse niederschrieb, hörte Pasolini die Nachricht, geschockt ob der schändlichen Gewalttat, die zum Zeitpunkt des Gedichtes noch als Tat eines Anarchisten gehandelt wurde. Wie am Jüngsten Tag werden die Toten beim Namen gerufen, ihre Lebens- und Todesumstände werden bedacht. Sprachliche Denkmäler für diejenigen, die allzu oft namenlos bleiben, durchmischt mit Zeilen aus der Apokalypse („Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete“) und Bildern aus Dantes Inferno.
Pasolinis Kunst ist Vision, von Trauer und Humor durchtränkt, und so schließe ich mit einigen Zeilen aus dem Gedicht „Regeln für ein erfundenes Leben“, in dem ein fiktives „er“ Macht und Ohnmacht aufeinanderprallen lässt:
Gerne würde er, mit der Vorfreude des Kannibalen in Betrachtung seines Opfers
zu jenem kleinen Wesen sagen:
„Wehr dich gegen deine verfluchten Herren, die du
doch besser kennst als ich!“ Aber es hat keinen Zweck,
ich denke, dass dieser Mund zu nichts anderem gut ist
als zum Küssen.
***
Pier Paolo Pasolini, „Nach meinem Tod zu veröffentlichen“. Späte Gedichte, herausgegeben, übersetzt und mit einem Nachwort von Theresia Prammer, Suhrkamp 2021, 630 Seiten, Großformat, 49 Euro. Der Band versammelt die späten Gedichtbände: Die Religion meiner Zeit, Dichtung in Form einer Rose und Trasumanar e Organizzar, sowie Gedichte aus dem Nachlass.
Zum Weiterlesen:
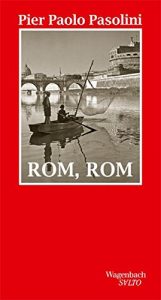 Von Pier Paolo Pasolini ist derzeit lieferbar
Von Pier Paolo Pasolini ist derzeit lieferbar
— bei Urs Engeler: Dunkler Enthusiasmo. Friulanische Gedichte, aus dem Italienischen von Christian Filips, http://www.engeler.de/enthusiasmoblacklist.html
— Bei Klaus Wagenbach: der Band „Rom, Rom“ und der Band „in persona“
Zu meinen Lieblingsgedichten in dem Band gehört das Lied „Marilyn“, das Pasolini etwa vier Monate nach Marilyn Monroes Suizid verfasste. In ihm verbindet sich die Besinnung auf die Kindheit mit einer „politischen Anthropologie der Schönheit“ (Didi-Huberman). Allein der Anfang „Del mondo antico e del mondo futuro / era rimasta solo la bellezza, e tu,/ povera sorellina minore“ ist ein (unübertragbares) Schweben mit den Vokalen A und O, in das plötzlich ein äußerst kurzes „e tu“ einbricht. Die Schönheit der Schöpfung ereignet sich im konkreten Einzelnen. Pasolini hat das Gedicht in seinen Film „La Rabbia“ aufgenommen.
