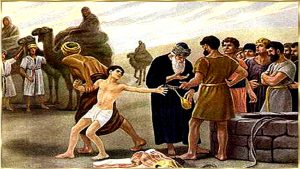 Afrikanische und karibische Staaten fordern von Großbritannien, Frankreich oder den USA Reparationen für deren Beteiligung am Sklavenhandel. Auch Zahlen stehen im Raum – sehr hohe Zahlen. Lässt sich der Schaden, den der transatlantische Sklavenhandel verursacht hat, beziffern? Lässt sich in Zahlen fassen, was sich kaum in Worte fassen lässt: das Ausmaß dieses über Jahrhunderte an Millionen Menschen verübten Grauens? Man kann es zumindest versuchen. Die Brattle Group, eine in Boston ansässige Beratungsfirma, legte vor einigen Monaten einen Bericht vor, demzufolge sich der Gesamtschaden durch den Sklavenhandel zwischen Afrika und Amerika auf 108 Billionen Dollar beläuft, etwa 100 Billionen Euro. Das ist eine Eins mit vierzehn 00000000000000 en.
Afrikanische und karibische Staaten fordern von Großbritannien, Frankreich oder den USA Reparationen für deren Beteiligung am Sklavenhandel. Auch Zahlen stehen im Raum – sehr hohe Zahlen. Lässt sich der Schaden, den der transatlantische Sklavenhandel verursacht hat, beziffern? Lässt sich in Zahlen fassen, was sich kaum in Worte fassen lässt: das Ausmaß dieses über Jahrhunderte an Millionen Menschen verübten Grauens? Man kann es zumindest versuchen. Die Brattle Group, eine in Boston ansässige Beratungsfirma, legte vor einigen Monaten einen Bericht vor, demzufolge sich der Gesamtschaden durch den Sklavenhandel zwischen Afrika und Amerika auf 108 Billionen Dollar beläuft, etwa 100 Billionen Euro. Das ist eine Eins mit vierzehn 00000000000000 en.
Dieser enormen Summe wegen zum Trotz betonen die Autoren, dass es sich nur um eine Annäherung handle. So hätten sie nur materielle Schäden beziffern können – die gestohlene Arbeitszeit zum Beispiel -, nicht aber immaterielle wie den Verlust von Rechten oder Identität. Die Langzeitfolgen des Sklavenhandels hätten sie nur grob schätzen können, indem sie etwa das Einkommen Schwarzer und Weißer in den USA verglichen. Auch deckten ihre Berechnungen allein die Ansprüche der zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert über den Atlantik Verschleppten und ihrer Nachkommen ab – nicht aber die Lücke, die der Menschenraub in Afrika hinterließ. Und schließlich hätten sie nur einen moderaten Zinssatz angelegt.
Doch am Ende liefert der Bericht, worauf es ankam: eine Summe. Denn es handelt sich hier nicht um eine akademische Übung. Die Rechnung soll bezahlt werden: von den Staaten, die am Sklavenhandel beteiligt waren, an die Nachfahren der etwa zwölf Millionen Menschen, die in Afrika in Ketten gelegt und wie Vieh verschifft wurden, um sich auf Plantagen in Virginia, Puerto Rico oder Brasilien zu Tode zu arbeiten.
Die karibischen Staaten richteten 2013 eine Reparationskommission ein. Und auch afrikanische Staaten, die lange Zeit die Beziehungen mit den früheren Kolonialmächten nicht gefährden wollten, haben sich der Forderung angeschlossen – allen voran Ghana, dessen Küste über Jahrhunderte hinweg das afrikanische Zentrum des Sklavenhandels war.
Reparationen seien ein Thema, „das die Welt nicht länger ignorieren kann“, sagte Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo im November auf einer Konferenz in Accra. Karibische und afrikanische Staaten vereinbarten dort, künftig gemeinsam um Wiedergutmachung kämpfen zu wollen. Dass dieser Kampf Erfolg hat, ist wenig wahrscheinlich. Aber es ist wahrscheinlicher als vor zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren.
Denn auch wenn sie in London oder Paris über Reparationen nicht einmal reden wollen: Die Bereitschaft der westlichen Staaten, sich ihrer imperialen Vergangenheit kritisch zu stellen, ist gewachsen; die Rückgabe geraubter Kunstschätze wie der Benin-Bronzen ist dafür nur ein Beispiel. Der damalige niederländische Premier Mark Rutte entschuldigte sich Ende 2022 ausdrücklich für die Rolle seines Landes im Sklavenhandel.
