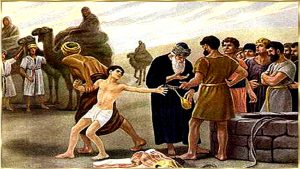 Afrikanische und karibische Staaten fordern von Großbritannien, Frankreich oder den USA Reparationen für deren Beteiligung am Sklavenhandel. Auch Zahlen stehen im Raum – sehr hohe Zahlen. Lässt sich der Schaden, den der transatlantische Sklavenhandel verursacht hat, beziffern? Lässt sich in Zahlen fassen, was sich kaum in Worte fassen lässt: das Ausmaß dieses über Jahrhunderte an Millionen Menschen verübten Grauens? Man kann es zumindest versuchen. Die Brattle Group, eine in Boston ansässige Beratungsfirma, legte vor einigen Monaten einen Bericht vor, demzufolge sich der Gesamtschaden durch den Sklavenhandel zwischen Afrika und Amerika auf 108 Billionen Dollar beläuft, etwa 100 Billionen Euro. Das ist eine Eins mit vierzehn 00000000000000 en.
Afrikanische und karibische Staaten fordern von Großbritannien, Frankreich oder den USA Reparationen für deren Beteiligung am Sklavenhandel. Auch Zahlen stehen im Raum – sehr hohe Zahlen. Lässt sich der Schaden, den der transatlantische Sklavenhandel verursacht hat, beziffern? Lässt sich in Zahlen fassen, was sich kaum in Worte fassen lässt: das Ausmaß dieses über Jahrhunderte an Millionen Menschen verübten Grauens? Man kann es zumindest versuchen. Die Brattle Group, eine in Boston ansässige Beratungsfirma, legte vor einigen Monaten einen Bericht vor, demzufolge sich der Gesamtschaden durch den Sklavenhandel zwischen Afrika und Amerika auf 108 Billionen Dollar beläuft, etwa 100 Billionen Euro. Das ist eine Eins mit vierzehn 00000000000000 en.
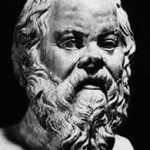
 Derweil er dem Bildungsbürger – ungemach schnell – zum Outsider geworden war, schien er den Kleinbürgern alsbald ein Bourgeois zu sein – wobei er sich keines der ihm offenen Wege bediente: Er hätte schnell zugrunde gehen können, hätte ihn die materialistisch-bürgerliche Gesellschaft als unbrauchbares Glied einfach absterben lassen. Auch zum Clown und Unikum der Heidelberger Gesellschaft hätte er werden können, erlaubte sie sich den Luxus solcher Existenz in ihrem Schoß. Sie tat es, auch wenn sie über Polemiken von (immer bescheiden) diesem Tenno oft genug erstmal den Kopf schüttelte. Letzteren aber eingeschaltet, verstehen die Meisten dann doch …
Derweil er dem Bildungsbürger – ungemach schnell – zum Outsider geworden war, schien er den Kleinbürgern alsbald ein Bourgeois zu sein – wobei er sich keines der ihm offenen Wege bediente: Er hätte schnell zugrunde gehen können, hätte ihn die materialistisch-bürgerliche Gesellschaft als unbrauchbares Glied einfach absterben lassen. Auch zum Clown und Unikum der Heidelberger Gesellschaft hätte er werden können, erlaubte sie sich den Luxus solcher Existenz in ihrem Schoß. Sie tat es, auch wenn sie über Polemiken von (immer bescheiden) diesem Tenno oft genug erstmal den Kopf schüttelte. Letzteren aber eingeschaltet, verstehen die Meisten dann doch …
 Wollen wir wirklich älter werden?
Wollen wir wirklich älter werden?
Wen die Götter lieben, den rufen sie doch früh zu sich. Und, wenn wie im Mittelalter nur das ewige Leben zählt, ist die Zeit hier nur Vorbereitung. Wenn wir wie Seneca alles stoisch sehen, ist mathematisch jede Zeit hier gleich lang, gegenüber der langen Strecke die wir noch nicht, und der noch längeren, die wir nicht sein werden. (mehr …)
 Mit ihren Eltern hat sie Glück, sie sind selbst „dans le vent“, feiern gern, lieben Bugattis und Pferderennen und lassen ihr, der verwöhnten jüngsten, Kiki genannt, alle Freiheit.
Mit ihren Eltern hat sie Glück, sie sind selbst „dans le vent“, feiern gern, lieben Bugattis und Pferderennen und lassen ihr, der verwöhnten jüngsten, Kiki genannt, alle Freiheit.
Als sie aber ihre Abiturprüfung nicht besteht, muss sie – ganz wie im richtigen Leben – die Sommerferien in Paris statt an der Côte verbringen, um für die Nachprüfung zu lernen.
Die üblichen Verdächtigen streiten sich immer mal wieder darum, wie man den deutschen, den autochthonen Antisemitismus gegen den importierten wie und ob ausspielen könne – und umgekehrt. Kritik am islamischen oder wenigstens islamistischen Antisemitismus wird in der deutschen linken Öffentlichkeit gern als „Rassismus“ abqualifiziert, etwa wenn derzeit die ekelhaften Unterstützerdemos von Palästinensern auf deutschen Straßen kritisiert werden. Zugleich wird mit der Betonung des importierten Antisemitismus von der eigenen judenfeindlichen Tradition abgelenkt, die erheblich lebendiger ist, als viele es wahrhaben wollen.
In dieser Lesart bestand die größte Verfehlung des assimilierten Juden darin, dass man ihn letztlich nicht mehr vom Nichtjuden unterscheiden konnte, was ihn erst recht zu einem Monster werden ließ. Richard Wagner sagt es in seinem Pamphlet über Das Judenthum in der Musik geradezu zeitlos: „Gemeinschaftlich mit uns Mensch werden, heißt für den Juden aber zu allernächst so viel als: aufhören, Jude zu sein“ – will heißen: endlich aufhören, einerseits etwas Besonderes sein zu wollen, andererseits ein universalistisches, übernationales Merkmal zu tragen. Hier ging es noch um eine bloß semantische Vernichtungsfantasie.
Die ganze Diskussion, ob der Antisemitismus von hier stammt oder aber von Migranten eingeführt wird, ist dummes Gerede. Die Wurzeln beider sind sich logisch sehr ähnlich – man kann es vor allem an jenen studieren, die den postkolonialen, sich für universalistisch haltenden „Befreiungskampf“ der Hamas wenn nicht für sympathisch, so zumindest für legitim halten. Denn die Denkfigur ist ganz ähnlich dem Judenhass der Wagners und wie sie alle heißen. Manche geraten, akademisch verbrämt, in einen irrationalen Judenhass, weil sie in Israel die Ununterscheidbarkeit zu dem wahrnehmen, was sie selbst verachten: die marktwirtschaftliche Offenheit, die pluralistische Offenheit der liberalen westlichen Lebensweise, nicht zuletzt die Koalition mit Amerika. Mit Israel müsste man eine Staatlichkeit und Gesellschaftlichkeit verteidigen, die der eigenen Lebensform, die stets und wohlfeil Gegenstand von Kritik ist, allzu ähnlich ist.
Nur vor diesem Hintergrund konnten Terrororganisationen wie die Hamas und die Hisbollah, vorher die PLO und andere, für linke Befreiungsbewegungen gehalten werden – und nur vor diesem Hintergrund ist womöglich zu erklären, warum in vielen Medienberichten die Terroristen als „Kämpfer“ auf Augenhöhe markiert werden oder eine ominöse „Spirale der Gewalt“ beklagt wird. Ein Zeitungskommentar einer süddeutschen Zeitung konnte sich kaum der klammheimlichen Freude enthalten, dass es nun die Regierung Netanjahu getroffen hat.
In der Kritik am jüdischen Israel schwingt der antikapitalistische Reflex gegen das internationale Finanzjudentum mit und ebenso ein eher ungeklärtes Verhältnis zu einer wehrhaften Frontstellung gegenüber autoritären und autokratischen Formen. Die Rahmung des Ganzen als rassistisch ist am Ende nur eine ironische Brechung der historischen Rassifizierung des Jüdischen in unserer eigenen Geschichte.

Ein Trauernder legt an der Synagoge in Halle Blumen nieder.
Es sind Zahlen, die erschrecken lassen. Als im Jahr 1952 das Allensbacher Institut für Demoskopie eine Umfrage zu Antisemitismus in Deutschland durchführte, war der industrielle Massenmord an den Juden in Europa durch die Nazis erst sieben Jahre her. Dennoch war der Eindruck des Holocaust offenbar schon verblasst. Auf die Frage, ob es „für Deutschland besser wäre, keine Juden im Land zu haben“, antworteten damals 37 Prozent mit „Ja“, nur 19 mit „Nein“ und fast der Hälfte (44 Prozent) war das „egal“. Das ist zweifelsohne lange her. Doch der rechtsextreme Terroranschlag in Halle wirft die Frage erneut auf: Wie antisemitisch ist Deutschland eigentlich?
Der Soziologe Werner Bergmann dokumentiert, wie sich Antisemitismus in den jungen Jahren der Bundesrepublik entwickelt hat. Sein Werk zeigt, dass in der jungen Bundesrepublik kurz nach dem Ende des Nazi-Regimes eine antisemitische Grundhaltung weit verbreitet war. Wie überhaupt „Ihre Einstellung gegenüber Juden“ sei, fragten die Allensbach-Demoskopen 1952. 34 Prozent der Antworten lagen im Bereich „demonstrativ ablehnend“ bis „gefühlsmäßig ablehnend“. Eine „demonstrativ freundliche“ Einstellung hatten demnach nur 7 Prozent. Eine Wiedergutmachung an Israel lehnten mehr als die Hälfte ab.
„Es waren besonders die junge, im Nationalsozialismus groß gewordene Generation und die Bildungsschicht, die (…) massiv antijüdische Einstellungen zeigten“, schrieb Bergmann über diese Jahre. Ein „selbstkritischer Dialog“ über die antijüdischen Gräuel der Vergangenheit sei „massiv abgelehnt“ worden. Positionen, die den Holocaust leugneten und relativierten, waren bis in die Spitzenpolitik verbreitet. Der Bundestagsabgeordnete der „Deutschen Partei“, Wolfgang Hedler, sagte etwa 1949 in einer Rede, man könne „geteilter Meinung“ darüber sein, ob die „Judenvernichtung das richtige Mittel zur Lösung der Judenfrage“ gewesen sei. Die unmittelbaren Nachkriegsjahre sind der Ausgangspunkt einer schwierigen und langen Aufarbeitung dessen, was jahrzehntelanger, möglicherweise jahrhundertelanger Antisemitismus im Gebiet der heutigen Bundesrepublik angerichtet hatte.
Linke und NPD in einem Boot
In den Folgejahren nahm der in Umfragen ermittelte Antisemitismus ab. Teile der Gesellschaft forderten zwar bereits Mitte der 50er-Jahre einen „Schlussstrich“ unter die NS-Zeit. Doch immer wieder rückten Ereignisse die deutsche Schuld in den Mittelpunkt der Debatte, etwa die Veröffentlichung der Tagebücher von Anne Frank, die Debatte um den KZ-Dokumentarfilm „Nacht und Nebel“ von 1955 oder der aufsehenerregende Prozess gegen den Organisator der Judenvernichtung, Adolf Eichmann, der 1962 in Israel hingerichtet wurde. Während dieser Jahre führte das Allensbacher Institut seine Umfragen weiter. 1963 glaubten dann „nur“ noch 18 Prozent der Bundesbürger, es sei besser für Deutschland, wenn keine Juden im Land lebten.
Eine Veränderung in der Wahrnehmung Israels verursachte laut Bergmann der Sechstagekrieg 1967, nach dem Israel als „siegreiche Militär- und Besatzungsmacht“ galt. Kommunistische Staaten und die radikale Linke im Westen hätten eine Wendung zum Antizionismus vollzogen, „der von antisemitischen Tönen nicht frei war“. Einst pro-israelische linke Intellektuelle nahmen zum Teil israelfeindliche Positionen ein und standen plötzlich auf einer Seite mit der geschichtsrevisionistischen NPD, die in den 60er Jahren in zahlreiche Landesparlamente eingezogen war.
In diesen Jahren ereigneten sich auch die ersten antisemitischen Terrorakte auf deutschem Boden seit dem Ende des Krieges. 1969 wurde die israelische Botschaft in Bonn mit Handgranaten angegriffen. Am Jahrestag der November-Pogrome 1969 deponierte eine linksradikale Gruppe eine Brandbombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin-Charlottenburg, die allerdings nicht zündete. Unbekannte Täter legten 1970 ein Feuer im jüdischen Gemeindezentrum in München, bei dem Anschlag starben sechs Überlebende des Holocaust. Bei der Geiselnahme israelischer Athleten während der Olympischen Spiele 1972 durch ein palästinensisches Terrorkommando kamen 17 Menschen ums Leben. 1979 versuchte eine rechtsextreme Gruppe die Ausstrahlung des Films „Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss“ zu verhindern, indem sie Sprengsätze an Sendeanlagen zündete. Einer der Täter, Peter Naumann, arbeitete Jahrzehnte später für die NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag.
Weniger Antisemitismus im Osten
Dafür, dass der Antisemitismus insgesamt seit den 50er Jahren dennoch zurückging, macht Bergmann „nur zu einem kleinen Teil“ ein „Umdenken in der älteren Generation“ verantwortlich. Vielmehr habe die nachwachsende, in der Bundesrepublik sozialisierte Generation die Vorurteile ihrer Eltern nicht übernommen. Laut Bergmann ein Trend, „der sich bis heute fortsetzt“. Generations- und Bildungseffekte bewirkten im Unterschied zur NS-Zeit eine Ablehnung antijüdischer Vorurteile. „Je jünger und besser ausgebildet jemand ist, desto häufiger lehnt er diese ab.“ Während sich in der Allensbach-Umfrage 1949 noch mehr als 25 Prozent der Unter-30-Jährigen als „antisemitisch“ bezeichneten, beantworteten diese Frage 1987 nur noch rund 5 Prozent der jüngsten Gruppe (18-44-Jährige) mit „Ja“.
Bei einer ersten Befragung im wiedervereinten Deutschland, die das American Jewish Committee 1991 durchführte, zeigte sich, dass antisemitische Vorurteile in Ostdeutschland (vier bis sechs Prozent) deutlich weniger verbreitet waren als im Westen (12 bis 16 Prozent). Die Allgemeine Bevölkerungsumfrage (Allbus) 1996 offenbarte ein ähnliches Bild. Demnach unterstützten 28 Prozent der West-Bürger die These, Juden hätten zu viel Einfluss auf der Welt. Im Osten waren es nur 15 Prozent. 48 Prozent der Westdeutschen antworteten auf die Frage mit „Ja“, die Juden versuchten aus der Geschichte des Nationalsozialismus einen eigenen Vorteil zu ziehen. Im Osten waren es nur 35 Prozent. In den frühen Neunzigerjahren hatte das Land mit einer Welle rechtsextremer Straftaten zu kämpfen. Zwischen 1990 und 1993 verneunfachte sich die Zahl rassistischer Übergriffe. Auch die Zahl antisemitischer Vorfälle stieg in diesen Jahren von 339 gemeldeten Vorfällen auf 1366 im Jahr 1994.
Es deutet nicht wenig darauf hin, dass Antisemitismus in Deutschland seit der Jahrtausendwende wieder zunimmt. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 1998 gaben 21 Prozent der Befragten an, dass sie der Meinung sind, Juden hätten „zu viel Einfluss in der Welt“. 2002 fragten Sigmund-Freud-Institut und Uni Leipzig noch einmal. 40 Prozent der Befragten antworteten, Juden hätten „einen zu großen Einfluss auf das Weltgeschehen“. 65 Prozent bezeichneten demnach Israel als eine „große Bedrohung für den Frieden in der Welt“. Europaweit ermittelte die Studie bei dieser Frage einen Zustimmungswert von 59 Prozent. Die polizeilich registrierten antisemitischen Straftaten haben 2006 ein Allzeithoch erreicht, danach fiel die Kurve einige Jahre. 2018 erreichte sie wieder beinahe das Niveau von 2006. Unter den 1799 Delikten im vergangenen Jahr waren allerdings 69 Gewaltstraftaten – 60 Prozent mehr als im Vorjahr.
Die Gewalt gegen Juden nimmt zu
Die Allensbach-Demoskopen, die Antisemitismus in Deutschland seit der Gründung des Staates untersuchen, kommen in ihrer Studie von 2018 zu einem differenzierten Bild. Von Stimmungen wie in den 50er-Jahren hat sich das Land inzwischen weit entfernt. Nur noch sechs Prozent glauben, in der Berichterstattung über Konzentrationslager würde vieles „übertrieben“ dargestellt, eine etwa in der Nachkriegszeit weit verbreitete Legende. Einen „Schlussstrich“ unter die Nazi-Zeit zu ziehen, fordern immerhin noch 45 Prozent. Dieser Wert ist in den vergangenen Jahren allerdings beständig gesunken: von 66 Prozent im Jahr 1986 über 59 im Jahr 1995 und 54 Prozent im Jahr 2005. Die Studie zeigt allerdings auch, dass nur eine Minderheit (23 Prozent) glaubt, Antisemitismus sei ein „großes Problem“ in Deutschland. Der Großteil glaubt, Judenhass sei ein auf Einzelfälle beschränktes Phänomen.
Der These, dass Juden in der Welt „zu viel Einfluss“ hätten, stimmten in der Allensbach-Studie von 2018 22 Prozent der Befragten parteiübergreifend zu. Ein, verglichen mit der Studie der Sigmund-Freud-Stiftung von 2002, gesunkener Wert. Allerdings hält sich das antisemitische Klischee vor allem in einem politischen Lager hartnäckig. In der Anhängerschaft keiner im Bundestag vertretenen Partei lag der Wert über 20 Prozent. Bei den Anhängern der AfD allerdings glauben 55 Prozent an einen zu großen Einfluss der Juden in der Welt.
Bei der Frage nach dem Ursprung von Antisemitismus gehen die Fakten jedoch auseinander. Laut polizeilicher Statistik waren 1603 der 1799 Übergriffe gegen Juden oder jüdische Einrichtungen im Jahr 2018 dem rechten Spektrum zuzordnen. Bei der 2017 von der Uni Bielefeld angefertigten Studie „Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus“ gaben Opfer von antisemitischen Gewalttaten zu 81 Prozent an, die mutmaßlichen Täter hätten einer „muslimischen Gruppe“ angehört. Die Datenbasis von 16 Befragten war bei dieser Untersuchung allerdings sehr klein. Die Recherche- und Informationsstelle (Rias) in Berlin kommt wiederum zu anderen Zahlen. In ihrem Bericht für 2018 ist von 1083 Delikten die Rede. Dabei sei das politische Spektrum, dem die meisten Taten zugeordnet werden konnte, der Rechtsextremismus (18 Prozent), gefolgt vom „israelfeindlichen Aktivismus“ (neun Prozent).
Quelle: ntv.de
Im letzten Oktober kündigte Salman Rushdie an, ein Buch über den Mordanschlag auf ihn zu publizieren. Nun verlangt die Verteidigung Einblick in die Aufzeichnungen.
Der Schriftsteller Salman Rushdie ist seit der Messerattacke im August 2022 auf einem Auge blind.
Am Montag hätte der Prozess gegen Hadi Matar beginnen sollen, der im August 2022 während einer Veranstaltung mehr als ein Dutzend Mal mit einem Messer auf Salman Rushdie eingestochen und den Schriftsteller lebensgefährlich verletzt hatte. Rushdie überlebte den Mordanschlag, er hat aber das rechte Auge verloren, ausserdem wurden die Leber und eine Sehne am linken Arm verletzt. Er leidet bis heute unter den Folgen des Angriffs.
Matars Verteidiger hat diese Woche Einsicht verlangt in das neue Buch von Salman Rushdie, das am 16. April unter dem Titel «The Knife» (Das Messer) erscheinen wird und im Untertitel «Erinnerungen nach einem versuchten Mord» verspricht. Die Verteidigung erkennt darin mögliches Beweismaterial und beantragt darum, dass dem Angeklagten Einblick gewährt werde. Der zuständige Richter am Bezirksgericht in Chautauqua im US-Bundesstaat New York, wo die Attacke stattgefunden hatte und dem Attentäter der Prozess gemacht wird, gab dem Gesuch statt. Rushdies Anwälte verweigerten unter Verweis auf das Urheberrecht umgehend die Einsichtnahme.
Zahlreiche Zeugen des Angriffs
Der Prozess wurde einstweilen sistiert, und auf Anweisung des Richters müssen der Anwalt und der Angeklagte entscheiden, ob das Verfahren erst nach Erscheinen des Buches im April wiederaufgenommen werden soll. Matars Anwalt stellt sich auf den Standpunkt, dass es nicht nur um das Buch gehe, vielmehr sei er berechtigt, alles Material einzusehen, das im Zusammenhang mit «The Knife» entstanden sei, jede kleinste Notiz, die Rushdie aufgeschrieben habe, jedes Gespräch, das er dazu geführt habe.
Der Bezirksanwalt hält das Material allerdings für wenig relevant. Es gebe hinreichende Zeugenaussagen, da die Attacke vor Publikum geschah. Ausserdem könne Salman Rushdie als Zeuge vor Gericht geladen werden. Ob Rushdie am Prozess teilnehmen wird, hat er im vergangenen Sommer noch offengelassen. Er sei in der Frage gespalten, zitiert ihn der britische «Guardian»: «Ein Teil von mir möchte tatsächlich im Gerichtssaal anwesend sein und den Attentäter sehen, ein anderer Teil in mir hat schlicht keine Lust dazu.»
Rushdie verdankt sein Überleben einem Freund, dem es gelungen war, den Attentäter an den Füssen zu packen und von seinem Opfer wegzuziehen. Hadi Matar wurde noch am Tatort festgenommen und ist seither in Haft. In einem Interview mit der «New York Post» äusserte er sich nur wenige Tage nach dem Angriff überrascht, dass Rushdie überlebt hat. Zu seinen Motiven für die Tat sagte er, der Schriftsteller habe den Islam und die gläubigen Muslime angegriffen. Zugleich gestand er, lediglich ein paar Seiten der «Satanischen Verse» gelesen zu haben.
Nicht das einfachste Buch
Im Februar 2023, ein halbes Jahr nach dem Angriff, sprach Salman Rushdie in einem langen Interview mit dem «New Yorker» erstmals davon, über den Mordanschlag ein Buch schreiben zu wollen. Es schwebe ihm eine Art Fortsetzung seiner Autobiografie «Joseph Anton» vor. Joseph Anton war sein Pseudonym, mit dem er sich in den Jahren nach der von Irans Revolutionsführer Ayatollah Khomeiny erlassenen Fatwa von 1989 schützte.
Die Geschichte über den Messerangriff müsse er allerdings in der ersten Person schreiben. «Wenn jemand mit einem Messer in dich hineinsticht, dann ist das eine Ich-Geschichte.» Es sei nicht das einfachste Buch auf der Welt, aber er müsse es schreiben und sich mit dem Anschlag auseinandersetzen, damit er sich wieder anderem zuwenden könne. «Ich kann nicht einfach einen Roman schreiben, der nichts damit zu tun hat.»
Danach kündigte Salman Rushdie bereits im vergangenen Oktober an, dass seine Erinnerungen an den Mordanschlag im April unter dem Titel «The Knife» erscheinen würden. «Es war für mich eine Notwendigkeit, dieses Buch zu schreiben», sagte er während einer öffentlichen Veranstaltung, «eine Möglichkeit, das Geschehene zu verarbeiten und der Gewalt mit Kunst zu begegnen.»
 Die Krise von Demokratie und Kapitalismus ist eine philosophische: Die Bürger fühlen sich ihren Systemen zunehmend entfremdet, weil sie sie mit veralteten Maßstäben messen. Längst leben wir in einem nüchternen Pragmatismus. Unsere Art, gesellschaftliche Entscheidungen zu treffen, befindet sich in einer Krise, die ihre Fundamente untergräbt.
Die Krise von Demokratie und Kapitalismus ist eine philosophische: Die Bürger fühlen sich ihren Systemen zunehmend entfremdet, weil sie sie mit veralteten Maßstäben messen. Längst leben wir in einem nüchternen Pragmatismus. Unsere Art, gesellschaftliche Entscheidungen zu treffen, befindet sich in einer Krise, die ihre Fundamente untergräbt.
Die Musik schwillt an, als der Vater das Kind nimmt, Richtung Fenster läuft und Anstalten macht, es hinauszuwerfen. Die Kamera nun in einer Totale, das am Abgrund schwebende Kind oben, die wuselnden Leute da unten, dann die Perspektive aus dem Fenster, verzweifelte Menschen dort unten, die anbieten, den Jungen aufzufangen, aber so richtig wohl ist ihnen dabei nicht. Schließlich entscheidet sich der Vater gegen den Wurf, drückt das Kind an sich, es muss einen anderen Weg geben; er sieht vielleicht auch in diesem Moment ein, dass die katholische Kirche zu mächtig ist, als dass sein Sohn eine Chance hätte, selbst wenn einer der Verbündeten dort unten ihn auffangen könnte.
Ein bisschen Brainwashing-Narrativ
 Die Bologna Entführung heißt der neue Film von Marco Bellocchio, und der Kidnapper ist niemand Geringeres als der Papst. Dem katholischen Establishment ist im Jahre 1857 zu Ohren gekommen, dass eines von sieben Kindern einer jüdischen Familie in Bologna einst getauft wurde, und so sieht es sich legitimiert, den sechsjährigen Edgardo seiner Familie zu entreißen, in die Obhut der Kirche zu nehmen und das Christentum zu lehren.
Die Bologna Entführung heißt der neue Film von Marco Bellocchio, und der Kidnapper ist niemand Geringeres als der Papst. Dem katholischen Establishment ist im Jahre 1857 zu Ohren gekommen, dass eines von sieben Kindern einer jüdischen Familie in Bologna einst getauft wurde, und so sieht es sich legitimiert, den sechsjährigen Edgardo seiner Familie zu entreißen, in die Obhut der Kirche zu nehmen und das Christentum zu lehren.
Die kaltherzige Macht auf der einen, die ohnmächtige Verzweiflung auf der anderen Seite: Fortan ist Die Bologna Entführung ein zweigeteilter Film, folgt einerseits Edgardos Missionierung in Rom, direkt beim Papst und gemeinsam mit anderen jüdischen Kindern, andererseits dem Kampf seiner Familie, den verlorenen Sohn zurückzubekommen, inklusive Mobilisierung des internationalen jüdischen Establishments und einiger von ganz oben autorisierter elterlicher Besuche bei Edgardo selbst, der zwischen der Akzeptanz seines neuen und der Sehnsucht nach seinem alten Heim sichtlich zerrissen ist. Was in ihm vorgeht, wie weit er schon bekehrt ist, wie lange er noch seine Familie vermisst, ab wann er verloren ist – ein bisschen Brainwashing-Narrativ ist Die Bologna Entführung schon auch, so richtig hinter die Fassade Edgardos, ein unschuldiges Kindergesicht if there ever was one, können wir nicht blicken. Doch haben wir durch die Augen des Jungen die furchteinflößende christliche Symbolik gesehen, als würden wir sie auch gerade erst kennenlernen, und das ist nicht wenig.
Ein Albtraum jüdischer Rache
 Ein weiterer Historienfilm in Cannes, vielleicht der beste. Nicht nur, dass Bellocchios Klassizismus ein ungemein dynamischer ist, der sorgsam die statischen Dialogszenen mit den beschleunigten Actionszenen austariert und für jede Entwicklung seiner konzentrierten Erzählung ein Bild findet, das stimmig ist, ohne sich selbst als eigenes Kunstwerk ausstellen zu wollen. Die Bologna Entführung ist eine große Historienoper und steht dabei zugleich, wie seine Anfangssequenz, stetig unter Spannung, hält seine kleine Geschichte in der Schwebe wie der Vater das Kind am Fenster, während die große voranschreitet.
Ein weiterer Historienfilm in Cannes, vielleicht der beste. Nicht nur, dass Bellocchios Klassizismus ein ungemein dynamischer ist, der sorgsam die statischen Dialogszenen mit den beschleunigten Actionszenen austariert und für jede Entwicklung seiner konzentrierten Erzählung ein Bild findet, das stimmig ist, ohne sich selbst als eigenes Kunstwerk ausstellen zu wollen. Die Bologna Entführung ist eine große Historienoper und steht dabei zugleich, wie seine Anfangssequenz, stetig unter Spannung, hält seine kleine Geschichte in der Schwebe wie der Vater das Kind am Fenster, während die große voranschreitet.
Denn mit dem Privatkrieg Pius’ XI. gegen die Juden, für den er selbst innerhalb der katholischen Kirche in der Kritik stand, ist es längst nicht getan: Die italienische Nationalbewegung tritt auf den Plan, nimmt erst Bologna, irgendwann Rom ein, die Kirche verliert an Macht, der Papst, einführend noch an seinem Schreibtisch vor einer riesigen Weltkarte inszeniert, stürzt verzweifelt eine Treppe hinunter, und Edgardo sieht sich irgendwann einem seiner Brüder gegenüber, als der mit den Nationalisten die heiligen Hallen stürmt.
Zugleich findet Die Bologna Entführung allerlei Raum für Details und sogar für Ausflüge ins Surreale, wenn Edgardo in seiner Fantasie Jesus entkreuzigt oder wenn das päpstliche Unbewusste aus einem Gerücht einen Albtraum jüdischer Rache spinnt, in dem sich eine Schar an Rabbinern eines Nachts über ihn hermacht, um ihn zu beschneiden.
Von der Geschichte gemeißelte Körper
 Überhaut habe ich lange keinen Film mehr gesehen, in dem sich die große Geschichte so überzeugend im Kleinen spiegelt wie hier: Mit dem Machtwechsel ist die Entführung, die einst als heiliger Akt aus Rom begründet werden konnte, auf einmal eine Straftat, der katholische Richter, der sie im Auftrag des Papstes durchführte, auf einmal Angeklagter vor einem Gericht in Bologna. Und Edgardo, der verlorene Sohn, der Fluchtpunkt aller Mühen einer jüdischen Familie, ist auf einmal deren schwarzes Schaf, das am Totenbett der Mutter erst beseelt begrüßt, dann wütend abgewiesen wird.
Überhaut habe ich lange keinen Film mehr gesehen, in dem sich die große Geschichte so überzeugend im Kleinen spiegelt wie hier: Mit dem Machtwechsel ist die Entführung, die einst als heiliger Akt aus Rom begründet werden konnte, auf einmal eine Straftat, der katholische Richter, der sie im Auftrag des Papstes durchführte, auf einmal Angeklagter vor einem Gericht in Bologna. Und Edgardo, der verlorene Sohn, der Fluchtpunkt aller Mühen einer jüdischen Familie, ist auf einmal deren schwarzes Schaf, das am Totenbett der Mutter erst beseelt begrüßt, dann wütend abgewiesen wird.
Denn es gibt kein Happy End, kein Rückmissionierung, weil wir alle von der Geschichte gemeißelte Körper mit von allen möglichen Umständen gefärbten Biografien sind. Edgardo ist keine souveräne Figur, sondern Spielball der Geschichte, trotz alledem oder gerade deshalb trauern wir um ihn.
 ‚Wer nur den lieben Gott läßt walten‚ …
‚Wer nur den lieben Gott läßt walten‚ …
in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem allerhöchsten traut/ der hat auf keinen Sand gebaut“ – dieser zum Trost gedachte Text (oben draufgeklickt lässt sich dieser Text im Film „Vaya con Dios) auch vielfältig und wünderschön anders deuten…) – für all jene, welche mühsam und beladen hinieden in diesem Jammertal noch immer sich zu bewegen gezwungen sehen – was Wunder, dass solche Menschen wie Verdurstende nach jeder Flasche greifen, und, alldieweil nämlich – „und weil der Mensch ein Mensch ist“ – und des Trostes bedarf, mithilfe einer solchen dessen teilhaftig zu werden versucht. Wohl dem, dems hilft …
Zwar sind die Leistungen der Schulmedizin zweifellos auf einigen Gebieten bewundernswert, aber freilich ist deren Sicht etwa bei ernsten Krankheiten meist sehr begrenzt. Insofern werden – dann – viele Patienten mit der Diagnose „austherapiert“ abgespeist und oft genug allenfalls mit chemischen Keulen behandelt. (mehr …)




