 Der staunenerregende Führungsstil des neuen Mannes auf dem Stuhl Petri hat viele Facetten; eine wichtige hat mit Jorge Mario Bergoglios jesuitischem Hintergrund zu tun: mit der Kunst, abzuwägen, zu unterscheiden – und zu handeln. Noch nicht lange ist es her, dass ein amtierender Papst zurücktrat und ein neuer gewählt wurde – auf den Deutschen Joseph Ratzinger folgte der Argentinier Jorge Mario Bergoglio. Beide, Papst und Papst-Emeritus, leben inzwischen friedlich nebeneinander in der Vatikanstadt – ein neuer Zustand; denn in älteren Zeiten der Papstgeschichte war das Nebeneinander mehrerer Päpste meist von öffentlicher Unruhe und Kirchenspaltung begleitet.
Der staunenerregende Führungsstil des neuen Mannes auf dem Stuhl Petri hat viele Facetten; eine wichtige hat mit Jorge Mario Bergoglios jesuitischem Hintergrund zu tun: mit der Kunst, abzuwägen, zu unterscheiden – und zu handeln. Noch nicht lange ist es her, dass ein amtierender Papst zurücktrat und ein neuer gewählt wurde – auf den Deutschen Joseph Ratzinger folgte der Argentinier Jorge Mario Bergoglio. Beide, Papst und Papst-Emeritus, leben inzwischen friedlich nebeneinander in der Vatikanstadt – ein neuer Zustand; denn in älteren Zeiten der Papstgeschichte war das Nebeneinander mehrerer Päpste meist von öffentlicher Unruhe und Kirchenspaltung begleitet.
Jorge Mario Bergoglio ist seit undenklichen Zeiten der erste Papst, der nicht im Apostolischen Palast, sondern im vatikanischen Gästehaus der heiligen Marta wohnt – der neue Kardinalstaatssekretär ist ihm inzwischen dorthin nachgefolgt. Er vermeidet prunkvolle Kleidung – gleich bei seinem ersten öffentlichen Auftreten auf dem Balkon des Apostolischen Palastes gab es dieserhalb einen veritablen Krach mit dem Zeremoniar. Franziskus fährt oft mit gebrauchten Autos. Er isst und trinkt mit den anderen Bewohnern im Speisesaal des Gästehauses. Er sucht den Kontakt mit Menschen – den Blickkontakt bei Predigten, die Umarmung bei Generalaudienzen. Es sind nicht nur Kinder, es sind auch Alte, Kranke, Behinderte, Skrofulöse, in deren Nähe es ihn zieht, die er umarmt und küsst.
Der Franziskus-Effekt
 Leben – für Jorge Mario Bergoglio ist das Begegnung. «Ohne Menschen kann ich nicht leben. Ich muss mein Leben zusammen mit anderen leben», sagt er. Seine Menschennähe, seine Unbefangenheit, sein Lächeln, die Art, wie er einfach statt geistlicher Anreden «guten Tag» und «guten Abend» sagt oder die Gläubigen um ihr Gebet bittet, ehe er ihnen den Segen gibt – das alles hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, ist inzwischen um die Welt gegangen. Der Papst hat in nur wenigen Monaten das Bild der Kirche verändert. Inzwischen ziert er als «Mensch des Jahres» das Titelblatt von «Time».
Leben – für Jorge Mario Bergoglio ist das Begegnung. «Ohne Menschen kann ich nicht leben. Ich muss mein Leben zusammen mit anderen leben», sagt er. Seine Menschennähe, seine Unbefangenheit, sein Lächeln, die Art, wie er einfach statt geistlicher Anreden «guten Tag» und «guten Abend» sagt oder die Gläubigen um ihr Gebet bittet, ehe er ihnen den Segen gibt – das alles hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, ist inzwischen um die Welt gegangen. Der Papst hat in nur wenigen Monaten das Bild der Kirche verändert. Inzwischen ziert er als «Mensch des Jahres» das Titelblatt von «Time».
Plötzlich kommen aus Rom wieder gute Nachrichten. Die Pilgermassen auf dem Petersplatz bei den Generalaudienzen schwellen an: Wer den Papst sehen will, muss früh aufstehen, möglichst um sieben Uhr, wenn er das Eingangstor rechtzeitig erreichen will. Es ist eine Art Papstwunder, eine universelle Euphorie, ein Strom von Erwartungen – ganz ähnlich wie in den Anfängen von Johannes XXIII., dem Papst des Zweiten Vatikanischen Konzils und Vermittler im Konflikt der Weltmächte, mit dem Franziskus inzwischen oft verglichen wird.
Wodurch hat dieser Papst solche erstaunliche Veränderung bewirkt?
 Offensichtlich, indem er einige Selbstverständlichkeiten in den Mittelpunkt rückte, die vergessen oder vernachlässigt worden waren. Dass die Kirche für alle da ist und daher, um alle zu erreichen, «an die Ränder der Gesellschaft» gehen muss; dass sie, wenn sie den Armen helfen will, selbst arm sein, zumindest einen Hauch von Armut ausstrahlen muss; dass sie, wenn sie gegen Ungerechtigkeit und Egoismus kämpft, sich selbst prüfen muss, ob die eigenen Strukturen diesem Plan entsprechen; dass sie vor allem nicht um sich selbst kreisen, nicht in einem theologischen Narzissmus erstarren darf – daran erinnert der neue Papst nachdrücklich und oft mit drastischen Worten.
Offensichtlich, indem er einige Selbstverständlichkeiten in den Mittelpunkt rückte, die vergessen oder vernachlässigt worden waren. Dass die Kirche für alle da ist und daher, um alle zu erreichen, «an die Ränder der Gesellschaft» gehen muss; dass sie, wenn sie den Armen helfen will, selbst arm sein, zumindest einen Hauch von Armut ausstrahlen muss; dass sie, wenn sie gegen Ungerechtigkeit und Egoismus kämpft, sich selbst prüfen muss, ob die eigenen Strukturen diesem Plan entsprechen; dass sie vor allem nicht um sich selbst kreisen, nicht in einem theologischen Narzissmus erstarren darf – daran erinnert der neue Papst nachdrücklich und oft mit drastischen Worten.
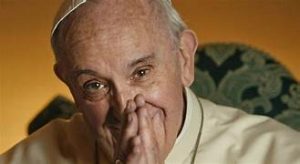 Wo hätte man früher in Bezug auf Kirche und Theologie, auf Vatikan und Kurie ähnliche Metaphern und Gleichnisse gehört, wie sie diesem bildkräftigen Lateinamerikaner aus der Seele und aus der Feder fliessen? Die Kirche – «ein Feldlazarett nach einer Schlacht». «Man muss einen Schwerverwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohem Zucker fragen. Man muss die Wunden heilen. Dann können wir von allem anderen sprechen.» Eine «verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Strassen hinausgegangen ist» – sie ist dem Papst lieber als eine Kirche, die «aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist». Eine Kirche soll ja «keine Zollstation» sein, sondern «das Vaterhaus, wo Platz ist für jeden mit seinem mühevollen Leben».
Wo hätte man früher in Bezug auf Kirche und Theologie, auf Vatikan und Kurie ähnliche Metaphern und Gleichnisse gehört, wie sie diesem bildkräftigen Lateinamerikaner aus der Seele und aus der Feder fliessen? Die Kirche – «ein Feldlazarett nach einer Schlacht». «Man muss einen Schwerverwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohem Zucker fragen. Man muss die Wunden heilen. Dann können wir von allem anderen sprechen.» Eine «verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Strassen hinausgegangen ist» – sie ist dem Papst lieber als eine Kirche, die «aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist». Eine Kirche soll ja «keine Zollstation» sein, sondern «das Vaterhaus, wo Platz ist für jeden mit seinem mühevollen Leben».
Kirche soll die Menschen nicht kontrollieren und gängeln
 Stattdessen soll diese Institution ermuntern und mitreissen – und das schliesst eine selbstbezogene Haltung, einen selbstgenügsamen Institutionalismus aus. Geistliche sind Diener, keine Apparatschiks. Für Fehlentwicklungen in der Kurie fällt Bergoglio sogar das Wort «Lepra» ein.
Stattdessen soll diese Institution ermuntern und mitreissen – und das schliesst eine selbstbezogene Haltung, einen selbstgenügsamen Institutionalismus aus. Geistliche sind Diener, keine Apparatschiks. Für Fehlentwicklungen in der Kurie fällt Bergoglio sogar das Wort «Lepra» ein.
Mit diesem Bild einer missionarischen, tätigen, Freude machenden Kirche im Blick – und dem weltweiten, hoffnungweckenden Echo im Kirchenvolk im Rücken – wäre Papst Franziskus wohl stark genug, die Arbeit seiner Vorgänger fortzuführen und zugleich neue Aufgaben auf den zahlreichen kirchlichen Baustellen der Gegenwart in Angriff zu nehmen. Was ist davon in seiner kurzen Amtszeit schon spürbar und sichtbar geworden? Wie strahlt die Mystik des neuen Papstes auf seinen Regierungsstil aus?
Papstthron – ist es noch ein Thron?
Es ist, das muss man sich klarmachen, der Regierungsstil eines Jesuiten. Franziskus ist der erste Papst der jüngeren Geschichte, der aus einem Orden kommt – der letzte war der Kamaldulenser Gregor XVI. (1831–1846). Franziskus betont immer wieder, dass Ordensleute Propheten sind, Propheten, die bezeugen, wie Jesus auf Erden gelebt hat, die sein Leben nachleben wollen – auch für andere. Insofern haben sie ein besonderes Gespür für jene Stellen in der Kirche, an denen prophetische Funktion und hierarchische Struktur auseinanderklaffen. Das bedeutet, dass man manchmal laut werden muss. «Die Prophetie», so Franziskus in einem Interview «macht Lärm, Krach – manche meinen ‹Zirkus›. Aber in Wirklichkeit ist es ihr Charisma, Sauerteig zu sein: Die Prophetie verkündet den Geist des Evangeliums.»
Es gibt wahrlich keinen Orden, in dem das Prophetische so überlegt organisiert wird:
Handgreiflich-praktisch organisiert – und ausgestaltet im Jesuitenorden. Darin verkörpert die Gesellschaft Jesu eine spezifisch neuzeitliche Geisteshaltung. Die radikale Infragestellung alles nur Überlieferten, Etablierten steht am Anfang – alles wird unter das Gesetz Gottes gestellt (darin glich er Ignatius Calvin). Die Radikalität aber des stetigen Neubeginns wird balanciert durch ein hohes Mass persönlichen Vertrauens und in vernünftig erzogene, der Sache hingegebene Menschen im Orden, ihre Individualität, ihre Urteilskraft, ihre Fähigkeit zur Unterscheidung. Daher achtet die Ordensleitung auf die Meinung vieler; sie gibt nicht einfach zentralistisch die Richtung vor. Der Ordensgeneral informiert sich gründlich, er fragt, vergewissert sich, ringt um Einsicht, betet. Die «Interpretatio Patris», die am Ende steht, ist weniger eine Vorgabe als ein Abschluss; sie spiegelt einen in einem längeren Prozess vielfältiger Unterscheidungen erreichten Konsens.
 Wiederholt hat Franziskus betont, dass er diese Kunst des Unterscheidens und Abwägens erst im Lauf der Zeit gelernt habe. In jungen Jahren als Provinzial habe er oft Entscheidungen zu rasch, zu improvisiert getroffen. Inzwischen weiss er: «Ich muss warten, innerlich abwägen, mir die nötige Zeit nehmen. Die Weisheit der Unterscheidung gleicht die notwendige Zweideutigkeit des Lebens aus und lässt uns die geeignetsten Mittel finden, die nicht immer mit dem identisch sind, was als gross und stark erscheint.»
Wiederholt hat Franziskus betont, dass er diese Kunst des Unterscheidens und Abwägens erst im Lauf der Zeit gelernt habe. In jungen Jahren als Provinzial habe er oft Entscheidungen zu rasch, zu improvisiert getroffen. Inzwischen weiss er: «Ich muss warten, innerlich abwägen, mir die nötige Zeit nehmen. Die Weisheit der Unterscheidung gleicht die notwendige Zweideutigkeit des Lebens aus und lässt uns die geeignetsten Mittel finden, die nicht immer mit dem identisch sind, was als gross und stark erscheint.»
Von hier erschliessen sich die bisherigen – spärlichen, aber wichtigen – Regierungsentscheidungen von Papst Franziskus in ihrem inneren Zusammenhang. Die Bischofssynoden – eine Frucht des Zweiten Vatikanischen Konzils – will er ausbauen und zugleich auf ein breiteres Fundament stellen: Alle Gläubigen, nicht nur die Bischöfe, sollen im Vorfeld zur jeweiligen Thematik befragt werden (das ist neu). Die Kurie will er reformieren – nicht von oben, auch nicht von innen, sondern von aussen: Ein Kollegium von acht Kardinälen aus allen Kontinenten soll dazu Vorschläge machen. (Schon jetzt versucht der Papst den Mangel an Kommunikation unter den Dikasterien, Räten und anderen Ämtern zu beheben, indem er sie zu gemeinsamen Konferenzen, einem «päpstlichen Ministerrat», zusammenruft.) Den Bischofskonferenzen will er mehr Selbständigkeit geben, organisatorisch, aber auch in der Lehre – im Sinn eines (längst fälligen) kirchlichen Föderalismus.
Wärew das ein gar revolutionäres Programm?
 Ich meine das nicht. Allerdings aber denke ich, es sei – im gegenwärtigen Katholizismus jedenfalls – eine heilsame Abkehr von institutioneller Statik und traditioneller Beharrungskraft. Alle Personen, alle Institutionen müssen sich nach dem Willen dieses Papstes befragen lassen, ob sie Personen und Einrichtungen des Dienstes sind. Sie können sich nicht mehr einfach auf den alten Verwaltungsgrundsatz berufen, dass man das «schon immer so gemacht» habe. Darin liegt eine gewaltige Relativierung, die Ämter und Menschen verändert. Auf einmal ist dann der Kardinalstaatssekretär – obgleich Regierungschef des Vatikanstaats – nur noch so etwas wie ein Generalvikar des Papstes, der Präfekt der Glaubenskongregation – obwohl er die Texte des Papstes mitliest – nur noch ein Generalredakteur der Glaubenszeugnisse der Weltkirche; diese Reihe läßt sich fortsetzen.
Ich meine das nicht. Allerdings aber denke ich, es sei – im gegenwärtigen Katholizismus jedenfalls – eine heilsame Abkehr von institutioneller Statik und traditioneller Beharrungskraft. Alle Personen, alle Institutionen müssen sich nach dem Willen dieses Papstes befragen lassen, ob sie Personen und Einrichtungen des Dienstes sind. Sie können sich nicht mehr einfach auf den alten Verwaltungsgrundsatz berufen, dass man das «schon immer so gemacht» habe. Darin liegt eine gewaltige Relativierung, die Ämter und Menschen verändert. Auf einmal ist dann der Kardinalstaatssekretär – obgleich Regierungschef des Vatikanstaats – nur noch so etwas wie ein Generalvikar des Papstes, der Präfekt der Glaubenskongregation – obwohl er die Texte des Papstes mitliest – nur noch ein Generalredakteur der Glaubenszeugnisse der Weltkirche; diese Reihe läßt sich fortsetzen.
 Dass es ihm an Selbstbewusstsein nicht fehlt, hat Jorge Mario Bergoglio mit seiner knappen – aber kühnen – Rede beim Konklave, in der er der egozentrischen, um sich selbst kreisenden Kirche den Kampf ansagte, und mehr noch mit der Annahme des Namens Franziskus bewiesen.
Dass es ihm an Selbstbewusstsein nicht fehlt, hat Jorge Mario Bergoglio mit seiner knappen – aber kühnen – Rede beim Konklave, in der er der egozentrischen, um sich selbst kreisenden Kirche den Kampf ansagte, und mehr noch mit der Annahme des Namens Franziskus bewiesen.
Ob er sein Programm allrtfings wird durchsetzen können, ist noch keineswegs gewiss. Einstweilen aber trägt ihn eine gewaltige Welle neuer Erwartungen nach langem Reformstau – und das lässt hoffen.
