
Das Dokumentationszentrum der Sinti und Roma in Heidelberg
Der Fall wirft Fragen auf!
Der Basler Fachausschuss Literatur will den neuen Roman des Schriftstellers Alain Claude Sulzer vorerst nicht fördern, weil darin das Wort „Zigeuner“ vorkommt. Sulzer spricht in der „NZZ am Sonntag von Zensur und hat sein Fördergesuch zurückgezogen.
Der Fall wirft Fragen auf?
Mal zum Beispiel diese: Wohin mit diesem Machwerk:
Brahms: Zigeunerlieder Op. 103 (1888)
l
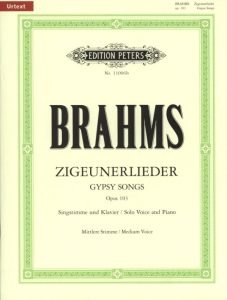 Der Schriftsteller Alain Claude Sulzer jedenfalls streitet sich derzeit mit dem Basler Fachausschuss Literatur wegen des in seinem Buch vorkommende Wort „Zigeuner“
Der Schriftsteller Alain Claude Sulzer jedenfalls streitet sich derzeit mit dem Basler Fachausschuss Literatur wegen des in seinem Buch vorkommende Wort „Zigeuner“
Der Roman mit dem Arbeitstitel «Genienovelle», an dem der Basler Autor Alain Claude Sulzer gerade schreibt, spielt anfangs im Bochum der 1960er und 1970er Jahre. Eine Gegend, die Sulzer gut kennt, weil er dort ein paar Jahre gelebt hat. Sein Freund war am Theater als Schauspieler tätig. Im Roman schildert der Ich-Erzähler die Geschichte seiner Freundschaft mit Frank, den er seit Kindesbeinen kennt. Man wohnt im gleichen Haus, «wir links, Reimers rechts», eines von vier «Reihenwohnblocks»: «Zwei Stockwerke unter uns hausten die Zigeuner, vor deren Wohnungstüren sich die Schuhe unordentlich neben- und übereinander stapelten. In ihren Wohnungen, in die sie den Strassendreck nicht hineintragen wollten, gingen sie vermutlich barfuss oder in Strümpfen, vielleicht trugen sie Hausschuhe. Auch wenn es die anderen Hausbewohner störte, es war unbestreitbar hygienischer, als die Wohnungen in Strassenschuhen zu betreten.»
oder diesen Widerwärtigkeiten:
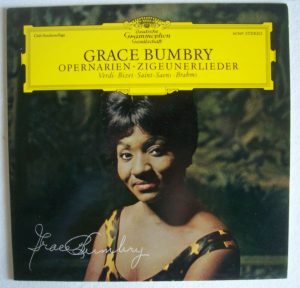 Am 14. März dieses Jahres reicht der 70-jährige Sulzer dem Fachausschuss Literatur Basel die ersten 19 Seiten seines mittlerweile zehnten Romans ein und bittet um staatliche Förderung, einen sogenannten Werkbeitrag. Das hat Sulzer immer so gemacht, immer problemlos. Man bekommt dann Geld, in Sulzers Fall um die 25 000 Franken – was nicht eben viel ist für jahrelange Arbeit. Schreiben ist ein karges Geschäft, da nimmt man gerne einen staatlichen Obolus.
Am 14. März dieses Jahres reicht der 70-jährige Sulzer dem Fachausschuss Literatur Basel die ersten 19 Seiten seines mittlerweile zehnten Romans ein und bittet um staatliche Förderung, einen sogenannten Werkbeitrag. Das hat Sulzer immer so gemacht, immer problemlos. Man bekommt dann Geld, in Sulzers Fall um die 25 000 Franken – was nicht eben viel ist für jahrelange Arbeit. Schreiben ist ein karges Geschäft, da nimmt man gerne einen staatlichen Obolus.
Am 30. Mai erhält Sulzer einen Brief von Dominika Hens, Beauftragte für Kulturprojekte und Vorsitzende des Fachausschusses, mit der Bitte «um Nachreichung einer Stellungnahme». Sulzer solle darlegen, was seine «Überlegungen beim Gebrauch der Bezeichnung „Zigeuner“ in der Textprobe» seien.
Der Duden markiert „den Gebrauch des Wortes“ als diskriminierend».
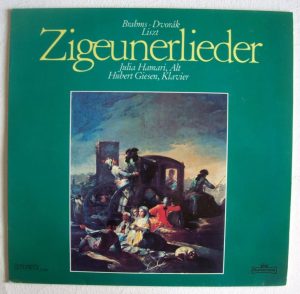 Ferner bitte der Fachausschuss auch darum, „zu erläutern, welche Relevanz die stereotype Beschreibung des Wohnumfelds des jugendlichen Protagonisten, in deren Zusammenhang die genannte Bezeichnung eine zentrale Rolle einnimmt, für das Gesamtprojekt haben wird“.
Ferner bitte der Fachausschuss auch darum, „zu erläutern, welche Relevanz die stereotype Beschreibung des Wohnumfelds des jugendlichen Protagonisten, in deren Zusammenhang die genannte Bezeichnung eine zentrale Rolle einnimmt, für das Gesamtprojekt haben wird“.
Sulzer zieht sein Fördergesuch sofort zurück. Er sagt: „Ich werde mich für meinen Text nicht vor einer Zensurbehörde rechtfertigen. Denn so etwas ist nichts anderes als das: Zensur. Würde ich nämlich das Wort ändern oder die Zigeuner-Szenen gar streichen, bekäme ich das Geld.“
In der Tat muss man staunen angesichts des Briefes der Förderstelle. Natürlich wird die Bezeichnung „Zigeuner“ heute als herabsetzend empfunden, weshalb man sich im öffentlichen Schreiben und Sprechen auf die Begriffe Sinti und Roma geeinigt hat. Nur, dieser Roman spielt nicht in der Gegenwart – Obige Schallplatten – neben vielen anderen – aber schon.
Und, warum sollte ein Ich-Erzähler nicht so reden dürfen, wie man damals geredet hat? Wieso sollte ein Text nicht benennen und schildern dürfen, was war? Wir meinen, er muss!
In den 1960er und 1970er Jahren, in denen der Roman von Sulzer handelt, redete man wie selbstverständlich von „Zigeunern“. Es gab noch gar kein „Problembewusstsein“, geschweige denn einen anderen Begriff. Und die Schilderungen der „Zigeuner“ im Buch, die man heute vielleicht als abstossend empfindet, treffen präzise die damals herrschende Stimmung in der deutschen Mehrheitsgesellschaft (sie dürften nota bene im Übrigen auch heute noch nicht völlig ausgeräumt sein). Und sind deshalb alles andere als „stereotyp“.
Doch, sie können lesen:
Das Gesuch von Sulzer gab in der Sitzung des Ausschusses vom 8. Mai durchaus zu reden. Darauf muss man jedenfalls schliessen, weil Ausschussmitglied Bettina Spoerri, Autorin und Verlegerin, diese Woche aus Protest gegen den Umgang mit Sulzers Gesuch ihren sofortigen Rücktritt aus dem Gremium erklärt hat. Dies hat Spoerri bestätigt.
Die anderen Mitglieder schweigen
Das tun sie, weil sie eine „Stillschweigeklausel“ unterschrieben haben, worauf sie diese Woche im Zuge der Recherchen der NZZ von der Abteilung Kultur des Kantons Basel-Stadt nochmals eindringlich hingewiesen wurden. Aber man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass die Schriftstellerin Dana Grigorcea, ebenfalls Mitglied des Ausschusses, mit ihrer Vergangenheit im rumänischen Kommunismus, einem solchen Vorgehen stillschweigend zugestimmt hat. Die andern aber, drei Männer und die Vorsitzende, haben das Vorgehen, das der Autor als „Zensur“ bezeichnet, offenbar unterstützt.
Zum Geschehen passt auch, dass die Mitglieder des Fachausschusses
vom Amt verpflichtet worden sind, einen halbtägigen Diversity-Kurs zu belegen
Das Amt begründet diese Massnahme wie folgt: „Von Kunst- und Kulturschaffenden in der Region wurde die Weiterbildung unserer Gremien im Hinblick auf Diversitätsfragen explizit gewünscht. Die Abteilung Kultur Basel-Stadt und das Amt für Kultur Basel-Landschaft haben daher entschieden, dass alle unsere Mitarbeitenden (sic) und alle Mitglieder von Gremien und Jurys Weiterbildungen im Bereich Diversität besuchen sollen.“ Warum muss man einen Diversity-Kurs besuchen, um schlechte von guter Literatur unterscheiden zu können? https://www.youtube.com/watch?v=Vzg4GrpZHoQ
Die schriftlichen Antworten von Katrin Grögel lassen nichts Gutes erwarten. Die Leiterin der Abteilung Kultur Basel-Stadt „bedauert“ den Rückzug von Sulzer, sie habe sich „einen Dialog“ mit ihm erhofft. Und gleichzeitig weist sie jegliche Kritik von sich. Den Zensurvorwurf des Schriftstellers findet sie „haltlos“: „Die Kunstfreiheit wird von uns vollumfänglich respektiert.“ Ferner schreibt sie auf Anfrage: „Stereotype Beschreibungen von Menschen können ein stilistisches Mittel, zugleich aber auch verletzend für Betroffene sein. Entsprechend sorgsam gilt es damit umzugehen und dem Autor den Raum zu geben, seine künstlerischen Überlegungen darzulegen.“
Der Basler Vorgang ist Teil einer grösseren Entwicklung
Die sogenannte #-Literatur, die ausserliterarische Kriterien wie Achtsamkeit, Vielfalt, Moral und andere Befindlichkeiten in der Regel höher gewichtet als Sprache und Inhalt, ist auf dem Vormarsch. Die Frage ist eine brisante: Wird Literatur, die weh tut und nicht geglättet ist, von einem Staat, der es möglichst allen recht machen will, immer seltener gefördert?
