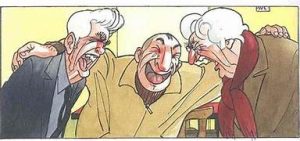 Wenn wir unter der Schöpfung auch die Moralfähigkeit sehen, sind wir ganz sicherlich die Krone, weil nur der Mensch moralfähig ist. Und kein anderes Wesen, soweit wir es bisher kennen. Aber: Hierarchien stehen für Macht, für Normen. Müssen wir nicht eher ganzheitlich denken, um so der Realität gerecht zu werden, dass eben alles Leben zusammenhängt? Das ist selbstverständlich.
Wenn wir unter der Schöpfung auch die Moralfähigkeit sehen, sind wir ganz sicherlich die Krone, weil nur der Mensch moralfähig ist. Und kein anderes Wesen, soweit wir es bisher kennen. Aber: Hierarchien stehen für Macht, für Normen. Müssen wir nicht eher ganzheitlich denken, um so der Realität gerecht zu werden, dass eben alles Leben zusammenhängt? Das ist selbstverständlich.
Wir als Menschen stehen nun mal im Kontinuum der Natur, sind zwar biologische Wesen, ganz ohne Zweifel, aber wir sind auch Kulturwesen und auch Moralwesen. De Aufgabe des Menschen sei, diese drei Dimensionen zu beachten. Er möge seine eigene Biologie nicht vergessen, er muss sich ja – schlußendlich – auch ernähren und, er stammt gewisserweise auch aus der Natur in Form der Evolution. Er sollte auch nicht vergessen, dass ein ganz großer Fortschritt in der Unterscheidung auch zu anderen Wesen, zum Beispiel zu Primaten, die Kultur ist. Primaten haben keine Bibliotheken. Primaten haben keine Musik und andere Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten. Weshalb eine Generation der Primaten ungefähr dasselbe kognitive und kulturelle Niveau hat wie die Generation davor. Die Menschen werden mit jeder Generation Veränderungen vornehmen und in mancher Hinsicht aber auch Fortschritte machen.“
Der Tübinger Philosoph Manuel Kraft bezieht sich auf Aristoteles und dessen Stufenleiter des Lebens, die scala naturae. Darin folgt er Charles Darwin. Der Begründer der Evolutionstheorie sah in dem antiken Philosophen auch das naturwissenschaftliche Genie. Kann sich eine zeitgemäße Philosophie des Lebens heute noch am Denken der Griechen orientieren?
„Aristoteles hat uns gewisse Denkmuster vorgegeben, und gerade die scala naturae, also die Stufenfolge, ist von ihm sehr detailliert ausgearbeitet worden. Und die Darwinsche Evolutionstheorie ist in gewisser Weise eine Verfeinerung mit einer historischen Perspektive, die allerdings Aristoteles fremd war, Evolutionstheoretiker jedenfalls war er nicht. Aber er hat diese Folge gesehen zudem von Anorganischen, Pflanzen, Tieren, Mensch, und im Rahmen der Pflanzen und Tiere noch viele Unterscheidungen und Differenzierungen.“
Menschen können als einzige Wesen moralisch entscheiden und handeln. Nicht nur deshalb sind wir für manch Maßlose das Maß aller Dinge.
Aber auch unsere intellektuellen Fähigkeiten und Freiheiten unterscheiden uns von Tieren.
„Alsdann: Nehmen wir Krone der Schöpfung zunächst als etwas neutral, sehe wir – zumindest – insgesamt drei Möglichkeiten:
Einmal: Der Mensch ist das einzige Wesen, das nutzenfrei, nicht utilitär forscht. Auch nach dem Muster von Aristoteles, wir sind von Natur aus neugierig.
Das Zweite ist die Moralfähigkeit, und das ist keine Rangfolge.
Und das Dritte aber auch eine überwältigende Fähigkeit zu Technik und Medizin.“
Der Mensch ist für seinesgleichen verantwortlich
Aber er hat weitere Aufgaben. Als einziges Wesen, das in der Lage ist, die globale Natur zu zerstören, steht er in der Pflicht, das irdische Leben zu schützen. Doch welche Rechte haben seine Mitbewohner auf dem Planeten Erde? Wer oder was schützt die anderen vor uns?
Also zunächst mal die Moralfähigkeit schützt die anderen. Weil wir Moralwesen sind, wissen wir um unsere Verantwortung, wir wissen aber wiederum als Moralwesen wiederum auch, dass wir mit einer überragenden Technik und auch mit zum Teil sehr engen Gewinninteressen die Natur wirklich beherrschen, ausbeuten, unterdrücken. Was zunächst uns Menschen selber schadet, aber auch anderen Wesen, zum Beispiel leidensfähigen Wesen in ihrem Recht auf Leid zu schützen, eingreift. Es schützt also am Ende nur die Moral davor. Glücklicherweise ist der Mensch ein Wesen, das tatsächlich moralfähig ist (sein kann) und auch moralbewusst. Gerade unter den großen Denkern gibt es fast nur Vertreter eines hohen Maßes an Verantwortung. Und fast gar keine Philosophen, die sich über diese Interessen hinwegsetzen.

………………Hahahahaaaa ………
Die Idee der „Krone der Schöpfung“ legt aus, was wir vorfinden: Der Mensch steht ganz oben, er hat die Macht, die Welt zu vernichten, er kann sie aber auch bewahren. Bescheiden klingt das kaum. Was aber, wenn wir doch nicht die Ultima Ratio der Evolution wären? Immerhin werden große Teile unseres Gehirns nicht genutzt. Was wäre, wenn wir entwicklungsbiologisch bloß eine Vorstufe anderer, höherer Wesen wären? An der aristotelischen Stufenleiter würde das nichts ändern:
Ich bin gegenüber solcherlei Gedanken sehr skeptisch, dass es nämlich grundsätzlich noch höherrangige Wesen gibt. Sehen wir mal ab von reinen Intelligenzwesen, das, was traditionell Engel oder die Gottheit genannt wird. Das was für den Menschen charakteristisch ist, ist, dass er einerseits ein leibgebundenes Wesen ist, das andererseits eben über Verstand, Vernunft verfügt, ob wir schon das volle Gehirn ausnutzen oder erst einen Teil, ich nehme an im Laufe der Zivilisationsgeschichte der letzten hunderttausenden Jahren ist das Gehirn immer mehr ausgenutzt worden verglichen mit früher. Und das kann weiter gesteigert werden. Insofern gibt es vielleicht später noch mal intelligentere Gesellschaften, intelligenter zunächst in einem neutralen, kognitiven Sinne. Ob die deshalb moralischer sind, weiß ich nicht, ich würde es zwar hoffen, aber das ist eine andere Frage. Aber das, was den Menschen qualitativ auszeichnet vor den subhuman Lebewesen, diese drei Dinge: eine exponentiale Medizin, Technik und auch Gewinnsucht – das hat auch negative Seiten. Zweitens, die Fähigkeit, nicht utilitär, rein nutzenfrei die Natur zu erforschen und auf diese Weise Achtung vor der Natur zu bekommen, und drittens, ein Moralwesen zu sein, das allerdings auch verführbar ist, also ein nicht reines Moralwesen zu sein, das glaube ich wird durch eine weitere Ausnutzung unseres Gehirns nicht strukturell geändert.“
