Wäre denn also Angst etwas Gutes?
Auf jeden Fall. Wenn Sie (hierzulande) nachts um eine dunkle Ecke oder durch den (irgendeinen) Dschungel laufen und eine Schlange sehen, löst die Angst eine Kampf-oder-Flucht-Reaktion im Körper aus – und Sie machen einen Satz nach hinten. So ähnlich wie bei einem modernen Auto, das merkt: Gleich passiert ein Unfall. Die Sicherheitsgurte werden angespannt, das Schiebedach geht zu, die Airbags blasen sich auf. Alles passiert synchron und holter die polter.
Es muss ja auch schnell gehen, sonst wäre es zu spät – übrigens kann eine Schlange (wer hätte das gedacht) mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 Kilometern pro Stunde zuschlagen.
Was genau passiert dabei im Körper?
Über verschiedene Botenstoffe wird das sympathische Nervensystem aktiviert, auch Sympathikus genannt. Alle Sinnesorgane werden auf Wachsamkeit getrimmt. Dadurch reißen wir zum Beispiel die Augen auf, um die Umgebung besser wahrzunehmen. Und der Puls steigt, weil das Herz kräftig schlägt, um das Blut umzuverteilen: Es wird aus den kleinen Blutgefäßen abgesaugt und in die Muskeln von Armen, Beinen und Rumpf gepumpt, damit wir besser kämpfen und weglaufen können.
Bekommen wir deshalb „kalte Füße“?
Genau, weil das Blut in den feinen Gefäßen der Haut fehlt. Aus diesem Grund werden wir, wenn wir Angst haben, auch blass vor Schreck. Manche spüren ein Kribbeln oder Taubheit in Fingern und Gesicht. Oder ihnen wird schwindelig, weil der Kopf eben falls weniger durchblutet wird. Die Atmung beschleunigt sich, um den Körper besser mit Sauerstoffzu versorgen. Viele spüren dann Luftnot, ihre Muskeln zittern vor Anspannung, und sie schwitzen, weil die Körpertemperatur steigt. Neben dem Sympathikus ist bei Angst auch die Stressachse im Körper aktiv.
Was macht die Stressachse?
Sie verbindet das Gehirn mit der Nebenniere. Dort werden die Hormone Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet, die uns in einen Alarmzustand versetzen. Cortisol sorgt zudem dafür, dass der Körper seine Energiereserven in Form von Zucker und Fetten angreift und viel Sauerstoffverbraucht. Deshalb fühlt man sich so erschöpft, wenn man sich lange gefürchtet hat.
Warum fällt es so schwer, unsere Angst zu kontrollieren?
Es gibt zwei neuronale Systeme, die bei Angst gegeneinander arbeiten: ein »Vernunftgehirn« hinter der Stirn im präfrontalen Kortex, das evolutionär recht jung ist, und ein uraltes und primitives »Angstgehirn« tief im Hirnstamm. Das Angstgehirn hat keinen Hochschulabschluss. Man kann mit ihm nicht vernünftig reden. Auch wenn das Vernunft- gehirn weiß, dass die meisten Spinnen in Deutschland harmlos sind, schürt das Angstgehirn trotzdem Spinnenangst: »Fass das Ding bloß nicht an!« Es funktioniert selbst dann noch, wenn man kurz vor dem Koma ist und nicht mehr nachdenkt.
Angst vor Spinnen mag dort sinnvoll sein,
wo es viele giftige Arten gibt, aber woher rührt
zum Beispiel eine Furcht vor Vögeln?
Spüren wir also noch heute vor allem Ängste, die vor Urzeiten entstanden?
Es gibt zumindest keine Steckdosenphobie. Oder eine Phobie vor Zigaretten und gesättigten Fettsäuren, obwohl das die wahren Killer sind. All die Dinge, die heute Menschen mit Phobien ängstigen, waren vor 100 000 Jahren auch schon da.
Aber rührt daher auch die Angst vor anderen, fremden Menschen, die viele quält?
Menschen mit einer solchen sozialen Phobie haben Angst, sich peinlich zu verhalten und von anderen abgelehnt zu werden. Früher haben wir in Stämmen gelebt, deren Mitglieder zusammenhalten mussten, um Nahrung, Gebiete, Frauen und Kinder gegen andere Stämme zu verteidigen. Wer meinte, er könne sein eigenes Ding machen und den Stamm verlassen, war schutzlos oder ist verhungert. Sozial zu denken sicherte dagegen das Überleben. In einem sehr einfach gestrickten Teil unseres Gehirns ist dieses Stammesdenken immer noch abgespeichert. Die soziale Phobie bewahrt uns vor dem Ausschluss aus der Gruppe. Ein gewisser Respekt, eine Zurückhaltung und Bescheidenheit gegenüber anderen ist natürlich, dieses Verhalten darf nur nicht überhandnehmen.
Hat jeder von uns übertriebene Ängste?
Zumindest wird jeder mit einem typischen Satz von Ängsten geboren. Bei dem einen sind sie stärker ausgeprägt, bei dem anderen schwächer. Die Spinnenphobie soll bis zu 80 Prozent der Deutschen betreffen. Ich hatte früher selbst Panik, wenn ich einen Weberknecht, also eines dieser besonders langbeinigen Spinnentiere, aus einem Zimmer jagen musste.
Entwickeln sich Ängste nicht erst, wenn wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben?
Selten. Nur rund die Hälfte der Menschen mit einer Hundephobie ist mal gebissen worden oder hat eine andere negative Begegnung mit Hunden gehabt. Dagegen berichten fast 70 Prozent der Leute ohne Hundephobie von schlechten Erfahrungen mit den Tieren. Von den Menschen mit Höhenangst sind sogar nur 18 Prozent bereits aus großer Höhe heruntergefallen. Und kaum jemand mit einer Klaustrophobie, also »Platzangst«, war schon in einem Fahrstuhl eingesperrt. Umgekehrt: Wenn ein Kind an eine heiße Herdplatte fasst, e ntwickelt es danach keine Phobie vor dem Herd, sondern lediglich Respekt. Zwischen »Angst haben« und »vorsichtig sein« wird oft nicht genau unterschieden.
Wann gelten Ängste als krankhaft?
Wenn man die Hälfte des Tages über die Angst nachdenkt. Wenn man anfängt, wegen der Angst sein Leben zu verändern, zum Beispiel nicht mehr Auto fährt, obwohl man weiß, dass man das Fahren beherrscht. Oder wenn man sich bei der Ausübung seines Berufes oder im Kontakt mit anderen Menschen beeinträchtigt fühlt.
Welche Angststörungen kommen besonders häufig vor?
Angststörungen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Die einfachen Phobien, also Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen, stehen ganz oben in der Statistik. Es kommt aber selten vor, dass Menschen zum Psychologen oder zur Psychiaterin gehen, weil sie zum Beispiel Angst vor Spinnen haben. Die meisten versuchen, alleine damit zurechtzukommen. In einer Klinik behandeln wir besonders oft die Panikstörung.
Was ist eine Panikstörung?
Bei Menschen mit einer Panikstörung kann die Kampf-oder-Flucht-Reaktion ohne einen äußeren Anlass auftreten: Sie sitzen auf dem Sofa und bekommen wie aus dem Nichts eine Panikattacke. Als ob man mit dem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes steht und auf einmal die Airbags hochgehen. Bei solch einer Panikattacke sind die Symptome wie Herzrasen und Schwindel so stark, dass die Betroffenen denken, sie könnten ohne die Hilfe eines Arztes nicht überleben. Ihr Vernunftgehirn ist ausgeschaltet.
Und wie fühlen sich andere Angststörungen für die Betroffenen an?
Panikattacken können auch bei anderen Angsterkrankungen vorkommen. Wenn ein Student mit einer sozialen Phobie zum medizinischen Staatsexamen geht, spürt er ebenfalls Panik. Er denkt aber nicht, er könnte sterben, sondern weiß, warum er so fühlt: Weil er die Bewertung durch andere fürchtet, in diesem Fall durch den Prüfer, und die Blamage durchzufallen. Bei der generalisierten Angststörung empfinden die Betroffenen zwar keine Panik, dafür haben sie den ganzen Tag mal das eine, mal das andere Angstsymptom. Etwa weil sie diffuse Ängste um ihre Verwandten spüren.
Welche Faktoren begünstigen die Entwicklung einer Angststörung?
In einer Studie haben wir herausgefunden, dass Menschen, die in der Kindheit ein schweres Trauma wie sexuellen Missbrauch erlebt haben, später eher unter Panikattacken oder anderen Angststörungen leiden. Die Vererbung spielt aber eine größere Rolle. Zudem tritt jede Erkrankung in einem bestimmten Alter am häufigsten auf. Panikstörungen zum Beispiel durchschnittlich mit 37 Jahren, soziale Phobie früher, generalisierte Angststörung später.
Rund 15 PROZENT der Menschen in Deutschland haben starke Flugangst
Woran liegt das?
Kinder sind wenig ängstlich. Stattdessen haben sie eine Art Neugiertrieb, der ihnen beim Lernen hilft und die Ängste unterdrückt. Wenn dieser Trieb nachlässt, kommen die bis dahin verborgenen Ängste zum Vorschein. Später im Leben nehmen sie wieder ab. Diese Gelassenheit entsteht wohl dadurch, dass die Rezeptoren, die an Angst beteiligt sind, weniger empfindlich werden. 65-Jährige haben nur noch selten Panikattacken.
Was hilft gegen eine Angststörung?
Medikamente, vor allem Antidepressiva, oder Methoden aus der Psychotherapie. Bei der Behandlung von Phobien kann etwa die Konfrontation mit den Ängsten sehr wichtig sein. Denn das primitive Angstsystem reagiert vor allem auf Taten, nicht auf Worte. Wenn ich Angst vor Hunden habe, muss ich mit Hunden spazieren gehen.
Wie genau läuft so etwas ab?
Funktioniert das bei allen Angststörungen?
Nein. Bei der generalisierten Angststörung wird die Technik der Reaktionsvermeidung eingesetzt. Eine betroffene Mutter, die sich ständig sorgt, dass ihr Sohn einen Autounfall haben könnte, und ihn deshalb täglich mehrfach anruft, muss dann aushalten, eine längere Zeit nicht anzurufen. Auf diese Weise soll sie sich an das Gefühl der Ungewissheit gewöhnen. Ähnlich werden auch Panikstörungen behandelt, bei denen die Attacken plötzlich auftreten. Wenn die Betroffenen das nächste Mal fürchten, einen Herzinfarkt zu bekommen, dürfen sie keinen Notarzt rufen und sich nicht mit Blaulicht in die Klinik fahren lassen. Sie lernen, dass die Symptome wieder nachlassen, weil es sich um Panik und nicht um einen Infarkt handelt. Die Reaktionsvermeidung hilft nicht so gut, wie es in vielen Büchern steht, aber zumindest kann sie die schlimmsten Auswüchse der Angst eindämmen.
Und was hilft Menschen mit einer sozialen Phobie?
Typischerweise üben sozialphobische Menschen in einer Therapie genau jene Situationen, in denen es für sie auf ein selbstbewusstes Auftreten ankommt. Sie halten etwa in einer Gruppe Vorträge oder müssen mit einem Verkäufer verhandeln und dann doch nichts kaufen. Da ist Standhaftigkeit gefragt, die man auf andere Situationen übertragen kann.
Manche Menschen suchen regelrecht den Kick. Sie lieben Fallschirmsprünge oder schnelle Motorradfahrten. Spüren die gar keine Angst?
Es gibt eine Lust an der Angst. Denn in Furcht einflößenden Situationen werden auch Endorphine ausgeschüttet. Diese Hormone erzeugen Euphorie, die einen glauben lässt, dass man den Kampf gewinnen kann. Und sie lindern Schmerzen, damit man nicht völlig aufgibt.
Etwa jeder 11. Erwachsene erlebt mindestens einmal in seinem Leben eine Panikattacke
Ich empfinde aber keine Lust, wenn ich ängstlich bin.
Nicht währenddessen, sondern danach. Wenn Sie in der Achterbahn Angst haben, aus der Kurve zu fliegen, und dann die Kurve gekriegt haben, ist die fliegen-Angst weg, doch die Endorphine sind noch im Blut.
Manche Menschen, die zum Beispiel von Natur aus weniger dieser Stoffe haben, versuchen, die Ausschüttung künstlich anzustacheln, indem sie auf der Überholspur leben.
Was ist zu tun, wenn die Angst zu groß wird?
Auch wenn es nicht einfach ist: Versuchen Sie, rational zu denken. Das Angstgehirn kriegt zum Beispiel bei Gewitter einfach Panik. Das Vernunftgehirn aber kann dann sagen: »Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du vom Blitz getroffen wirst, ist sehr gering – vor allem, wenn du vorsichtig bist.« Es lohnt sich, wieder und wieder das Vernunftgehirn aktiv zu nutzen. Oder umgekehrt: Schenken Sie dem Angstgehirn nicht so viel Aufmerksamkeit!
Therapie für zu Hause – Digitale Hilfe
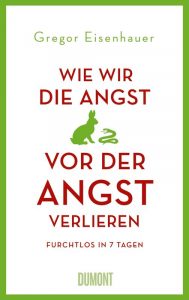 Nicht alle Menschen, die von Ängsten gequält werden, finden schnell genug Unterstützung. Oft müssen sie lange auf einen Termin bei einem Therapeuten warten. Daher suchen Wissenschaftler, Therapeuten und Krankenkassen zunehmend nach Wegen, wie auch technische Hilfsmittel dabei helfen können, Ängste zu lindern.
Nicht alle Menschen, die von Ängsten gequält werden, finden schnell genug Unterstützung. Oft müssen sie lange auf einen Termin bei einem Therapeuten warten. Daher suchen Wissenschaftler, Therapeuten und Krankenkassen zunehmend nach Wegen, wie auch technische Hilfsmittel dabei helfen können, Ängste zu lindern.
Leseprobe und Details zum Buch – das uns empfohlen wurde, das wir aber noch nicht gelesen, mithin nicht rezensiert haben. Jedoch kennen wir den Verlag Dumont, der für Qualität bürgt – Betroffene können etwa in virtuellen Simulationen den Auslösern ihrer Furcht entgegentreten, mithilfe von Apps die Veränderungen ihrer Gefühle im Alltag aufzeichnen oder über das Internet Hilfe von Spezialisten via E-Mail, Chat oder Video erhalten. Die meisten Angebote beruhen auf den Prinzipien der Verhaltenstherapie. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) führt geprüfte Konzepte im neuen Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen (Diga): diga.bfarm.de. Zwei Angebote, die ihre Wirksamkeit unter Beweis gestellt haben, sind:
Velibra Als Gesundheitsanwendung zertifiziertes Selbstmanagement-Programm. Es reagiert individuell auf Antworten der Nutzer, ein Therapeut ist nicht beteiligt.
Es kann von Ärzten auf Rezept verschrieben werden. de.velibra.com
Invirto Dieses als Medizinprodukt anerkannte Angebot basiert auf Verhaltenstherapie mit Expositionstraining. Die Konfrontation mit der Angst findet dabei mithilfe einer Virtual-Reality-Brille statt. Bedeutsame Schritte werden per Video oder Telefon mit Therapeuten besprochen. invirto.de

