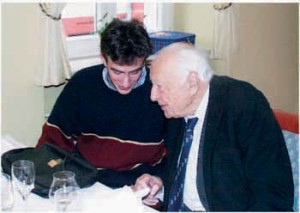Oliver Nachtwey und Carolin Amlinger haben die Querdenker-Szene von Anfang an begleitet. Im Interview erklären sie, warum viele nicht mehr zurück können.

Ruhegelder für Senderchefs kosten ARD und ZDF Millionen.
Gut gesichert: Vielen Führungskräften von ARD und ZDF stehen vor der Rente sechsstellige Ruhegelder zu, ergibt eine NDR-Recherche. RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus(von links) habe Anspruch auf ein jährliches sechsstelliges Ruhegeld, wenn der Sender seinen Vertrag nach Ablauf nicht verlängere. Die stellvertretende Intendantin des NDR, Andrea Lütke, könne ebenfalls bis zur Rente mit Ruhegeld rechnen, sollte sich der Sender von ihr trennen. Der MDR hat insgesamt mehr als 15 Mio Euro für die Versorgung seiner Intendantin Karola Wille und der acht Direktorinnen zurückgelegt, das ZDF rund 20 Mio Euro. Der WDR hat sich zwar von der Ruhegeld-Regelung verabschiedet, hat aber für vier Führungskräfte um die 14 Mio Euro für Pensionen zurückgestellt. SR und Deutschlandradio zahlen keine Ruhegelder.
tagesschau.de, turi2.de (Background)
– Anzeige –

Laut aktuellen IVW-Zahlen sind BILD (Mo-Sa) und BILD am SONNTAG (So) auch weiterhin die Marktführer im Segment der Tages- und Sonntagszeitungen.
mediaimpact.de
(* IVW Q3/2022, Tages- und Sonntagszeitungen, Verkauf gesamt: BILD Deutschland Gesamt (inkl.B.Z.): 1.187.291 Exemplare und BILD am SONNTAG: 622.814 Exemplare)
– NEWS –
 Grauzone: Der SWR will gegen das Urteil des Landgerichts Stuttgart Berufung einlegen, das die Verbreitung der App Newszone in einer früheren Version untersagt. Die App, die Nachrichten von dasding.de anbietet, sei laut Gericht teilweise zu presseähnlich. SWR-Intendant Kai Gniffke sieht in der App kein separates Angebot, sondern einen „Ausspielweg, der genau für die hier in Frage kommende Zielgruppe relevant ist“.
Grauzone: Der SWR will gegen das Urteil des Landgerichts Stuttgart Berufung einlegen, das die Verbreitung der App Newszone in einer früheren Version untersagt. Die App, die Nachrichten von dasding.de anbietet, sei laut Gericht teilweise zu presseähnlich. SWR-Intendant Kai Gniffke sieht in der App kein separates Angebot, sondern einen „Ausspielweg, der genau für die hier in Frage kommende Zielgruppe relevant ist“.
presseportal.de, turi2.de (Background)
 Es hackt: Beim Cyber-Angriff auf einen IT-Dienstleister der dpa Anfang Oktober sind die Täterinnen offenbar an Gehaltsabrechnungen und Kontodaten von rund 1.500 Beschäftigten gelangt, berichtet „Spiegel“. Die Hacker-Gruppe „Black Basta“ könne damit Identitäten stehlen und für betrügerische Geschäfte verwenden. Die Gruppe sei auch für den Angriff auf den Autovermieter Sixt Ende April verantwortlich.
Es hackt: Beim Cyber-Angriff auf einen IT-Dienstleister der dpa Anfang Oktober sind die Täterinnen offenbar an Gehaltsabrechnungen und Kontodaten von rund 1.500 Beschäftigten gelangt, berichtet „Spiegel“. Die Hacker-Gruppe „Black Basta“ könne damit Identitäten stehlen und für betrügerische Geschäfte verwenden. Die Gruppe sei auch für den Angriff auf den Autovermieter Sixt Ende April verantwortlich.
spiegel.de, turi2.de (Background)
 Schmettert ab: Bertelsmann gibt der Spiegel-Mitarbeiter-KG einen Korb. Der Medienkonzern plane nicht, sich von seiner „Spiegel“-Beteiligung von 25,5 % zu trennen, sagt ein Sprecher auf Nachfrage von Meedia. Die Mitarbeiter-KG, die 50,5 % am „Spiegel“ hält, hatte Bertelsmann via „Horizont“ Avancen gemacht und Interesse an einer Übernahme bekundet.
Schmettert ab: Bertelsmann gibt der Spiegel-Mitarbeiter-KG einen Korb. Der Medienkonzern plane nicht, sich von seiner „Spiegel“-Beteiligung von 25,5 % zu trennen, sagt ein Sprecher auf Nachfrage von Meedia. Die Mitarbeiter-KG, die 50,5 % am „Spiegel“ hält, hatte Bertelsmann via „Horizont“ Avancen gemacht und Interesse an einer Übernahme bekundet.
meedia.de, turi2.de (Background)
 Beförderung? Check! Der CEO der Holidaycheck Group Marc Al-Hames rückt 2023 in den Vorstand von Burda auf. Er verantwortet im Team von CEO Martin Weiss die E-Commerce-Sparte Burda Commerce, die Beteiligungsgesellschaft Burda Next sowie den Dienstleister Burda Digital Systems. Al-Hames ist seit 2011 im Verlag und seit 2020 Chef der Reiseplattform.
Beförderung? Check! Der CEO der Holidaycheck Group Marc Al-Hames rückt 2023 in den Vorstand von Burda auf. Er verantwortet im Team von CEO Martin Weiss die E-Commerce-Sparte Burda Commerce, die Beteiligungsgesellschaft Burda Next sowie den Dienstleister Burda Digital Systems. Al-Hames ist seit 2011 im Verlag und seit 2020 Chef der Reiseplattform.
burda.com
 Heben ab: Moderatorin Linda Zervakis und Wissenschaftlerin Insa Thiele-Eich starten den Podcast „Stardust“, produziert von Studio Bummens. Darin sprechen sie ab 1. November immer dienstags über die „großen und kleinen Fragen des Lebens“. Zum Beispiel: Wie fliegt man ins All? Denn genau das hat Thiele-Eich als angehende Astronautin vor.
Heben ab: Moderatorin Linda Zervakis und Wissenschaftlerin Insa Thiele-Eich starten den Podcast „Stardust“, produziert von Studio Bummens. Darin sprechen sie ab 1. November immer dienstags über die „großen und kleinen Fragen des Lebens“. Zum Beispiel: Wie fliegt man ins All? Denn genau das hat Thiele-Eich als angehende Astronautin vor.
stardust-podigee.io (90-Sek-Trailer)
 Abschlepper: Der Begriff „Smash“ ist das Jugendwort des Jahres, gewählt von 43 % der Jugendlichen in einer Online-Umfrage des Langenscheidt-Verlags. Der Begriff bedeutet so viel wie „jemanden abschleppen“ oder auch „mit jemandem Sex haben“ und entstammt dem Smartphone-Datingspiel Smash oder Pass.
Abschlepper: Der Begriff „Smash“ ist das Jugendwort des Jahres, gewählt von 43 % der Jugendlichen in einer Online-Umfrage des Langenscheidt-Verlags. Der Begriff bedeutet so viel wie „jemanden abschleppen“ oder auch „mit jemandem Sex haben“ und entstammt dem Smartphone-Datingspiel Smash oder Pass.
tagesschau.de, faz.net
 Teure Bürgerkommunikation: Die Bundesregierung hat 2022 bis zum 11. Oktober bereits 32,66 Mio Euro für Werbe- und Kommunikationsagenturen ausgegeben. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hervor. Am meisten hat demnach mit 7,6 Mio Euro das Bundesforschungsministerium ausgegeben.
Teure Bürgerkommunikation: Die Bundesregierung hat 2022 bis zum 11. Oktober bereits 32,66 Mio Euro für Werbe- und Kommunikationsagenturen ausgegeben. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hervor. Am meisten hat demnach mit 7,6 Mio Euro das Bundesforschungsministerium ausgegeben.
horizont.net, apotheke-adhoc.de
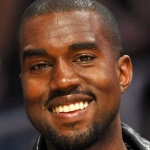 Schluss mit Kanye: Der Sportartikelhersteller Adidas arbeitet nicht mehr mit Kanye Westzusammen. Damit reagiert das Unternehmen auf antisemitische Äußerungen des US-Rappers. Gestern hatte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, Adidas aufgefordert, die Kooperation zu beenden.
Schluss mit Kanye: Der Sportartikelhersteller Adidas arbeitet nicht mehr mit Kanye Westzusammen. Damit reagiert das Unternehmen auf antisemitische Äußerungen des US-Rappers. Gestern hatte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, Adidas aufgefordert, die Kooperation zu beenden.
spiegel.de, turi2.de (Background)
– Anzeige –

Du hast Interesse …
an Medien und Marken und Lust auf digitales Arbeiten remote? Es macht Dir Spaß, Kunden zu beraten und Geschäfte zum Abschluss zu bringen? Wir hätten da was: wir suchen eine freundliche, zielstrebige und versierte Kollegin (m/w/d) für das turi2-Media-Team. Mehr Infos hier.
– COMMUNITY –

„So gebündelt wie noch nie“ – Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn über das neue Angebot ARD Kultur.
Multikulturell: Das neue Angebot ardkultur.de versteht sich als Navigator durch die Kulturinhalte der ARD, erklären Bettina Kastenund Kristian Costa-Zahn in Videointerview mit turi2-Chefredakteur Markus Trantow. Die beiden leiten als Programmgeschäftsführerinnen das Projekt, das morgen startet und nicht nur die bestehenden Inhalte der ARD kuratieren, sondern auch „Portfolio-Lücken herausfinden“ soll. In Koproduktion mit einzelnen ARD-Sendern sind so bereits einige neue Formate entstanden, etwa eine Fashion-Sendung über Mode als Kulturform und ein Format über weibliche DJs. Viele Beispiele aus dem Programm zeigen wir im Video.
weiterlesen auf turi2.de, turi2.tv (9-Min-Video auf YouTube)
 Willkommen im Club der turi2.de/koepfe: Nach über 16 Jahren bei Grabarz & Partner ist Stefanie Kuhnhen seit diesem Jahr Strategiechefin und Managing Partner bei Serviceplan. Im Fragebogen der turi2 edition #19 sagt sie, dass „das gute alte Radio“ für sie „immer noch topaktuell“ ist. Kuhnhen ist neu im turi2-Club der wichtigsten Meinungsmacherinnen in Deutschland.
Willkommen im Club der turi2.de/koepfe: Nach über 16 Jahren bei Grabarz & Partner ist Stefanie Kuhnhen seit diesem Jahr Strategiechefin und Managing Partner bei Serviceplan. Im Fragebogen der turi2 edition #19 sagt sie, dass „das gute alte Radio“ für sie „immer noch topaktuell“ ist. Kuhnhen ist neu im turi2-Club der wichtigsten Meinungsmacherinnen in Deutschland.
turi2.de/koepfe (Profil Kuhnhen)
![]() Meistgeklickter Link heute Morgen: Der Soziologe Harald Welzer kritisiert den minutenlangen Applaus für den ukrainischen Friedenspreisträger Serhij Zhadan.
Meistgeklickter Link heute Morgen: Der Soziologe Harald Welzer kritisiert den minutenlangen Applaus für den ukrainischen Friedenspreisträger Serhij Zhadan.
faz.net
 „Mir schwebt ein Podcast mit Angela Merkel und ihrem Mann vor wie ‘Paardiologie‘ von Charlotte Roche und Martin. Die ganze Welt fragt sich doch: Was macht eine Bundeskanzlerin nach 16 Jahren und wie funktioniert so eine Ehe?“
„Mir schwebt ein Podcast mit Angela Merkel und ihrem Mann vor wie ‘Paardiologie‘ von Charlotte Roche und Martin. Die ganze Welt fragt sich doch: Was macht eine Bundeskanzlerin nach 16 Jahren und wie funktioniert so eine Ehe?“
Spotifys Head of Podcast Saruul Krause-Jentschwünscht sich im Interview in der turi2 edition #19 einen Pärchen-Podcast mit der Altkanzlerin.
turi2.de
 Hör-Tipp: Besonders Frauen im IT-Bereich müssen auf Social Media damit rechnen, dass sie „bei gesellschaftlichen Themen hart angegangen werden“, sagt Kommunikationsberater Klaus Eck im Podcast „Team A“. Unternehmen sollten ihre Corporate Influencer unterstützen, wenn sie in einen Shitstorm geraten.
Hör-Tipp: Besonders Frauen im IT-Bereich müssen auf Social Media damit rechnen, dass sie „bei gesellschaftlichen Themen hart angegangen werden“, sagt Kommunikationsberater Klaus Eck im Podcast „Team A“. Unternehmen sollten ihre Corporate Influencer unterstützen, wenn sie in einen Shitstorm geraten.
manager-magazin.de (37-Min-Audio)
 Video-Tipp: In der „FAZ“-Redaktion herrscht Ratlosigkeit über das neu gewählte Jugendwort des Jahres smash. Ist es etwas zu essen? Oder doch ein Schmetterball? Hätten die Redakteurinnen mal die „Tagesschau“ zu Rate gezogen. Dort liefert Sprecherin Susanne Daubner in gewohnt souveräner Weise ab.
Video-Tipp: In der „FAZ“-Redaktion herrscht Ratlosigkeit über das neu gewählte Jugendwort des Jahres smash. Ist es etwas zu essen? Oder doch ein Schmetterball? Hätten die Redakteurinnen mal die „Tagesschau“ zu Rate gezogen. Dort liefert Sprecherin Susanne Daubner in gewohnt souveräner Weise ab.
instagram.com (FAZ), tiktok.com/@tagesschau(Susanne Daubner, 19-Sek-Video)
– Anzeige –
 Enzyme, Tenside, Duftstoffe … In handelsüblichen Waschmitteln sind viele Stoffe enthalten, die im Alltag zu Problemen wie Ausschlag oder Jucken führen können. Lesen Sie hier, wie Sie eine Waschmittelallergie erkennen, und wie man die Allergie am besten behandelt.
Enzyme, Tenside, Duftstoffe … In handelsüblichen Waschmitteln sind viele Stoffe enthalten, die im Alltag zu Problemen wie Ausschlag oder Jucken führen können. Lesen Sie hier, wie Sie eine Waschmittelallergie erkennen, und wie man die Allergie am besten behandelt.
– BASTA –
 WhatsDown: Der Messenger WhatsApp war heute morgen von einer weltweiten Störung betroffen. Das Senden und Empfangen von Nachrichten war fast zwei Stunden lang nicht möglich. Autorin Amalie Göltenboth kennt den Grund: „Die erste von vielen, vielen Plagen (um genau zu sein: zehn), die uns ereilen werden, weil RTL ‚Die Passion 2‘ abgesagt hat“.
WhatsDown: Der Messenger WhatsApp war heute morgen von einer weltweiten Störung betroffen. Das Senden und Empfangen von Nachrichten war fast zwei Stunden lang nicht möglich. Autorin Amalie Göltenboth kennt den Grund: „Die erste von vielen, vielen Plagen (um genau zu sein: zehn), die uns ereilen werden, weil RTL ‚Die Passion 2‘ abgesagt hat“.
focus.de, twitter.com
Redaktion: Nancy Riegel und Pauline Stahl
Der turi2-Newsletter erscheint werktäglich um 7 Uhr und 18 Uhr sowie am Wochenende um 9 Uhr. Kostenlos bestellen: abo@turi2.de. Mehr Infos unter turi2.de/faq. Infos zur Werbeschaltung.
Diesen Newsletter online lesen – ältere turi2-Newsletter online lesen
Sie erhalten den Newsletter an die Adresse: gottschling@rundschau-hd.de
Hier können Sie den Newsletter abbestellen.
Verantwortlicher i. S. v. § 18 Abs. 2 MStV:
Markus Trantow (markus.trantow@turi2.de), Alwinenstraße 23a, 65189 Wiesbaden

Ein Technikerverlegt ein Unterwasserkabel
Alles an uns ist Wasser. Es mag sich nicht sofort erschließen, aber selbst der Text, den Sie gerade lesen, hat einen Großteil seiner Reise in den dunkelsten Tiefen des Ozeans zurückgelegt. Entstanden ist er natürlich in meinem recht chaotischen Hirn, das selbst eine Menge Wasser braucht, um gut zu funktionieren.
(Das menschliche Gehirn besteht zu achtzig Prozent aus Wasser.) Der Text saust durch meine Rückenmarkflüssigkeit und wird durch meine Finger, über die Tastatur, über die Leiterplatten in eine Reihe elektrischer Impulse verwandelt –
 Auf Einladung des Stadtjugendring Heidelberg eV. und des DAI Heidelberg diskutieren alle Kandidierenden zur OB-Wahl an diesem Abend im DAI. Im Fokus der Podiumsdiskussion stehen die Themen Kultur und (Jugend-)Bildung.
Auf Einladung des Stadtjugendring Heidelberg eV. und des DAI Heidelberg diskutieren alle Kandidierenden zur OB-Wahl an diesem Abend im DAI. Im Fokus der Podiumsdiskussion stehen die Themen Kultur und (Jugend-)Bildung.

China-Beteiligung an Hafenterminal sorgt für Zwist in Bundesregierung
Nicht zu fassen: Trotz der Warnungen aller Fachministerien will das Kanzleramt offenbar den Verkauf von Teilen des Hamburger Hafens an den chinesischen Staatskonzern Cosco durchsetzen.
Nun ist ein Streit in der Bundesregierung über den Einstieg der chinesischen Firma beim Hamburger Hafen eskaliert. Nach Informationen von NDR und WDR haben alle sechs Ministerien, die an der Investitionsprüfung fachlich beteiligt sind, das Geschäft abgelehnt.
Das Kanzleramt drängt jedoch vehement darauf, dass der Einstieg dennoch zustande kommt.
 Nur einmal habe ich Wladimir Putin im echten Leben gesehen, aus der Ferne bei einer Militärparade in meiner Heimatstadt Sewastopol.
Nur einmal habe ich Wladimir Putin im echten Leben gesehen, aus der Ferne bei einer Militärparade in meiner Heimatstadt Sewastopol.
Er ist ja auch nicht der Präsident meines Landes und sollte nichts mit der Ukraine zu tun haben. Dennoch hat kaum jemand mein Leben so beeinflusst wie Putin.
Er ist ganz direkt für zwei der schlechtesten Momente verantwortlich, die ich – bereits als Kind – jemals erlebt habe.
1960 veröffentlichte der Heidegger-Schüler Hans-Georg Gadamer
(* 11. 2. 1900, Marburg † 13. 3. 2002, Heidelberg) sein Hauptwerk Wahrheit und Methode, den großangelegten Versuch einer „philosophischen Hermeneutik“.
Darin geht es ihm um „Wahrheit“ statt „Methode“ (verstanden als Verfahrensweise, die sachliche oder symbolische Zusammenhänge nach intersubjektiv kontrollierten Regeln, also nach dem Vorbild der mathematisch-naturwissenschaftlichen „Methode“ zu analysieren sucht. Dieses Werk löste in der Folgezeit auch eine verstärkte hermeneutische Reflexion in der deutschen Literaturwissenschaft aus. Wir erinnern uns vieler intensiver Stunden mit ihm in Heidelberg in der Grabengasse und gedenken seiner, indem wir sein Hauptwerk (es jedenfalls versuchen) in Erinnernung bringen.

Jeder meint die Habsburger zu kennen, doch über ihre Anfänge weiß man wenig. Speyer ändert das mit einer großen Landesausstellung Rheinland-Pfalz zu den ersten 250 Jahren der Dynastie
An den Habsburgern kommt man in Europa bis heute nicht vorbei. Im belgischen Antwerpen, Teil der ehemaligen Habsburgischen Niederlande, läuft man vom Stadtpark aus in die Straße Maria-Theresialei; in gottvergessenen spanischen Käffern in Navarra, in denen zuletzt Leben in den Siebzigerjahren war, weil dort Spaghettiwestern gedreht wurden, findet sich über dem Rathausportal das Habsburgerwappen Kaiser Karls V., Herrscher über Spanien und plus ultra, weit darüber hinaus. Dabei stammt das so eng mit Österreich und anderen Ländern assoziierte kleine Grafengeschlecht ursprünglich aus der Schweiz.
„Libertären Autoritarismus“ nennen die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey die Denkweise der Querdenker – auf den ersten Blick ein Paradox. Noch 2016 analysierte Nachtwey in seinem Bestseller „Die Abstiegsgesellschaft“ eine Bundesrepublik, die ihre eigenen Versprechen nicht mehr halten kann.
Amlinger legte 2021 mit „Schreiben“ eine Untersuchung der Arbeitsbedingungen von Schriftstellern vor. Seit den Anfängen der sogenannten Querdenken-Bewegung 2020 haben sie die Szene gemeinsam beobachtet. Mit „Gekränkte Freiheit“ erscheint nun ihre umfassende Analyse einer neuen, gefährlichen Weltanschauung.
Virologe Hendrik Streeck im Interview: „Der Bürger weiß, wie er mit Corona umgehen soll“
Frau Amlinger, Herr Nachtwey, die Proteste gegen Corona-Maßnahmen waren geprägt von einem Beharren auf Freiheit und Autonomie, eigentlich also anti-autoritären Werten. Sie analysieren die Querdenker-Szene dennoch als „libertäre Autoritäre“. Was macht dort den autoritären Charakter aus?
Carolin Amlinger: Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, würden sich selbst nicht als Rechte oder Autoritäre bezeichnen. Oft wurden sie links oder liberal sozialisiert, Selbstverwirklichung und Kosmopolitismus sind wichtige Werte für sie. Mittlerweile tragen sie jedoch ein so absolutes Freiheitsverständnis vor, dass wir einen Drift ins Autoritäre beobachten können. Wir sehen aber keine Identifikation mit einem starken Führer wie beim klassischen Autoritären. Es gibt auch keinen Hang zu konventionellen Werten. Was wir aber gefunden haben, ist autoritäre Aggression gegenüber Personen und Institutionen, die angeblich ihre individuellen Freiheitsrechte missachten.
Elon Musk will nicht mehr für Ukraine-Internet zahlen: Ging Melnyk am Ende zu weit?
Aus welchen Milieus stammen diese libertären Autoritären? Sind das alles abgehängte Arbeiter?
Oliver Nachtwey: Eben nicht. In unseren Untersuchungen sind wir fast gar nicht auf Arbeiter, sondern auf Personen aus der modernen Mitte gestoßen. Wenig Industrie- oder Facharbeiter, dafür viele Angestellte und Selbständige, Menschen mit höherer Qualifikation. Wir haben nicht den klassischen Konservativen gefunden, der auch mal zu autoritären Ideen neigt, sondern Leute, die von progressiven Ideen kommen und über die politische Dynamik dann immer schneller nach rechts gehen. Das meinen wir, wenn wir von „Drift“ sprechen.
Wie kam es, dass der Staat in diesem Milieu schnell zu einer Hassfigur wurde?
Oliver Nachtwey: Es gibt erhebliche Klassenunterschiede in der Art, wie man den Staat vorher erlebt hat. Man sieht das zum Beispiel am Hartz-IV-Empfänger: Wer in Deutschland Transferzahlungen bezogen hat, der hat unmittelbare Erfahrungen mit dem Staat gemacht. Man musste sein Privatleben bis ins Badezimmer, bis zur Zahnbürste offenbaren und konnte sanktioniert werden, wenn man sich dem nicht gefügt hat.
Carolin Amlinger: Für die unteren Klassen und Arbeiter hat der Staat immer schon stark in das Alltagsleben hineindirigiert. Für jene Milieus, die auf Selbstverwirklichung und Autonomie zielen, war der Staat hingegen immer Garant ihrer Freiheit. Er war also nicht als disziplinierende Instanz präsent.
Oliver Nachtwey: Die Leute in unserer Untersuchung haben eigentlich immer vom Staat profitiert. Man hatte gute Straßen, eine gute Bildung und generell eine Gesellschaft, die funktioniert. Aber weil diese Gesellschaft funktioniert hat, blieb sie unsichtbar und wurde als selbstverständlich hingenommen.
Carolin Amlinger: Und in der Pandemie waren plötzlich auch diese Milieus mit Staatsinterventionen konfrontiert, die sie vorher nicht kannten.
Oliver Nachtwey: Durch die vorherige Unsichtbarkeit des Staates haben gerade diese Menschen vergessen, dass sie abhängig sind vom Rest der Gesellschaft. Jetzt nehmen sie Freiheit als etwas Absolutes, das ihnen persönlich gehört und verdrängen, dass diese Freiheit soziale Voraussetzungen hat. Jemand aus der oberen Mittelschicht begegnet dem Staat fast nie oder höchstens mal, wenn er die Kinder in der Schule anmeldet oder in eine Verkehrskontrolle kommt. Nur bei der Steuer ärgert man sich jedes Jahr. Aber da kommt nicht das Jugendamt oder das Sozialamt vorbei. Da gibt es keine Sanktionierung. Den Staat haben sie vorher als Enabler, nicht als Eingreifenden wahrgenommen. Jetzt haben diese Leute plötzlich gesehen: Der kann auch anders. Und das waren sie nicht gewohnt.
Werden wir also zu Bürgern, die nicht mehr mit Krisen umgehen können, die nur der Staat lösen kann?
Oliver Nachtwey: Der Kapitalismus erzeugt diese Krisen. Auch die Pandemie ist eine Folge der Globalisierung. Wenn man sich die Geschwindigkeit ihrer Verbreitung anschaut, lag das daran, dass die Welt so eng vernetzt ist. Der Staat hat immer eine Doppelfunktion: Er muss die Wirtschaft am Laufen halten, aber dafür auch Regeln setzen. Das auch das nötig ist, haben viele verdrängt. Die Wahrnehmung lautet jetzt, dass er sich gegen eine Gruppe richtet, die immer wahnsinnig vom Staat profitiert hat. Und vor allem in dem Sinn, dass sie konkret wenig mit ihm zu tun hatte.
Carolin Amlinger: Krisen erscheinen so nicht mehr als gesellschaftliche Konflikte, sondern als individuelle Angelegenheiten. Dieses, wie wir es angelehnt an den ungarischen Philosophen Georg Lukács nennen, verdinglichte Bewusstsein der eigenen Situation sorgt dafür, dass man nicht mehr so leicht in Zusammenhängen denken kann. Alles erscheint fragmentiert: Energiekrise, Klimakrise, Pandemie. Die Proteste, die wir beobachtet haben, wehren die Gesellschaft als solche – teilweise eben autoritär – ab und verdrängen die eigene Verstrickung in ihr.
Oliver Nachtwey, geboren 1975, ist Soziologe und Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel.
Damit einher geht die Vorstellung, dass Krisen nur durch Verschwörungen erklärbar seien. Aber auch wenn man vernünftig über das isolierte Bewusstsein hinausgehen will, muss man doch Zusammenhänge erkennen und Verantwortliche benennen. Wie unterscheidet sich das Verschwörungsdenken davon?
Carolin Amlinger: Letztlich geht das Verschwörungsdenken von einem ähnlichen Punkt aus wie klassische Formen der Gesellschaftskritik: Am Anfang steht die Vorstellung, dass sich hinter der oberflächlichen Realität noch tiefere, im Alltag nicht unmittelbar sichtbare Herrschaftsstrukturen verbergen. Der Unterschied ist, dass es im Verschwörungsdenken immer intentionale Akteure gibt, die das Geschehen im Hintergrund lenken. Statt diese Akteure dann in gesellschaftlichen Prozessen zu denken, werden sie als einzelne, oft antisemitisch codierte Figuren gedacht. Da sieht man die Gesellschaftsvergessenheit: Einzelne Figuren initiieren Krisen, nicht unsere Gesellschaft.
Oliver Nachtwey: Verschwörungstheorien funktionieren auch deshalb gut, weil es historisch tatsächlich Verschwörungen gab. In der Regel ist die sparsamste und naheliegendste Erklärung die korrekte. Die Verschwörungstheorien kennen hingegen keine zu hohe Komplexität: Demnach wurde das Coronavirus von ein paar Akteuren mit bösen Absichten in die Welt gebracht, um die große Umvolkung zu beginnen. Dass es das Coronavirus gab, lag in Wirklichkeit am Vordringen der kapitalistischen Zivilisation in die bisher unberührte Natur. Im Verschwörungsdenken wird die Basis von sozialen Dynamiken auf geheime Machenschaften zurückgeführt. Wir nennen das eine ver-rückte Gesellschaftskritik – mit Bindestrich –, weil es nicht einfach pathologisch ist, sondern weil es eine im Ansatz legitime Gesellschaftskritik aus der Bahn trägt.
Dazu kommt eine Maßlosigkeit der Kritik. Sie zitieren in Ihrem Buch einen Herrn Hoffmann, der das Tragen der Maske als „neuen Hitlergruß“ bezeichnet. Warum fällt es den Menschen so schwer, ihre Kritik im richtigen Maß zu formulieren?
Oliver Nachtwey: Wenn Sie mit dem Staat häufiger konfrontiert waren, dann haben Sie zwar auch eine Wut auf ihn, aber Sie können die Härte der Maßnahmen gut einordnen. In der Mittelschicht trafen die Maßnahmen aber auf totale Erfahrungslosigkeit. Früher gab es außerdem viele Institutionen, die negative Affekte zwar haben gelten lassen, sie dann aber auch wieder in Bahnen einer regulierten Kritik geführt haben. Als Soziologe habe ich eine etwas andere Sicht auf den Stammtisch, als er gemeinhin in der Öffentlichkeit gesehen wird. Er ist eine soziale Form, in der Affekte ausgetragen werden, wo soziale Kontrolle aber auch eine Abkühlung bewirkt.
Der Stammtisch ist ja eher zum Sinnbild einer aggressiven Wut geworden. Wie kann man sich diese Kontrolle genau vorstellen?
Oliver Nachtwey: Diese Vorstellung ist natürlich nicht unberechtigt. Denn beim Stammtisch konnte man auf den Tisch hauen, sich über Minderheiten auslassen und gegenseitig in seinem Ressentiment bestätigen. Aber irgendwann hat der Wirt oder Kollege am Nachbartisch gesagt: „So, jetzt reicht’s mal!“, und dann ist man angetrunken nach Hause gegangen. Jetzt haben wir atomisierte Individuen, die solche Formen der Öffentlichkeit nicht mehr haben. Stattdessen gibt es Orte wie Twitter, die grenzenlose Affektbestätigung betreiben. Da gibt es keine Abkühlung oder soziale Kontrolle.
Carolin Amlinger: Natürlich treffen Menschen auch dort auf Kritik, teilweise auf harte Kritik. Aber die führt nicht zur Reflexion des eigenen Standpunktes, durch die man etwa auf die Idee käme, dass der Diktaturvergleich nicht ganz so angebracht ist. Wir haben eher beobachtet, dass es zur Radikalisierung beiträgt, wenn man die Menschen bei Querdenken-Protesten als krude Verschwörungstheoretiker abtut. Wir nennen das eine projektive Gegenidentifikation, also: „Wenn ihr mich Verschwörungstheoretiker nennt, dann bin ich halt einer. Wenn ihr mich Nazi nennt, dann bin ich halt Nazi.“ Dadurch, dass sich die Reihen so schnell geschlossen haben, wurde diesen Menschen auch der Weg zu einer rationalen Form der Kritik versperrt.
Autoritäre Stammtisch-Besucher zeichnen sich durch soziale Härte aus. Währenddessen verstehen sich die atomisierten Querdenker als empathisch und vernetzt. Wie passt die Atomisierung der Individuen mit diesem Selbstverständnis zusammen?
Oliver Nachtwey: Im Konflikt um die Corona-Maßnahmen haben sich Menschen, die ohnehin hochindividualistisch veranlagt waren, vereinzelt und ohnmächtig gefühlt. Wir haben beobachten können, dass viele von ihnen durch ihre Radikalisierung Freunde verloren haben. Vereinzelung heißt aber nicht zwangsläufig, dass man allein ist. Man kann sich auch in Gemeinschaft vereinzeln. Viele haben sich dann nämlich eine Leidensgemeinschaft von Gleichgesinnten gesucht, die sie aber in ihren Ansichten immer weiter bestärkt haben.
Carolin Amlinger: Das Entscheidende ist, dass diese „Misstrauensgemeinschaften“, wie sie der Historiker Sven Reichardt nennt, nach innen politisch indifferent sind. Dem Außen begegnen sie zwar mit generalisiertem Misstrauen, nach innen herrscht aber ein absolutes Vertrauen. Bei den Querdenken-Protesten wurde diese Imagination der Einheit immer heraufbeschworen und dadurch wurden Rechte in den eigenen Reihen geduldet. Und diese politische Indifferenz wird natürlich gefährlich, wenn sich am Ende Rechte und Linke zusammen mobilisieren.
Gerade scheint es eher so, dass Querdenker mit der Pandemie aus dem öffentlichen Diskurs verschwinden. Haben sie sich ins Private zurückgezogen? Oder müssen wir damit rechnen, dass sie sich neue Themen suchen?
Oliver Nachtwey: Ihr Generalverdacht gegen das vermeintlich „linksliberale Establishment“ ist nicht gesunken, sondern gestiegen. Viele Querdenker sehen sich wirklich in einer diktaturähnlichen Situation, in der das linksliberale Establishment die Macht an sich gerissen hat. Sie hatten immer den Eindruck, dass ihre Interessen in der Gesellschaft sehr stark vertreten sind und jetzt wird scheinbar gegen ihre Interessen regiert. Deshalb sagen sie: „Das kann nur eine Diktatur sein.“ Aus der Diktatur leiten sie auch dieses wahnsinnige Widerstandsrecht ab.
Carolin Amlinger: Die Querdenker haben insgesamt einen grundlegenden Zweifel über die Beschaffenheit der Realität kultiviert, der sich radikalisiert und verselbständigt hat. Dieses generelle Misstrauen findet so immer wieder neue Themen, neue Objekte und stellt am Ende die Realität als solche infrage. Deshalb kann man daran zweifeln, dass die ehemaligen Querdenker wieder in die Bahnen einer emanzipatorischen Gesellschaftskritik zurückfinden.
Wer sich für normal hält, muss ein Menschenfeind sein – wie Grüne die Gesellschaft umpflügen wollen
Das Familienministerium in Berlin ist die Agitationszentrale der Grünen. Mit Gender- und Migrationspolitik soll Deutschland umgebaut werden. Gegen Kritiker geht man mit verbaler Aggression vor.

Multikulti existiert nicht mehr, heute heisst es Diversität: Demonstranten auf der Kundgebung zum 1. Mai in Berlin.

Eric Gujer, Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung».
Sie lesen einen Auszug aus dem Newsletter «Der andere Blick» von NZZ-Chefredaktor Eric Gujer speziell für Leserinnen und Leser in Deutschland. Abonnieren Sie den Newsletter kostenlos. Nicht in Deutschland wohnhaft? Hier profitieren.
Robert Habeck und Annalena Baerbock heimsen zu Recht Applaus für ihre Haltung im Ukraine-Krieg ein. Ihre Politik ist konsequent, weil sie keinen Zweifel daran lässt, wer Täter und wer Opfer ist. Zugleich ist sie pragmatisch, da in der Frage der Energieversorgung keine Dogmen mehr gelten. Welch wohltuender Gegensatz zum irrlichternden Duo Scholz und Lambrecht.
Was aussenpolitisch ein Erfolg ist, wird innenpolitisch zum Risiko. Während sich alle Augen auf die Ukraine richten, treiben Grüne den gesellschaftlichen Umbau voran. Ob Genderfragen oder Migration – die ehemalige Umweltpartei konzentriert sich umso mehr auf die Identitätspolitik, als ihr die Kriegszeiten viele Kompromisse abverlangen. So ersetzt sie die ausbleibenden russischen Gaslieferungen beherzt mit Kohle und Gas vom Golf, betreibt also nüchterne Realpolitik. In Identitätsfragen hingegen polarisiert die Partei und fördert Extreme. Die Schaltzentrale der Grünen für ihr Umerziehungsprogramm ist das Ministerium für Wokeness, früher bekannt als Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Die Kriminalität arabischer Clans soll totgeschwiegen werden
Wie die Partei dabei vorgeht, illustriert die Personalie der designierten Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Ataman. Familienministerin Lisa Paus schlägt dem Bundestag eine Kandidatin zur Wahl vor, die Deutsche als «Kartoffeln» verunglimpft.

Ferda Ataman ist Vorsitzende der «Neuen Deutschen Medienmacher».
Diskriminierung ist gut, solange sie sich gegen die Mehrheitsgesellschaft richtet, linke Ausländerpolitiker und Aktivisten aber zufriedenstellt. Diese glauben, dass weisse Deutsche generell privilegiert sind – ob es sich um Sozialhilfeempfänger oder Multimillionäre handelt. Die Diskriminierung von Deutschen ist folglich keine Diskriminierung, sondern nur die beschleunigte Herstellung gleicher Lebensverhältnisse.
Es geht nicht um Dialog und Ausgleich, sondern um Konfrontation und Schaufensterpolitik. Die Journalistin Ataman gehört einem Verein an, der andere Journalisten an den Pranger stellte, weil diese den angeblich ausländerfeindlichen Begriff der Clan-Kriminalität benutzen.
In Deutschland soll nach dem Willen von Ataman und ihren Gesinnungsfreunden nicht berichtet werden, dass arabische Clans in Berlin und anderen Städten zu den dominierenden Kräften der Unterwelt zählen. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Ideologie und die Zustimmung in einem rot-grünen Justemilieu sind wichtiger als Fakten.
Ginge es darum, Lösungen zu finden, statt ein Thema linkspopulistisch zu bewirtschaften, würde sich gerade das Phänomen der Clan-Kriminalität für eine differenzierte Betrachtung anbieten. Denn hier zeigt sich, wie eine kurzsichtige Ausländerpolitik gravierende gesellschaftliche Probleme schaffen kann.
Türkische und libanesische Grossfamilien nutzten in den achtziger Jahren die DDR als Tor zum Westen. Der Stasi-Staat liess sie einreisen, sofern sie unverzüglich in den Westen weiterzogen. Westberlin konnte die Migranten nicht abschieben, wäre sie aber gerne losgeworden. So erhielten die Familien eine Duldung, welche Arbeitsaufnahme, ja sogar Schulbesuch verbot und so die Familien förmlich in die Illegalität drängte. Obwohl sie nur vorläufig geduldet wurden, haben sie Deutschland nie mehr verlassen.
Die Demokratie schrumpft zur Service-Agentur für Minderheiten
Diese Migrationsgeschichte wäre ein ideales Beispiel, um zu erklären, warum die Ampelkoalition das Ausländerrecht reformiert. Geduldete Personen sollen nach fünf Jahren einen dauerhaften Status erhalten, sofern sie gut integriert sind. Das ist vernünftig, weil so unnötiges Leid vermieden wird. Der Staat muss gegen illegale Migration vorgehen, aber vier Jahre und 364 Tage sind Zeit genug, um eine Person des Landes zu verweisen.
Doch der angehenden Antidiskriminierungsbeauftragten geht es offenkundig nicht darum, zu erklären und um Verständnis zu werben. Lieber will sie skandalisieren und indoktrinieren. Wer über die lange ignorierte Migrantenkriminalität berichtet, soll mundtot gemacht werden.
Als ich vor 15 Jahren noch als Korrespondent über das Thema recherchierte, sagte mir eine Kriminalrätin im Berliner Polizeipräsidium, es werde nicht gerne gesehen, wenn sie dazu Auskunft gebe. Das widerspreche dem Bild des multikulturellen Berlin.
Multikulti existiert nicht mehr, heute heisst es Diversität. Mit gesundem Menschenverstand betrachtet, bedeutet dies nichts anderes, als die gesellschaftliche Vielfalt anzuerkennen und selbstverständlich zu leben. Rot-grünen Identitätspolitikern genügt dies nicht. Sie behaupten, wahre Diversität und Demokratie seien erst erreicht, wenn alle Menschen, weitgehend unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsdauer mitbestimmen könnten.
Diese Vorstellung stellt das Zerrbild einer Demokratie dar, die zum Mitmachklub mutiert für alle, die gerade Lust haben, sich zu beteiligen. Der Staat wäre nur noch eine zufällige Versammlung, ohne Verbindlichkeit und ohne Pflichten. Der Einzelne hat nur noch Rechte und Ansprüche gegenüber dem Staat auf «Inklusion» und «Partizipation».
Der Gesellschaftsvertrag ist kein Vertrag mehr auf Gegenseitigkeit, sondern ein einseitiges Abkommen, in dem das Individuum seine Wünsche formuliert. Die Demokratie schrumpft zur Service-Agentur namentlich für alle jene Minderheiten, die ihre Forderungen am lautesten artikulieren.
Über medizinische Risiken muss diskutiert werden – auch wenn das einer Gender-Ideologie widerspricht
Die grenzenlose Individualisierung ist Programm bei Grünen und mit Abstrichen auch bei der FDP. Das schlägt sich im Koalitionsvertrag nieder. Er verheisst den Individuen die totale Verfügungsmacht über ihre Körper, unabhängig von gesellschaftlichen Konventionen, juristischen oder medizinischen Einwänden. So soll jede Person über 14 Jahre ihr Geschlecht durch einfache Willenserklärung ändern können, einschliesslich einer chemischen und operativen Behandlung.
Wer sich dagegen ausspricht, etwa unter Hinweis auf die Entwicklungspsychologie von Teenagern, wird in derselben wüsten Weise beschimpft, die Deutsche zu Kartoffeln herabwürdigt. Stets führt das Familienministerium, die Agitationszentrale der sonst so weltläufigen Parteivorsitzenden Habeck und Baerbock, die Kampagnen an.
Der Staatssekretär im Ministerium Sven Lehmann wetterte gegen «Homo- und Transfeindlichkeit» und «Fake News», nur weil mehrere Autoren in einem Gastbeitrag für die «Welt» darauf hingewiesen hatten, dass eine Geschlechtsumwandlung bei Pubertierenden deren Gesundheit beeinträchtigen kann. Sie warnten ausserdem vor einer die Risiken verharmlosenden Berichterstattung in den Medien.
Bei jeder anderen Behandlung ist es die juristische wie ethische Pflicht des Arztes, über mögliche Nebenwirkungen aufzuklären. Nur bei der Geschlechtsumwandlung verkehren grüne Identitätsideologen hippokratische Wahrhaftigkeit zur «gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit». Keine Fernsehwerbung für harmlose Venensalbe kommt ohne das Sprüchlein aus: «Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker». Nur bei einem irreversiblen Eingriff soll das nicht gelten.
Dabei ist noch eine ganz andere Art von Menschenfeindlichkeit denkbar: Aktivisten immunisieren eine Behandlungsmethode gegen jede Kritik. Medien verstärken das Randphänomen zum gesellschaftlichen Trend, und bedenkenlose Mediziner lassen sich nicht zweimal sagen, dass sie zum Skalpell greifen sollen. Lukrativ ist so eine Operation gewiss, und es wäre nicht das erste Mal, dass sich skrupellose Ärzte in den Dienst eines irregeleiteten Zeitgeistes stellen.
Wenn medizinische Praktiker und Wissenschafter die ebenso segensreiche wie manchmal furchteinflössende Wunderwelt der modernen Medizin hinterfragen, verdient das Respekt. Das sollte selbst dann gelten, wenn man deren Argumente nicht teilt. Wissenschaft beruht auf Rede und Gegenrede und der Bereitschaft, jede Hypothese zu falsifizieren.
Schon in der Pandemie mutierte «die» Wissenschaft allerdings zum Glaubensbekenntnis, mit dem sich Andersdenkende trefflich ausgrenzen liessen. Die Corona-Erfahrungen zeigen, dass verbale Abrüstung den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Leider prallt die Erkenntnis am Panzer der Ignoranz ab, den alle begeisterten Rechthaber tragen – ob links oder rechts.
Der grünen Kampfbrigade fällt das Paradoxe ihres Tuns nicht auf. Sie fordert Toleranz und Gleichberechtigung für Minderheiten, begegnet aber allen Einwänden mit Intoleranz. Wer Lehmann oder Ataman zu widersprechen wagt, ist eine Kartoffel oder ein Menschenfeind. Das ist die Sprache von Kulturrevolutionären und nicht von Politikern, die eine Gesellschaft auf dem langen Weg der Veränderung mitnehmen wollen.
Eines ist gewiss. Wenn das Ministerium für Wokeness sein Programm verwirklicht hat, wird die Republik an einigen Stellen nicht wiederzuerkennen sein. Schaun wir mal …