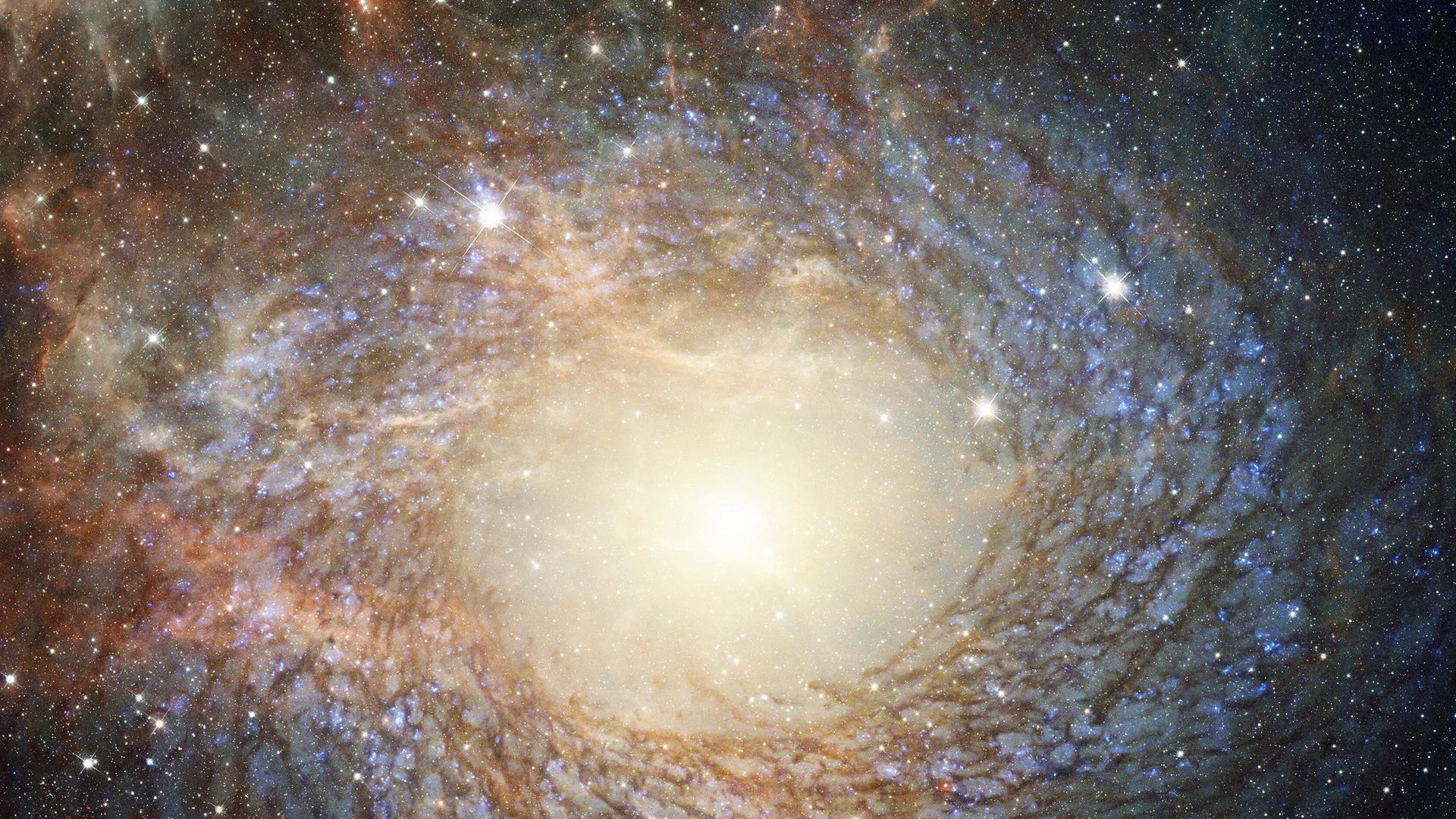Bis vor elf Tagen war der einzige lebende King Charles der englische Sänger und Songwriter Charles Costa, der „King Charles“ zu seinem Künstlernamen gemacht hatte. Offenbar hatte das britische Königshaus keine Einwände. Ging man davon aus, dass Königin Elizabeth ihren Sohn oder sogar diesen Usurpator überleben würde?
Seit dem 8. September gibt es einen echten King Charles. Der 73-jährige Sohn der verstorbenen Königin ist der dritte dieses Namens. Eine Gelegenheit, um ein paar Minuten lang auf Charles I. (1600–1649) zurückzublicken. Jedes englische Schulkind weiß es und King Charles III. natürlich auch: Charles I. wurde enthauptet, und mit der Monarchie war erst einmal Schluss. Sein Sohn bestieg als Charles II. erst 1660 den Thron.
Was sagt uns das? Erst einmal nichts. Die Welt der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hat wenig mit der des 21. zu tun. Je genauer man hinblickt, desto weiter scheint sie von uns abzurücken.
Charles III ist kein Nachfahr von Charles I. und Charles II.. Sie waren Stuarts. Charles III. ist ein Windsor, also ein Mitglied des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha. Als im Ersten Weltkrieg England nicht nur mit Deutschland im Krieg lag, sondern zudem noch Flugzeuge des Typs Gotha G.IV England bombardierten, änderte König Georg V. am 17. Juli 1917 den anglisierten Namen Saxe-Coburg and Gotha, den das Haus in Großbritannien seit 1840 trug, in den jetzigen Hausnamen Windsor. Dieser steht für die Stadt Windsor in der Grafschaft Berkshire, in der sich Windsor Castle befindet, seit der Zeit Wilhelms des Eroberers eine der Residenzen der königlichen Familie. Der deutsche Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha war dem englischen König vorausgegangen und hatte schon im März des Jahres die Verbindungen zu den englischen Verwandten abgebrochen und klargestellt, dass niemand seinen Thron besteigen könne, dessen Staat Krieg gegen das deutsche Reich führe.
Diese Vorgänge sind nicht nur Charles III., sondern auch großen Teilen der britischen Öffentlichkeit geläufig. Das Königshaus ist älter als die Nation, und es gehörte einmal anderen Nationen an. Das spielt auch heute eine wichtige Rolle. Zum Beispiel für die schottischen Nationalisten. Manche von ihnen vertreten die Ansicht, Schottland könne eine eigene Nation bilden, der englische König aber das Staatsoberhaupt des unabhängigen Schottlands bleiben.
Für Charles I. war das eine der Grundlagen seines Selbstverständnisses: Er war König von England, Schottland und Irland. Nicht weil die drei Nationen in einem Staat zusammengefasst waren, sondern weil er König dieser drei Staaten war. Verbunden waren sie durch ihn. Durch eine Personalunion.
Charles I. vermehrte seine Feinde wesentlich auch durch seine Praxis, von seinen reichen Untertanen Geld dafür zu verlangen, sie nicht zu verhaften. Königliche Schutzgelderpressung könnte man sagen. England war keine Großmacht. Der Staat war permanent pleite, unfähig sich zu schützen, geschweige denn in der Lage, protestantischen Brüdern und Schwestern zu Hilfe zu kommen. Schon als Thronfolger hatte Charles I. sich dafür eingesetzt, seiner mit dem Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz verheirateten Schwester zur Hilfe zu kommen. Im November 1619 hatten die protestantisch böhmischen Stände Friedrich die Krone Böhmens angeboten. Er nahm an. Die Truppen der Katholischen Liga vertrieben ihn ins Exil. Das war einer der Auslöser für den Dreißigjährigen Krieg.
Charles I. versuchte immer wieder, im großen europäischen Kriegsspiel mitzumachen. Er scheiterte jedes Mal. Auch seine protestantischen Untertanen unterstützten dieses Engagement. Zugleich aber warfen sie ihm seine Großmachtträume vor. Denn England war nicht einmal in der Lage, den Ärmelkanal vor türkischen Piraten zu schützen. Die fielen in der Gegend um Plymouth sogar Orte auf der Insel an.
Die ständige Geldnot des Hofes stärkte das Parlament. Das stellte immer radikalere Forderungen. Der Krieg gegen das aufmüpfige Irland stärkte die Armee, die sich zu einem eigenständigen Faktor der Politik entwickelte. Dazu die Konflikte zwischen Katholiken, anglikanischer Kirche, deren Oberhaupt der König war und verschiedenen protestantischen Gruppierungen, die alle ganz unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie Kirche, Staat und Welt auszusehen hatten.
Vielleicht aber hatte Thomas Hobbes (1588–1679) recht, der die religiösen Beweggründe dafür, die eine oder die andere Partei zu ergreifen, so ernst nicht nahm: „Ich denke wirklich, hätte der König Geld gehabt, hätte es für ihn genügend Soldaten in England gegeben. (…) Aber die Schatzkammern des Königs waren nur wenig gefüllt. Seine Feinde aber verfügten über die dicken Brieftaschen der City of London.“
Zwischen allen, nein über allen Stühlen sah sich der König. Er war der von Gott eingesetzte Herrscher, dem niemand Vorschriften zu machen hatte. Es war kränkend genug, dass er mal mit Franzosen, mal mit Schotten, mal mit dem Parlament, ständig mit den Militärs zu verhandeln hatte. Als er versuchte, mit den Schotten gegen die aufmüpfigen Engländer zu koalieren, verkauften die ihn für 400 000 Pfund an die Parlamentstruppen. Charles I. verhandelte weiter. Auch als es längst nichts mehr zu verhandeln gab.
Es wurden dicke Bücher über das Hin und Her, über die wechselnden Koalitionen bei Hof und im Parlament geschrieben. Sie sind auch deshalb so schön zu lesen, weil sie die Fantasie in Bewegung setzen. Man kommt auf die Idee, womöglich sei die Politik auch heute so bewegt, bunt und undurchsichtig. Überall Verschwörungen, hinter jedem Vorhang eine Leiche.
Vor einem Vierteljahrhundert rieben sich deutsche Politiker verblüfft die Augen und konstatierten: Wir sind nur noch von Freunden umgeben. Das hat sich geändert. Francis Fukuyama sprach damals vom „Ende der Geschichte“. Ein Irrtum. Die Geschichte ist wieder da. Mit Drohungen, Erpressungen, Kanonenpolitik und Massenmord. Politik besteht wieder in der Kunst, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Das war nie wirklich vorbei. Aber jetzt fällt die Welt zurück in alte Muster. Ganz offen wollen alle wieder größer werden. Dazu keine Monarchen mehr, aber Autokraten, die davon ausgehen, niemandem Rechenschaft schuldig zu sein.
Als Charles I. sein Ende kommen sah, nahm er es gelassen. Auch die letzten Stunden Wartezeit, die entstanden waren, weil seine Henker noch ein Gesetz ändern mussten, das besagte, dass unmittelbar nach dem Tod des Königs der Prince of Wales automatisch sein Nachfolger würde. Das Gesetz war schnell formuliert. Aber es musste drei Lesungen passieren. Das dauerte.
Wir erinnern uns daran, wie viel Wert nach dem Tod Elizabeth II. darauf gelegt wurde, dass von nun an – also nicht erst nach der Krönung – Charles King Charles sei. Und begreifen, warum das so wichtig war.
Am 30. Januar 1649 um 14 Uhr wurde Charles I. enthauptet. Mit einem einzigen Beilhieb. Sofort kamen Zuschauer, bestachen die Soldaten und tauchten ihre Taschentücher in das königliche Blut. Charles war am Ende sich sicher gewesen, dass er als Märtyrer direkt vom Schafott zum Thron Gottes aufsteigen werde. England war jetzt eine Republik. Ihr Lordprotector wurde Oliver Cromwell. Am 3. September 1658 starb er. Am 29. Mai 1660 wird mit dem Einzug von König Charles II. in London die Monarchie wieder eingeführt.
Heute wird bei der Beerdigung von Elizabeth II. mit mehr als einer Million Menschen gerechnet. Geschichte wiederholt sich nicht. Manchmal aber tauchen die Gespenster der Vergangenheit erschreckend deutlich wieder auf. Es fehlt heute nicht an Regierungschefs, die sich für gottgesandt halten. Von den Monarchen gehört diesmal wohl keiner dazu. aw

 Moderne Kunst trifft grüne Hightech So lässt sich das Konzept „Solarbaum“ grob umreißen. Bei ihm nämlich handelt es sich nicht einfach um eine Photovoltaikanlage in der typischen rechteckigen Form, sondern um ein Designobjekt. Typisch ist die stählerne Konstruktion, die für den „Baum-Look“ sorgt: Im Zentrum befindet sich ein „Stamm“, von dem weitere Träger – die „Äste“ – abgehen. Auf ihnen befinden sich dann als „Blätter“ die einzelnen Module mit den Solarzellen.
Moderne Kunst trifft grüne Hightech So lässt sich das Konzept „Solarbaum“ grob umreißen. Bei ihm nämlich handelt es sich nicht einfach um eine Photovoltaikanlage in der typischen rechteckigen Form, sondern um ein Designobjekt. Typisch ist die stählerne Konstruktion, die für den „Baum-Look“ sorgt: Im Zentrum befindet sich ein „Stamm“, von dem weitere Träger – die „Äste“ – abgehen. Auf ihnen befinden sich dann als „Blätter“ die einzelnen Module mit den Solarzellen.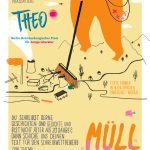
 Das Kloster Maulbronn gilt als die am besten erhaltene Klosteranlage des Mittelalters nördlich der Alpen. Hier sind alle Stilrichtungen von der Romanik bis zur Spätgotik in einer einzigartigen Dichte vertreten. Am Freitag, 12. August, um 8:30 Uhr unternimmt die Akademie für Ältere Heidelberg eine Kulturfahrt zu der ehemaligen Zisterzienserabtei. Nach einer Führung durch die Klosteranlage und der Mittagspause auf dem Klosterhof ist ein individueller Rundgang möglich sowie ein Besuch des Museums. Kosten: 15,- Euro mit Akademie-Pass. Anmeldung unter Telefon
Das Kloster Maulbronn gilt als die am besten erhaltene Klosteranlage des Mittelalters nördlich der Alpen. Hier sind alle Stilrichtungen von der Romanik bis zur Spätgotik in einer einzigartigen Dichte vertreten. Am Freitag, 12. August, um 8:30 Uhr unternimmt die Akademie für Ältere Heidelberg eine Kulturfahrt zu der ehemaligen Zisterzienserabtei. Nach einer Führung durch die Klosteranlage und der Mittagspause auf dem Klosterhof ist ein individueller Rundgang möglich sowie ein Besuch des Museums. Kosten: 15,- Euro mit Akademie-Pass. Anmeldung unter Telefon 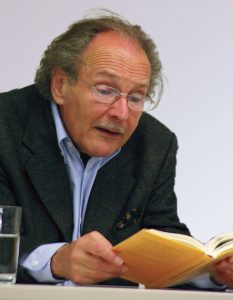 Peter Kurzeck hatte einen Plan. Sein Romanzyklus „Das alte Jahrhundert“ sollte bis zu zwölf Teile umfassen, und immer wieder neu versicherte sich der Schriftsteller des Ablaufs dieses 1997 mit „Übers Eis“ begonnenen Riesenprojekts auf Zetteln und in Notizbüchern. Einmal, so zeigte es mir sein damaliger Verleger KD Wolff (Stroemfeld/ Roter Stern) noch vor dem Tod Kurzecks, plante der in einem dieser Ablaufschemata sogar den Erhalt des Literaturnobelpreises nach Abschluss des großen Vorhabens ein. Leider erlebte er beides nicht:
Peter Kurzeck hatte einen Plan. Sein Romanzyklus „Das alte Jahrhundert“ sollte bis zu zwölf Teile umfassen, und immer wieder neu versicherte sich der Schriftsteller des Ablaufs dieses 1997 mit „Übers Eis“ begonnenen Riesenprojekts auf Zetteln und in Notizbüchern. Einmal, so zeigte es mir sein damaliger Verleger KD Wolff (Stroemfeld/ Roter Stern) noch vor dem Tod Kurzecks, plante der in einem dieser Ablaufschemata sogar den Erhalt des Literaturnobelpreises nach Abschluss des großen Vorhabens ein. Leider erlebte er beides nicht: