Naja: Nur einmal bringt des Jahres Lauf, uns Herbst und Lerchenlieder. Nur einmal blüht die Rose auf, und dann verwelkt sie wieder; nur einmal gönnt uns das Geschick, so jung zu sein auf Erden:
Hast du versäumt den Augenblick, jung wirst du nie mehr werden. Drum lass von der gemachten Pein, um nie gefühlte Wunden! Der Augenblick ist immer dein, doch rasch entfliehn die Stunden. Und wer als Greis im grauen Haar, vom Schmerz noch nicht genesen, der ist als Jüngling auch fürwahr, nie jung und frisch gewesen. Nur einmal blüht die Jugendzeit, und ist so bald entschwunden; und, wer nur lebt vergangnem Leid, wird nimmermehr gesunden.
(Richard von Wilpert 1862-1918)
„Tod, wo ist dein Stachel?“
Es ist doch der Tod im Westen das Entsetzlichste, derweil es aber im Osten Leben bedeutet. Im Westen muss man sterben (das ist der Lohn der Sünde), und im Osten muss man immer wiedergeboren werden (das ist die Strafe für begangenes Unrecht). „Erlösung“ im Westen ist Überwindung des Todes, im Osten ist es die Überwindung des Wiedergeboren-Werdens. Derweil Christus das ewige Leben verspricht, tröstet Buddha mit der Befreiung vom Leben, das er als Leiden erkannt hat.
 Der Ewige hat die Welt aus dem Tohuwabohu geformt. Die Neurophysiologen sind ihm dahinter gekommen und lassen jetzt jeden besseren Designer glauben, befähigt zu sein, es ihm nachtun oder es gar besser machen zu können als ER.
Der Ewige hat die Welt aus dem Tohuwabohu geformt. Die Neurophysiologen sind ihm dahinter gekommen und lassen jetzt jeden besseren Designer glauben, befähigt zu sein, es ihm nachtun oder es gar besser machen zu können als ER.
Lange Zeit meinte man, die (von einem Gott?) mit Inhalt gefüllten Formen seien hinter dem Inhalt verborgen und man könne diese dem Chaos am ersten Schöpfungstag aufgesetzten Formen dort entdecken. So seien die Himmel entstanden. Und Leute wie Pythagoras und Ptolemäus haben diese göttlichen Formen, Kreise und Epizykel hinter den Erscheinungen entdeckt und aufgezeichnet.
Später, seit der Renaissance,
ist man auf etwas Überraschendes und bislang Unverdautes gestoßen: Die Himmel lassen sich zwar in ptolemäischen Kreisen und Epyzikeln, aber noch besser in kopernikanischen Zirkeln und Kepler`schen Ellipsen formulieren und formalisieren. Also, wie ist das nun eigentlich? Hat ein Schöpfer am Ersten Tag Kreise, Epizykel oder Ellipsen verwendet? Unverdaulich an alledem für diejenigen, die dies weder verwinden wollen noch verdauen können ist, dass sich, ebenso wie die Himmel und überhaupt alle Naturaspekte nicht beliebig formalisieren lassen: Warum folgen die Planeten zwar entweder zirkulären oder epizyklischen oder elliptischen Bahnen, nicht aber quadratischen oder triangulären? Warum können wir Naturgesetze zwar verschieden, nicht aber beliebig formulieren? Gibt es etwa dort draußen etwas, das einige unserer Formeln schluckt, andere aber aus- und uns ins Gesicht spuckt? Ist dort eine „Wirklichkeit“, die sich zwar von uns informieren und formulieren läßt, aber dennoch eine Anpassung von uns fordert?
Oder darf uns das – für heute und diese Betrachtung – egal sein? Es sei!
Wunderwelt des Lebens
„Es gibt Geometrie im Summen der Saiten – es gibt Musik in den Abständen der Sphären“ Pythagoras.
Ich betrachte mit Bewusstsein – mit bewusstem Sein! – den aus Erde herauslugenden Pflanzensproß, und sogleich habe ich das ganze Rätsel vor mir. – Wer aber bin ich, der dies beobachtet und darüber nachdenkt? Es ist eine bemerkenswerte Eigenschaft unseres Geistes, dass er in der Lage ist, dieses allgegenwärtige Rätsel allein aus Gewohnheit zu übersehen:  Was uns im Äußeren so vertraut ist, dass wir es kaum noch wahrnehmen, das enthält im Innern eine Welt, die eines Tages vielleicht auf jede unserer Fragen eine Antwort geben wird. Eine Welt organisch gewachsener Strukturen und Funktionen, zu deren Entwicklung sich die Natur Jahrmillionen und Jahrmilliarden Zeit gelassen hat. Wir haben alltäglich aufs Neue mit organisatorischem und technischem Wunderland zu tun: Mit der Form einer Meeresschnecke, der Statik eines Röhrenknochens, der Struktur und Dynamik eines Wirbels, mit der Richtungsorientierung bei Tieren, dem Informationssystem der Zellen; all dies ist andersartig und interessant bis zum Übermaß. Und doch erst ein Einblick in äußere Hüllen.
Was uns im Äußeren so vertraut ist, dass wir es kaum noch wahrnehmen, das enthält im Innern eine Welt, die eines Tages vielleicht auf jede unserer Fragen eine Antwort geben wird. Eine Welt organisch gewachsener Strukturen und Funktionen, zu deren Entwicklung sich die Natur Jahrmillionen und Jahrmilliarden Zeit gelassen hat. Wir haben alltäglich aufs Neue mit organisatorischem und technischem Wunderland zu tun: Mit der Form einer Meeresschnecke, der Statik eines Röhrenknochens, der Struktur und Dynamik eines Wirbels, mit der Richtungsorientierung bei Tieren, dem Informationssystem der Zellen; all dies ist andersartig und interessant bis zum Übermaß. Und doch erst ein Einblick in äußere Hüllen.
Leides Sinn?
Das Leben schafft Neues, indem es Altes vernichtet – oder sich erst einmal bescheidet. Der Keimling wächst, indem er die Bohne sprengt. Es hat jeder schöpferische Mensch seine Auf- und Untergänge. Leiden gehört zum schöpferischen Leben, denn dies ist Überwinden des Alten, Sprengen der Käfige, ist Grenzüberschreitung. Unsere Zeit ist so kompliziert und so gegensätzlich, dass das üblicherweise gesuchte Ideal eines leidfreien, einfachen und ruhigen Lebens kaum einen schöpferischen Sinn hat. Je reicher doch ein Mensch innerlich ist, desto mehr trägt er auch mit und in sich etwas von den Fragen, Fragwürdigkeiten und Widersprüchen seiner – dieser – Zeit.
Vermutlich hat jedes ernstere und länger dauernde Leiden im Leben eines Menschen eine schöpferische Bedeutung. Freilich eine, die zunächst schwer zu erschauen ist. Ein Rückblick zeigt später aber eingetretene Veränderung: ein feineres, festeres, unbestechlicheres Gesicht („Jeder ist von einem gewissen Alter an für sein Gesicht verantwortlich“ – Schopenhauer), ein offenbarer Zuwachs an Persönlichkeit und geistiger Substanz, eine Schärfung des kritischen Sinns und eine ausgeglichenere Beurteilung menschlicher Werte.
Welt als Wille und Vorstellung: „Gnothi seauton – Erkenne dich selbst! Werde, der du bist!“
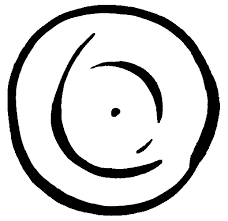 Ein Werdender, der – was Wunder – auf seinem Weg noch nicht alles gelöst hat schafft Reibung, Konflikt, Unruhe – Leidensstoff erst einmal genug: Das Unbegreifliche wirkt bedrohlich, das menschliche Leben scheint umschlossen von einem unberechenbaren Katastrophenhorizont, der sich noch immer bestätigt hat, wenn die Konventionen einen Dammbruch erlitten haben. Wir leben in dieser ungeheuerlichen Welt, sind umgeben von ihrem Atem und ihren Vibrationen. Die Paranoia unserer Zeit weist auf einen wirklichen Tatbestand, denn das sich anbahnende menschliche und ökologische Desaster ist so etwas wie die „Rache“ des unverstandenen und vergewaltigten Lebens.
Ein Werdender, der – was Wunder – auf seinem Weg noch nicht alles gelöst hat schafft Reibung, Konflikt, Unruhe – Leidensstoff erst einmal genug: Das Unbegreifliche wirkt bedrohlich, das menschliche Leben scheint umschlossen von einem unberechenbaren Katastrophenhorizont, der sich noch immer bestätigt hat, wenn die Konventionen einen Dammbruch erlitten haben. Wir leben in dieser ungeheuerlichen Welt, sind umgeben von ihrem Atem und ihren Vibrationen. Die Paranoia unserer Zeit weist auf einen wirklichen Tatbestand, denn das sich anbahnende menschliche und ökologische Desaster ist so etwas wie die „Rache“ des unverstandenen und vergewaltigten Lebens.
Mit Kant (eingeräumt – gebetsmühlenartig der Rundschau Motto: „sapere ade – wage zu wissen“) – und später dann mit den Bemühungen der Konstruktivisten – wurde dann deutlich, dass Philosophie letztlich nichts anderes als Selbsterkenntnis sein kann. Kants Verdienst war es zu zeigen, dass das, was erkannt wird, von dem, der es erkennt, zwangsläufig insofern abhängt, als der Erkennende das Erkannte notwendig konstruiert. Das bedeutet, dass die Wirklichkeit nicht so erkannt werden kann, wie sie an sich ist, sondern nur in jener Gestalt, in der sie für uns als solche erscheint. Alles ist nur innerhalb eines Bewusstseins und für dieses da.
Erkennbar wird die Welt, so Kant, ausschließlich als unsere Vorstellung. Welcher Art Ordnung sie tatsächlich entspricht, bleibt unentscheidbar. Faktum ist, dass wir selbst der Welt notwendig Ordnung beibringen müssen, um sie überhaupt erkennen zu können, und dass es ausschließlich unsere Ordnung ist, wenn etwas geordnet erscheint. Letztlich waren wir es, die die Welt konstruiert haben, und wir haben sie genau so entworfen, dass wir sie auch erkennen konnten. Ja, wir konnten sie gar nicht anders konstruieren, da wir sie nur so entwerfen können, wie unser Bewusstsein gebaut ist. Die Welt zu erkennen und sie zu konstruieren ist demnach ein und derselbe Vorgang. So gesehen, meint Kant, ist unser Verstand ein definitiv kreatives Instrument: Er „schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor!
„Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“
„Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen“.
Alles, was da kreucht und fleucht und wächst, alle vegetativen und animalischen Lebensvorgänge, alle Kreisläufe der Natur funktionieren ohne Absicht und ohne Anstrengung – selbst etwa die kraftvollsten Bewegungen eines Panthers erfolgen so; darin gerade liegt das Geheimnis ihrer Kraft und Schönheit.
Die Zen-Kultur des Ostens hat mit der „Kunst des Bogenschießens“ oder des Schwertes (Samurai) eben dies Prinzip verfolgt: höchste Schönheit und Perfektion ohne Absicht und Anstrengung. Es ist das Prinzip der Mitte („Hara“). Wer in seiner Mitte ruht, verfügt über kosmische Kräfte – gleichwie der Grashalm, der Baum und das (nicht domestizierte) Tier. Die das Leben vollbringende Kunst – wo es nicht gestört ist – besteht darin, diese Ruhe auch in der Bewegung nicht zu verlieren.
Die Fähigkeit, eine Absicht zu haben und ein Ziel zu verfolgen, ist eine späte Entwicklung der Evolution – als aber durchaus zusätzliche Fähigkeit und Potenz des Lebendigen – die freilich ihre eigentliche Ausprägung erst beim Menschen gefunden hat. Es kann aber nicht darum gehen, dies ignorierend, wieder eine Lebensweise ohne Ziel und Absicht herstellen zu wollen. Hingegen könnten wir uns Ziele sinnvoll setzen und diese in dem Sinne einsetzen, als wir sie als Fähigkeit einer lebensgesetzlichen Kultur, als universelles Prinzip des Lebendigen, sehen und verstanden haben.
Wir haben unsere Mitte verloren
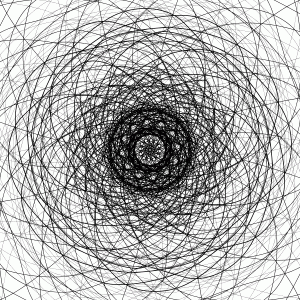 Wo immer ein deutlicher, großer Stil vorhanden war, auch in den kunstgeschichtlichen Epochen der Antike, der Romantik, Gotik, Renaissance etwa, dürfen wir eine innere Lebenshaltung vermuten, der ein ursprünglicher Erfahrungstyp des Lebendigen zugrunde lag. Selbstverständlich gilt das auch für die starken Formen der Moral. Diese nämlich war ja nicht nur ein Einsperren des Menschentiers in ein aufgezwungenes Korsett, sondern auch und vielleicht vor allem ein geschichtlicher Impuls der Selbsterfassung und Selbsterziehung des Menschen – und so ein wirklich humanistisches Medium. dass sie – in der Regel – das Gegenteil erzeugt hat, bezeichnet ihre Unzulänglichkeit, nicht ihr eigentliches, ihr inneres Motiv!
Wo immer ein deutlicher, großer Stil vorhanden war, auch in den kunstgeschichtlichen Epochen der Antike, der Romantik, Gotik, Renaissance etwa, dürfen wir eine innere Lebenshaltung vermuten, der ein ursprünglicher Erfahrungstyp des Lebendigen zugrunde lag. Selbstverständlich gilt das auch für die starken Formen der Moral. Diese nämlich war ja nicht nur ein Einsperren des Menschentiers in ein aufgezwungenes Korsett, sondern auch und vielleicht vor allem ein geschichtlicher Impuls der Selbsterfassung und Selbsterziehung des Menschen – und so ein wirklich humanistisches Medium. dass sie – in der Regel – das Gegenteil erzeugt hat, bezeichnet ihre Unzulänglichkeit, nicht ihr eigentliches, ihr inneres Motiv!
„Und hätte der Liebe nicht“
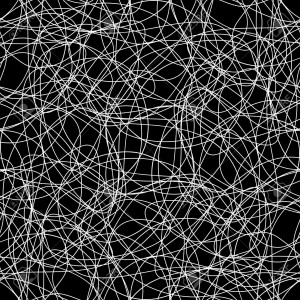 Unsere Geschichte ist, die ursprünglichen und echten Kulturschöpfungen waren immer auch ein Versuch des Menschen, sich in diesem Kampf zu behaupten.
Unsere Geschichte ist, die ursprünglichen und echten Kulturschöpfungen waren immer auch ein Versuch des Menschen, sich in diesem Kampf zu behaupten.
In den bewusstesten Gestalten der Moral- und Religionsgeschichte sollte er zugunsten des Prinzips Liebe gewonnen werden.
Eine moderne Schreibweise dieses Kampfes dürfte auf einer Präzisierung von Analyse und Selbstbeobachtung beruhen, nicht aber schon auf einer (und schon gar nicht) endgültigen Lösung des Problems.
„Angst essen Seele auf“
Was es heißt, ohne Angst zu lieben, ist für die allermeisten nicht einmal mehr vorstellbar, weil die Verbindung dessen, was wir als „Liebe“ bezeichnen, mit Verlustangst, Sexualangst, Autoritätsangst, Angst vor Ablehnung, vor dem Alleinsein und vor Verrat so „selbstverständlich“ ist, dass die Absurdität der Situation schon gar nicht mehr auch nur wahrgenommen wird. Wahrgenommen hingegen werden dann erst wieder die Folgen: Eifersucht, Krankheit, Depression und Zerbrechen der Beziehungen. Liebe ohne Angst, das ist allemal das Gegenteil von der in unserem Kulturkreis gelebten „Krankheit Liebe“.
Und, immer mal wieder: Der Kampf zwischen zwei Prinzipien
Anselm Feuerbach: Platons Symposium – Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Der trunkene Alcibiades besucht das Haus Agathons und unterbricht dort das Gastmahl.
Ich aber sage Euch: Angst, das ist der Antagonist, der eigentliche Gegner der Liebe. Haben wir erst einmal verstanden, wieviel „Humanität“, wieviel Verständnis und Toleranz, wieviel Zärtlichkeit und Rücksichtnahme, wieviel Vorsicht und Umsicht und wieviel Gefühl und Mitgefühl in Wahrheit auf das Konto der Angst gehen – sind wir erst einmal klarsichtige Zeugen jenes merkwürdigen Vorgangs geworden, mit dem wir selbst immer mal wieder an diesem allgemeinen Schmierentheater von Gefühlen und Worten teilnehmen – dann ahnen wir, was es heißt, was es bedeuten könnte, eine Gemeinschaft ohne Angst und Lüge aufzubauen – „… indem wir aber hinfahren hebt sich die Insel Utopia aus dem Meer des Möglichen!..“
Meist können wir Angst deshalb überhaupt nicht mehr auch nur bemerken, weil doch aus ihr unsere moralischen Übereinkünfte, unsere kulturellen Konventionen und Konversationen, unsere Ideologien und Verhaltensformen gemacht sind. Angst ist eingebunden in das System unserer alltäglichen Selbstverständlichkeiten, sie ist psychisches Ferment unserer ganzen Kultur.
Was tun? Philosophische Gedanken zur Befreiung sind ohnmächtig!
 Sie sind ohnmächtig jedenfalls, solange sie nicht die Entwicklung fördern, in welcher der innere Sprung geschehen kann, der zu dauerhaft neuer Erfahrung führt. Wir können ein geeignetes Gefäß bauen, auf die Füllung können wir nur hoffen. Dem „Prinzip Hoffnung“ wollen wir die realistischste Grundlage bauen, die uns heute möglich ist. Welch ungeheurer Stoff aus der Geistesgeschichte dabei gesehen, verstanden, assimiliert und verarbeitet werden könnte, hat Ernst Bloch in seinem Werk aufgezeigt. So gesehen ist Geschichte für uns eine unerschöpfliche Quelle der Entdeckung und Selbsterkenntnis – ist sie doch Werdeprozeß auch unserer eigenen Person. Was wir im tiefen Kern als „psychische Struktur“ in uns haben, ist als Niederschlag menschlicher Erfahrungen sedimentierte Geschichte. Selbstbejahung auf dieser Stufe des Bewusstseins ist deshalb auch das Annehmen jener Tradition, aus der wir kommen. Und weil der Mensch ein Mensch ist (drum hat er Stiefel im Gesicht nicht nur nicht gern, sondern), wird er auf Dauer nur eine solche Kultur annehmen, die ihn in seiner bedürftigen seelischen und leiblichen Existenz akzeptiert.
Sie sind ohnmächtig jedenfalls, solange sie nicht die Entwicklung fördern, in welcher der innere Sprung geschehen kann, der zu dauerhaft neuer Erfahrung führt. Wir können ein geeignetes Gefäß bauen, auf die Füllung können wir nur hoffen. Dem „Prinzip Hoffnung“ wollen wir die realistischste Grundlage bauen, die uns heute möglich ist. Welch ungeheurer Stoff aus der Geistesgeschichte dabei gesehen, verstanden, assimiliert und verarbeitet werden könnte, hat Ernst Bloch in seinem Werk aufgezeigt. So gesehen ist Geschichte für uns eine unerschöpfliche Quelle der Entdeckung und Selbsterkenntnis – ist sie doch Werdeprozeß auch unserer eigenen Person. Was wir im tiefen Kern als „psychische Struktur“ in uns haben, ist als Niederschlag menschlicher Erfahrungen sedimentierte Geschichte. Selbstbejahung auf dieser Stufe des Bewusstseins ist deshalb auch das Annehmen jener Tradition, aus der wir kommen. Und weil der Mensch ein Mensch ist (drum hat er Stiefel im Gesicht nicht nur nicht gern, sondern), wird er auf Dauer nur eine solche Kultur annehmen, die ihn in seiner bedürftigen seelischen und leiblichen Existenz akzeptiert.
Und bestätigt …
„Denken heißt Überschreiten.“ – Prinzip Hoffnung


