
Hier sehen wir in fröhlicher Andacht das Bild gar so mancher Frau von gar so manchen Mannsbilder*Innen …
Hat es uns – auch, wenn wir dem widerstanden haben, wirklich verändert? Ja, das hat es! Und, dass das einerseits zwar das Verhältnis der Geschlechter zueinander nicht positiv beeinträchtigt hat aber möglicherweise genau dies von militanten Feminist*Innen gewollt worden war – und wird, das ist durchaus mit Verve auch allüberall „kommuniziert“ worden. Begonnen hat hat die Verhunzung unserer Sprache in den Siebzigerjahren, als eine gendernd-feministische Welle die Lande durchzog: Emanzipation hieß das Schlagwort, Alice Schwarzer begann Männer zu ärgern, Simone de Beauvoir war Pflichtlektüre einer engagierten Weiblichkeit, die überzeugt war: Wir machen es besser als unsere Mütter. Etwa zeitgleich formierte sich eine feministische Linguistik, die beteuerte, dass „Machtstrukturen in der Sprache festgeschrieben“ würden, und mithin eine „feministische Sprachkritik*In“, gar nicht anders hätte können, als dagegen zu Felde zu ziehen.
„Die Sätze verweiblichen, die Frauen aus dem sprachlichen Abseits holen, in das sie verbannt worden waren“, so lautete das Programm. Das generische Maskulinum sollte entsorgt werden – mit der erträumten Nebenwirkung, die „Maskulinguistik“ im Besonderen und die Männer im Allgemeinen in ihre Schranken zu weisen: 1980 erschienen „Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs“ in der Zeitschrift „Linguistische Berichte“. Marlis Hellinger, Luise F. Pusch, Senta Trömel-Plötz schufen als Protagonistinnen eines geschlechtergerechten Wortbaus das Theoriegerüst, und Titel wie „Alle Menschen werden Schwestern“ (Pusch 1990) und „Vatersprache – Mutterland“ (Trömel- Plötz 1991) waren Sprungbretter aus den akademischen Elfenbeintürmen in die deutschsprachige Mitte. Nach drei Jahrzehnten feministischen Sprachkampfes steht fest: Die Damen verzeichnen Etappensiege, das Männliche ist nicht mehr, was es einmal war.
Aber: Ist verhunzte Sprache nur ein Kollateralschaden?
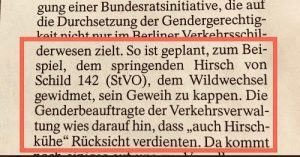 Die simplen Zeiten, in denen eines unumstößlich feststand, nämlich dass es zwei Geschlechter gibt, die sind mittlerweile, mit oder ohne genderei – vorbei. Aus der amerikanischen Queer-Theorie stammende Frauen suchten nach Stilmitteln, die der Vielfalt an Identitäten jenseits von Mann und Frau sprachlich Ausdruck verschaffen, die davon ausgeht, dass geschlechtliche und sexuelle Identität erst in soziokulturellen Prozessen geformt werde. Was aber ist daraus geworden?
Die simplen Zeiten, in denen eines unumstößlich feststand, nämlich dass es zwei Geschlechter gibt, die sind mittlerweile, mit oder ohne genderei – vorbei. Aus der amerikanischen Queer-Theorie stammende Frauen suchten nach Stilmitteln, die der Vielfalt an Identitäten jenseits von Mann und Frau sprachlich Ausdruck verschaffen, die davon ausgeht, dass geschlechtliche und sexuelle Identität erst in soziokulturellen Prozessen geformt werde. Was aber ist daraus geworden?
Dies alles bedeutet für manche wohl hoffnungsfrohe – Einfalt:
Der Gendergap_Unterstrich wird nach der Queer-Theorie jenen gerecht, die sich weder dem Männlichen noch dem Weiblichen zuordnen wollen oder können. Die sprachfeminististische Erneuerung hatte noch andere Ideen: Statt des Gendergap_Unterstrichs könnte es auch ein Gender*Stern sein, eine Art Joker – „Frauensprech“: „(*lallallallallallaa*) für alle verfügbaren Geschlechtsidentitäten. Also: die Frau_ , der Mann_, die Mutt_er. Oder: oder: d*Mann*, d*Hom*sex*, d*Lesb*, d*Salzstreu* Politik* bei Sonntagsreden: Lieb* Deutsch* – Man möchte so einen Text gerne einmal gesprochen hören.
Ernst Jandl hätte daran wohl gewiss seine Freude gehabt“
Wiewohl der nach Schönerem aus war:
„Wir sind die Menschen auf den Wiesen
bald sind wir Menschen unter den Wiesen
und werden Wiesen und werden Wald
das wird ein lustiger Landaufenthalt“.
Aber, weiter in unserem Text:

… und schon wieder haben „die“ (!) keine Frau mitspielen lassen – mal wieder nur Spaß für zwei Männer*Innen …
„In den sozial-, kultur- und geisteswissenschaftlichen Fächern der Universitäten hat sich die phallische Form der Geschlechtergerechtigkeit“ (nämlich: -In und -Innen oder als“star“ mit* ?) „als Standard durchgesetzt“.
Allenfalls noch Retro-Frauen wagen das generische Maskulinum, und sie werden dafür angefeindet („Sie gendert nicht!“). Männer aber wissen: Geschlechtergerechtigkeit ist längst zum Lippenbekenntnis verkommen. Sie sehen ihre Vormachtstellung durch den inflationären Gebrauch von ein paar Sonderzeichen nicht bedroht. Heutzutage wird die von (jedenfalls manchen) Frauen vehement-militant geforderte Sprachgerechtigkeit den Frauen von (jedenfalls manchen) Männern dann als allenfalls Danaer-Geschenk dargebracht. Diesen Eindruck muß mann an den Universitäten denken dürfen: Geht doch (und da könnt Ihr zusammen mit „Ton, Steine, Scherben“) noch lange singen und sagen): „Wir werden immer mehr!“ Und dann, dann bekommen wir Frauen mit aller Macht, womit wir Euch ablenken und wovon ihr denkt dass wir`s wollen: die Binnenversalien nämlich – mit oder ohne** – und wir werden Euch hernach bescheiden am Ende und klammheimlich wie sehr oder nicht so sehr auch wir dafür qualifiziert sein mögen: Dann querulieren wir nicht mehr weiter; Dann habt Ihr Eure Ruhe wieder und wir, wir bescheiden uns mit den Ordinariaten.
Feministische Kampfrhetorik auch in die Politik
Von den Universitäten marschierte die feministische Krampfrhetorik flugs in die Politik. Wer sich Wahlen stellen muss, schwatzt in Verdoppelungen: Bürgerinnen und Bürger. Da redet man mehr und muss weniger sagen. Da Frauen die Mehrheit des Stimmvolks stellen, wird stillschweigend angenommen, dass ihnen Verrenkungen und redundante Windungen gefallen, die man zu ihren Gunsten anbringt. Aber darauf mag (und auch die werden erfreulicherweise immer mehr) doch manche gern verzichten, der gute Rhetorik und Sprachästhetik wichtiger sind als phantasierte Verbalgerechtigkeit.
Ein Nutzen der allgegenwärtigen Beidbenennung ist vorerst nicht erkennbar. Drei Jahrzehnte sprachlicher Gleichbehandlung haben nur unschöne Texte, aber keine gesellschaftliche Gleichstellung gebracht. Mag es in manchen Bereichen Teilerfolge gegeben haben: Nach wie vor erziehen (manche) Frauen die Kinder und erledigen den Alltagskleinkram, (manche) Männer treffen die Entscheidungen und veranstalten die Bankenkrisen. Und wie schon vor vierzig Jahren wird diskutiert, ob Quoten mehr nützen oder mehr schaden.
Sprachfeministischen Schüsse nach hinten losgegangen?

DamenDemo (Dade) in New York: Zuzeiten, als „Geschlechtergerechtigkeit“ noch keine Selbstverständlichkeit war, gab es wirkliche Probleme, statt des dämlichen *In
Allmählich muss man („mann“ muß natürlich auch müssen dürfen) sich gar der Frage stellen, ob die sprachfeministischen Schüsse nicht nach hinten losgegangen sind und das Gegenteil dessen erreicht haben, was er, sie es beabsichtigt haben. Hat nicht die fortgesetzte Betonung des eigentlich Selbstverständlichen, nämlich der Mehrgeschlechtlichkeit, die gesellschaftlichen Ungleichheiten nicht nur nicht nicht aufgeweicht, sondern sogar zementiert? Denn ständig wird da genderisierend-implizit betont, dass es kein Miteinander gibt, keine Komplementarität der Geschlechter, keine Übergeschlechtlichkeit, die einfach nur alle Menschen umfasst. Immer wird extra hervorgehoben, dass immer Männer und Frauen da sind. Die Dichotomie, die man gutmenschlich aufzuheben meinte, wird in jedem Satz neu geschaffen, und der gesellschaftliche Graben wird und wird nicht flacher, sondern (schluchz) immer tiefer.
Viele der Bücher, welche die Welt bewegten, die Gesellschaft und Politik revolutionierten, welche die Jahrhunderte überdauerten, welche die Wissenschaften umstülpten, sind gut geschrieben, vom Gilgamesch-Epos über das Alte und das Neue Testament bis zum Koran, vielschichtig, vieldeutig, viele Lesarten zulassend. Von Homer bis Max Weber von Platon bis Bronislaw Malinowski, Martin Luther, Sigmund Freud, Dan† Tno, Michel Foucault, Pierre Bourdieu – sie alle konnten schreiben, und viele von ihnen hatten gute, einprägsame Buchtitel.
Wie will man mittels Buchstaben neue Wirklichkeiten schaffen, wenn alle paar Wörter ein Holzhammer die Sprachmelodie zertrümmert? Versal-I, Schrägstrich, Unterstrich, Asterisk, Verdoppelung und bzw.- Konstruktion: Mit diesen Waffen kann man keine linguistische Schlacht gewinnen, das ist kein Sprachkampf, sondern Sprachkrampf. Damit sollte man“ m(M)an(n, ja der auch)“ endlich aufhören.
Das Beste, das ich zu diesem Thema gehört habe – und das größte von mir zu vergebenen Lob: „Das hätte ich nicht beser machen können – der Wahrheit die Ehre: nicht mal genauso gut:
Eine fundierte Arbeit zum Thema.
Und, gerade rief einer meiner Hamburger Freunde an, mich wissen zu lassen, dass ich über „gendern“ schon mal was geschrieben hätte. Ich hatte das (ganz ehrlich) bereits vergessen.