 Später einmal, in einigen Jahren, wenn unsere Kinder oder Enkel oder wir selbst uns fragen, wie das damals war in der Pandemie, dann werden wir uns an Details erinnern, an die Masken und an Teststäbchen in der Nase, an Frau Merkels Ansprachen, an den ausgefallenen Urlaub und an die Trauer um Gestorbene. In historischen Rückblicken werden Lehren aus der Seuche gezogen worden sein und sie werden in den Kontext des frühen 21. Jahrhunderts eingeordnet. Aber heute, wo wir noch mittemang in dieser Weltkrise stecken, fällt es uns schwer, den Kopf aus dem täglichen Nachrichten- und Erlebnisstrom zu heben und das große Ganze zu sehen. Wir erfahren, dass das Impfprogramm nicht gut läuft und das Testen zu langsam geht – aber warum genau?
Später einmal, in einigen Jahren, wenn unsere Kinder oder Enkel oder wir selbst uns fragen, wie das damals war in der Pandemie, dann werden wir uns an Details erinnern, an die Masken und an Teststäbchen in der Nase, an Frau Merkels Ansprachen, an den ausgefallenen Urlaub und an die Trauer um Gestorbene. In historischen Rückblicken werden Lehren aus der Seuche gezogen worden sein und sie werden in den Kontext des frühen 21. Jahrhunderts eingeordnet. Aber heute, wo wir noch mittemang in dieser Weltkrise stecken, fällt es uns schwer, den Kopf aus dem täglichen Nachrichten- und Erlebnisstrom zu heben und das große Ganze zu sehen. Wir erfahren, dass das Impfprogramm nicht gut läuft und das Testen zu langsam geht – aber warum genau?
Wir hören von Verhandlungen in Brüssel und Berlin, sehen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten mit müden Gesichtern auf nächtlichen Pressekonferenzen – aber was genau haben sie vorher wirklich besprochen? Wie fügen sich die einzelnen Meldungen und Ereignisse zur Geschichte zusammen, wie wird aus der subjektiv erlebten Krise eine wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklung?
Gerade ist das Buch „Ausbruch“ mit dem Untertitel „Innenansichten einer Pandemie – Die Corona-Protokolle“, von Georg Mascolo und seiner Frau Katja Gloger im Piper-Verlag erschienen, die seit Beginn der Pandemie recherchiert und herausgefunden haben, was in vertraulichen Runden besprochen wurde und wer warum welche Entscheidungen traf. Sie beschreiben, wer den Ausbruch anfangs vertuschte, wie Politiker von Angst und Erschöpfung berichten – und dass Fachleute schon lange vor einer Pandemie gewarnt hatten.
Das Buch ist eine Fundgrube an Wissen, stellenweise spannend wie ein Thriller. Wer die Hintergründe der Corona-Krise in Deutschland verstehen will, sollte es lesen. Und damit Sie früh und gut informiert sind, wurden Katja Gloger und Georg Mascolo um ausführliche Antworten auf einige Fragen gebeten:
Frau Gloger, Herr Mascolo, Sie haben monatelang über die Entwicklung der Corona-Krise in Deutschland recherchiert. Sie schreiben, dass Sie Hunderte Dokumente, vertrauliche Vermerke, Protokolle aus den Krisenstäben, persönliche Mitschriften und Notizen aus den Krisenrunden gesichtet haben. Wie lautet nach all diesen Einsichten Ihr Fazit: Wann war der Moment, als das anfangs erfolgreiche deutsche Krisenmanagement nicht mehr gut genug funktionierte?
Katja Gloger: Die eine Bund-Länder-Beratung, den einen politischen Kipppunkt in dieser Pandemie gab es nie. Im vergangenen Frühjahr wurde Deutschland zum bewunderten Beispiel erfolgreicher Pandemiebekämpfung, zumindest im europäischen Vergleich. In einem Sommer der Sorglosigkeit, als man glaubte, man habe das Virus im Griff, wurde dann auf allen Ebenen zu wenig getan, um sich intensiv auf die schwerere Zeit im Herbst und Winter vorzubereiten: auf die zweite Welle, von der man ja wusste, dass sie kommen würde. Das Trauerspiel einer sinnvollen, den Gesundheitsämtern wirklich helfenden Corona-App ist ein Beispiel dafür.
Georg Mascolo: Wie eine Welle bauten sich dann im Herbst gegenseitiges Unverständnis und wohl auch wachsendes Misstrauen auf, hinzu kamen die unterschiedlichen regionalen Verhältnisse mit ihren unterschiedlichen Infektionszahlen. Das machte ein kohärentes Vorgehen schwer und verstärkte den Eindruck, dass ohnehin jeder mache, was sie oder er wolle. Und all das bestärkt nicht gerade das Vertrauen der Menschen.
Konkret, was ist schiefgelaufen?
Gloger: Die wohl wichtigste Währung in einer Pandemie ist Zeit, Schnelligkeit. Möglichst frühes Handeln. Die anfängliche Vertuschung des SARS-CoV-2-Ausbruchs durch die chinesische Regierung kostete wertvolle Wochen, die zögerliche Reaktion der WHO ebenfalls. Aber auch in Deutschland wollte man die Gefahr anfangs eher nicht wahrhaben. Bis die Bilder aus Bergamo kamen.
Mascolo: Obgleich es in den vergangenen Jahren zahlreiche Warnungen vor einer Pandemie gab und obgleich man – zum Beispiel aus der Erfahrung der Ebola-Epidemie 2014/15 hätte lernen können, wurde das Risiko verdrängt. Es gab noch nicht einmal Lager für Schutzausrüstung. Risikobewusstsein – nicht Panikmache – und Prävention können dazu beitragen, dass aus einer Krise keine Katastrophe wird. Aber das große Selbstvertrauen, die erste Welle so gut gemeistert zu haben, hat dann zu den Versäumnissen im Herbst und Winter beigetragen. Ein entscheidender Fehler war es wohl, nicht frühzeitig möglichst viele Produktionskapazitäten für die erhofften Impfstoffe zu schaffen.
Mascolo: Obwohl es in den vergangenen Jahren zahlreiche Warnungen vor einer Pandemie gab, obwohl man aus der Erfahrung der Ebola-Epidemie 2014/15 hätte lernen können, wurde das Risiko verdrängt. Es gab noch nicht einmal Lager für Schutzausrüstung. Risikobewusstsein – nicht Panikmache – und Prävention können dazu beitragen, dass aus einer Krise keine Katastrophe wird. Aber das große Selbstvertrauen, die erste Welle so gut gemeistert zu haben, hat dann zu den Versäumnissen im Herbst und Winter beigetragen. Ein entscheidender Fehler war es wohl, nicht frühzeitig möglichst viele Produktionskapazitäten für die erhofften Impfstoffe zu schaffen.
Wer ist dafür verantwortlich?
Mascolo: Wer nicht? Ein Virus lässt sich nicht wegwünschen, eine Pandemie nicht bekämpfen, indem man sie ignoriert. Pandemien sind unbestechliche Lehrmeister. Sie zaubern das Beste in den Menschen hervor – und lassen das Schlechteste hervortreten (wofür die bekannt gewordenen Gaunereien stehen mögen). Erbarmungslos halten sie Gesellschaften den Spiegel vor. Sie entblößen strukturelle Schwächen und jahrelang aufgeschobene Entscheidungen. Das Trauerspiel der versäumten Digitalisierung ist ein Beispiel dafür.
Das Runterfahren ist Deutschland gut gelungen, das Hochfahren nicht. Das Impfen und das Testen begannen zu spät und sind umständlich organisiert, die Wirtschaftshilfen fließen nur zögerlich. Warum klappt das im hochentwickelten Deutschland nicht besser?
Mascolo: Ein leistungsfähiger, durchorganisierter Staat ist ein Segen, aber Bürokratie und Pandemie vertragen sich nicht besonders gut. Wir verschicken lieber vielfach geprüfte Berechtigungsscheine für medizinische Masken, für die alte Menschen dann vor den Apotheken anstehen müssen, anstatt sie gleich zu verschicken oder landesweit auf Marktplätzen zu verteilen. Mehr Flexibilität und Pragmatismus würden helfen.
Gloger: Bei der Beschaffung von Impfstoffen war und ist es im Prinzip richtig, dies im Rahmen der EU mit ihrer Marktmacht von 500 Millionen Menschen zu organisieren. Die EU geriet ja am Anfang der Pandemie in eine echte Krise. Es kam zu geschlossenen Grenzen und Exportstopps. Die unterschiedlichen Vorstellungen, Bedenken und Vorbehalte von 27 Mitgliedsstaaten, welche Impfstoffe man bei welcher Firma zu welchem Preis bestellen sollte, kosteten dann erneut wertvolle Zeit.
Gloger: Bei der Beschaffung von Impfstoffen war und ist es im Prinzip richtig, dies im Rahmen der EU mit ihrer Marktmacht von 500 Millionen Menschen zu organisieren. Die EU geriet ja am Anfang der Pandemie in eine echte Krise. Es kam zu geschlossenen Grenzen und Exportstopps. Die unterschiedlichen Vorstellungen, Bedenken und Vorbehalte von 27 Mitgliedsstaaten, welche Impfstoffe man bei welcher Firma zu welchem Preis bestellen sollte, kosteten dann erneut wertvolle Zeit.
Mascolo: Die zweite geimpfte Person in Großbritannien hieß William Shakespeare. Dessen berühmter Namensvetter hat in seinem Stück „König Lear“ den Satz geschrieben: „Oft büßt das Gute ein, wer Besseres sucht.“ Bei allem Respekt für die gewaltige und kräftezehrende Aufgabe, vor der die Politikerinnen und Politiker inzwischen seit über einem Jahr stehen: Im Moment läuft zu viel schief. Nun kommt auch noch der Korruptionsverdacht gegen Abgeordnete von CDU und CSU hinzu. „Wir werden einander noch viel verzeihen müssen“, hat Jens Spahn gesagt. Mag sein. Aber Bereicherung auf Kosten der Not von Menschen ist nicht zu verzeihen.
In der Öffentlichkeit wirkt es oft so, als verfolge Kanzlerin Merkel einen konsequenten, besonnenen Kurs, während die Ministerpräsidenten kurzsichtig und chaotisch agieren. Entspricht diese Wahrnehmung der Realität?
Gloger: Sie gehörte jedenfalls früh zu denen, die sich für eine besondere Vorsicht entschieden, für einen eher restriktiven Kurs. Vor vielen anderen ging sie von einem Wiederanstieg der Infektionszahlen im Herbst aus.
Gloger: Sie gehörte jedenfalls früh zu denen, die sich für eine besondere Vorsicht entschieden, für einen eher restriktiven Kurs. Vor vielen anderen ging sie von einem Wiederanstieg der Infektionszahlen im Herbst aus.
Das Buch
Die Geschichte eines politischen Ausnahmezustands
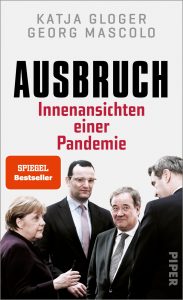 Eine Pandemie erschüttert die Welt. Von Anfang an verfolgten die Investigativjournalisten Katja Gloger und Georg Mascolo wie ein Virus namens Sars-CoV-2 das Leben, wie wir es kannten, auf dramatische Weise veränderte. Sie erlangten exklusiven Zugang hinter die Kulissen der Politik, die trotz früher Warnungen so gut wie unvorbereitet getroffen wurde.
Eine Pandemie erschüttert die Welt. Von Anfang an verfolgten die Investigativjournalisten Katja Gloger und Georg Mascolo wie ein Virus namens Sars-CoV-2 das Leben, wie wir es kannten, auf dramatische Weise veränderte. Sie erlangten exklusiven Zugang hinter die Kulissen der Politik, die trotz früher Warnungen so gut wie unvorbereitet getroffen wurde.
Ihr Buch deckt bisher unbeschriebene Zusammenhänge auf, anhand von Augenzeugenberichten und vertraulichen Dokumenten schildert es die Entscheidungen, Unsicherheiten und Zweifel. Deutschland im Ausnahmezustand: von der kollektiven Verdrängung des Risikos bis zu Lockdowns und umstrittenen Lockerungen. Und sie wagen einen Blick in die Zukunft: Was lässt sich aus der Krise lernen?

