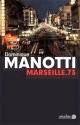 Dominique Manotti hält mit ihrem Noir „Marseille.73“ jenen Moment in der französischen Geschichte fest, als sich Ressentiment, Macht und Verbrechen zu einer rechtsextremen Bewegung formierten.
Dominique Manotti hält mit ihrem Noir „Marseille.73“ jenen Moment in der französischen Geschichte fest, als sich Ressentiment, Macht und Verbrechen zu einer rechtsextremen Bewegung formierten.
Marcello Fois erzählt in seinem Roman „Abschiede“ vom Verschwinden eines Sohnes und dem Sterben eines Vaters.
Im Jahr 1973 waren die Trente glorieuses vorbei, die glorreichen Jahre der französischen Nachkriegsgeschichte, und besonders unschön zeigte sich dies im Sommer jenes Jahres in Grasse, dem malerischen Städtchen der Blumen und der Düfte in der Provence.
Mit dem Erlass Marcellin-Fontanet war wenige Monate zuvor verfügt worden, dass Einwanderer in Frankreich fortan eine Arbeitserlaubnis und eine anständige Unterbringung vorweisen müssen, um im Land bleiben zu dürfen. Natürlich verfügten sie weder über das eine noch das andere. Als sich in Grasse einige Hundert Tunesier zusammentaten, um für Papiere und bessere Wohnungen zu streiken, bekamen sie es mit dem rechtsextremen Ordre nouveau zu tun, dessen Schlägertrupps Jagd auf die nordafrikanischen Einwanderer machten: Die Hatz von Grasse am 12. Juni 1973 wurde zum Fanal einer ganzen Serie rassistischer Übergriffe in Südfrankreich, die am Ende des Jahres fünfzig Menschenleben kosten sollten. Zehn Jahre nach Ende des Algerienkrieges lebten dort besonders viele nach Frankreich zurückkehrte Pieds-Noirs, Algerienheimkehrer, die ihrem Groll gegen die Einwanderer ungehemmten Lauf ließen, nach der Devise: Sie haben uns vertrieben, jetzt vertreiben wir sie.
Dominique Manotti greift sich für ihren Roman „Marseille.73“ diesen emblematischen Moment der französischen Geschichte heraus, an dem sich der Front National gründete und der Rassismus in der französischen Politik festsetzte. Brennpunkt ist natürlich Marseille, die Stadt, in der sich die rechtsextreme Terrororganisation OAS, die korsische Mafia und die Polizei zu einem undurchdringlichen Netz von Hass, Macht und Verbrechen verflochten hatten.
Bei Manotti liest sich das so: Ein geistig verwirrter Algerier tötet einen Busfahrer und provoziert damit wütende Reaktionen der zahlreichen rechtsextremen Grüppchen, die sich in den Bars um die Oper und den alten Hafen scharen. Manche belassen es bei rassistischen Flugblatt-Aktionen, andere bei Drohanrufen, doch eine Gruppe geht dazu über, in den quartiers nord gezielt algerische Männer zu töten, einer von ihnen ist der junge Malek Khider. Er wird vor Bar Terminus in La Calade aus einem Auto heraus erschossen, mit einer Unique 7.65, das Kaliber der Polizeiwaffe.
Ein eindeutiger Fall, doch die Polizei von Marseille sieht nichts, hört nicht, sagt nichts. Um den Anschein zu wahren, ermittelt sie ein bisschen gegen Maleks Freund in der Berufsschule und seinen älteren Bruder – oder verbreitet vielmehr falsche Verdächtigungen. Doch Einheiten aus Toulon haben schon länger das Geflecht der Algerienheimkehrer im Visier und deshalb Verbindung aufgenommen zu Kommissar Théodore Daquin bei der Brigade Criminelle und seinen beiden verlässlichen Inspektoren Grimbert und Delmas. Sie sollen gegen ihre Kollegen ermitteln.
Daquin ist noch jung und neu in der Stadt, gerade hat er seinen ersten großen Fall gelöst und damit den Unmut der Bürokratie auf sich gezogen. Einige besonders missgünstige Kollegen zielen darauf ab, ihm an den Karren zu fahren, und sein Liebhaber, der aufstrebende Anwalt Vincent Royer, verlegt sich zunehmend auf die Verteidigung der Marseiller Unterwelt. Die Stadt bleibt ihm fremd: „Bevor er zum Evêché aufbricht, wirft Daquin einen letzten Blick auf den Vieux-Port zu seinen Füßen, das graugrüne, reglose Wasser, die verwaisten Kaianlagen, kein Geräusch, keine Bewegung, das Leben steht still. Die Stadt atmet nicht mehr. In einer Handvoll Stunden wird sie Emile Guerlache zu Grabe tragen, sie wartet, sie stinkt nach Blut.“
Manotti breitet in all seinem Schrecken das Netz des Verbrechens aus, das Marseille in den siebziger Jahren so berüchtigt gemacht, das Geflecht aus OAS, Unterwelt und Polizei. Je nach Einkommensklasse treffen sie sich im proletarischen Le Foudre oder in der noblen Grand Bar Henri. Wie gewohnt erzählt Manottis in ihrem dokumentarischen Stil, in scharfkantiger Prosa und in kurzen, harten Parataxen. Die inzwischen 78-jährige Autorin, einst Wirtschaftshistorikerin und Gewerkschafterin, hat ihre Kriminalromane stets als politische Interventionen verstanden, aber mit einem großartigen Tableau komplexer Figuren versehen. In „Marseille.73“ sind sie ungewöhnlich schwach ausgearbeitet, um nicht zu sagen schwarzweiß: Auf der schattigen Seite der Macht stehen Rassisten, Pieds-Noirs, Gaullisten und Peugeot-Händler, auf der sonnigen Seite der Gegenmacht die Migranten, Kommunisten und die Sprösslinge der Résistance. Politisch oder historisch mag das vielleicht plausibel sein; literarisch ist es das aber nicht.
Dominique Manotti: Marseille.73. Roman.
Aus dem Französischen von Iris Konopik.
Ariadne Verlag, Hamburg 2020,
387 Seiten, 23 Euro
