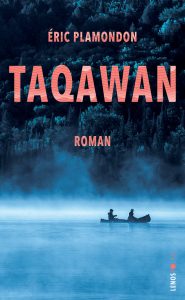 Taqawan“ ist nicht eigentlich ein Roman und die kriminalistischen Elemente sind absolut zweitrangig. Der Frankokanadier Eric Plamondon erzählt von einem historischen Unrecht, und er tut dies mit allen Mitteln der Poesie. Es geht um den großen Lachskrieg von 1981, als sich die kanadischen Ureinwohner gegen das Verbot stemmten, in den Flüssen mit Netzen Lachs zu fangen. Die Mi’gmaq sind eine der großen indianischen Nationen in Kanada, sie leben zurückgedrängt auf der Gaspésie-Halbinsel von Québec, der Fluss Restigouche bildet die Grenze ihres Reservats, aber auch zugleich ihre Ernährungsgrundlage.
Taqawan“ ist nicht eigentlich ein Roman und die kriminalistischen Elemente sind absolut zweitrangig. Der Frankokanadier Eric Plamondon erzählt von einem historischen Unrecht, und er tut dies mit allen Mitteln der Poesie. Es geht um den großen Lachskrieg von 1981, als sich die kanadischen Ureinwohner gegen das Verbot stemmten, in den Flüssen mit Netzen Lachs zu fangen. Die Mi’gmaq sind eine der großen indianischen Nationen in Kanada, sie leben zurückgedrängt auf der Gaspésie-Halbinsel von Québec, der Fluss Restigouche bildet die Grenze ihres Reservats, aber auch zugleich ihre Ernährungsgrundlage.
Die großen Trawler vor der Küste haben die Lachsbestände minimiert, am oberen Flusslauf beschweren sich die luxuriösen Anglerressorts, sie könnten ihren Gästen aus New York, Washington und Toronto keine Beute mehr bieten.
Die fünfzehnjährige Océane erlebt vom Schulbus aus die Konfrontation ihrer Eltern mit der Sûreté du Quebec, die im Dienste des Artenschutz die Fischer vom Restigouche verjagt: „Die Indianer sind von der Kavallerie umzingelt. Der Ton wird schärfer. Die Reihe werden geschlossen. Die Staatsgewalt will Keile.“ Sie ist ein draufgängerisches Mädchen, haut sofort ab, über die große Brücke hangelt sie sich zurück ins Reservat. Ihr Vater wird von der Polizei festgenommen und übel zugerichtet. An Océane werden sich drei Polizisten noch schlimmer rächen, für ihre Unbotmäßigkeit.
Die Erzählung von der einnehmenden Océane und dem freundlichen Ranger Yves, der sie zusammen mit dem alten Indianer William und einer jungen Lehrerin aus Frankreich rettet und wieder aufpäppelt, zieht sich durch das Buch, sie ist etwas überzeichnet, wird jedoch immer wieder unterbrochen von Einschüben und Exkursen aller Art. Plamondon fügt alte indianischen Weisheiten ein („Zum Laichen muss ein Lachs erst einmal flussaufwärts schwimmen“), traditionelle Überlieferungen, Mythen und Legenden, Einträge aus Geschichtsbüchern, Fernsehnachrichten, die Lieder von Céline Dion, zu denen das frankophone Kanada im Juni 1981 schmachtete, zoologische Erläuterungen zum Leben der Lachse oder ein Rezept für Austernsuppe.
Es ist ein fragmentarisches, multiperspektivisches Erzählen, aus dem Diskretion spricht, das aber einen enormen Sog ausübt. Plamondon nähert sich seinem Sujet vorsichtig, aus den verschiedensten Blickwinkeln, und immer von außen. Plamondon maßt sich nichts an. Oft sind die einzelnen Kapitel nur ein bis zwei Seiten lang, manchmal nur eine halbe Seite. Alles, was Plamondon anführt, ist interessant: Wenn Caesar Kleopatra verführen wollte, servierte er ihr Lachs. Im Jahr 1030 führte Malcolm II. in Schottland eine Schonzeit für Lachse ein, zweihundert Jahre später regelte die Magna Charta, wer an welchem Flussabschnitt angeln durfte. Dagegen die Mi’gmaq: Seit Jahrhunderten fangen sie ihren Fisch mit Netzen, für andere Tiere haben sie ausgeklügelten Fallen entwickelt: Hasen, Luchse oder Elche fangen sie mit Schlingen, Bären in einem Holzverschlag, in dem ein zweihundert Kilo schwerer Baumstamm als Totschläger dient. Kinder gehen nachts gern auf Jagd, um ein paar Gänse zu erlegen.
Aber vor allem lenkt Plamondon den Blick auf die Unterdrückung, der die Mi’gmaq über Jahrhunderte ausgesetzt sind. Das hat etwas Didaktisches. Aber warum nicht? Ein bisschen Nachhilfe scheint hier Not zu tun. Erst seit Ende des Zweiten Weltkriegs dürfen sie ihre traditionellen Zeremonien abhalten, Potlatch, Sonnentanz oder Powwow. Bis 1960 durften sie in Kanada nur wählen, wenn sie ihres Status als Indianer aufgaben, in Québec erst seit 1969.
Ein galliger Kommentar: „In Québec haben wir alle Indianerblut. Entweder in den Adern oder an den Händen.“ Besonders bitter ist, dass die Mi’cmaq beim ersten großen Gefecht auf dem Restigouche, im Siebenjährigen Krieg, auf der Seite der Franzosen gegen die Engländer kämpften. Die Frankokanadier dankten es ihnen, indem sie im Krieg um den Lachs ihr eigenes Süppchen mit der Zentralregierung kochten. Aber auch das weiß William, der alte Indianer: „Kolonialismus ist ein bisschen wie ein Lachs, du kannst ihn im Meer aussetzen, aber er schwimmt immer dahin zurück, wo er hergekommen ist.“
Eric Plamondon: Taqawan.
Roman. Aus dem Französischen von Anne Thomas.
Lenos Verlag, Basel
ISBN 978-3-03925-004-2
208 Seiten – 22 Euro
Erschienen 29. September 2020
