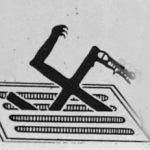
 In den – und das ganz und garnicht klammheimlich – sozialen Netzwerken hat sich als das Ergebnis einer gezielten Spaltung der Öffentlichkeit die AfD ihr eigenes Wahlvolk gezüchtet. Deren Mitglieder haben Wahlausgänge – in einigen Fällen sogar gleich beim ersten Mal – erheblich mit beeinflusst. Entscheidend nämlich für den Erfolg in sozialen Netzwerken sind nicht nur die reinen Fan- und Follower-Zahlen, sondern – wer genau Einem (im Bild „ne kleine braune Wanze“) dort folgt – und ob er, sie, oder es reagiert. Nur, wenn (zum Beispiel) Typen erreicht werden, die für die eigenen Botschaften empfänglich sind, stellt sich langfristiger Erfolg ein. Besonders raffiniert bedient sich in diesem Feld moderner – nennen wir es mal – Kommunikation in der Tat die ansonsten doch eher dezidiert rückwärtsgewandte AfD …
In den – und das ganz und garnicht klammheimlich – sozialen Netzwerken hat sich als das Ergebnis einer gezielten Spaltung der Öffentlichkeit die AfD ihr eigenes Wahlvolk gezüchtet. Deren Mitglieder haben Wahlausgänge – in einigen Fällen sogar gleich beim ersten Mal – erheblich mit beeinflusst. Entscheidend nämlich für den Erfolg in sozialen Netzwerken sind nicht nur die reinen Fan- und Follower-Zahlen, sondern – wer genau Einem (im Bild „ne kleine braune Wanze“) dort folgt – und ob er, sie, oder es reagiert. Nur, wenn (zum Beispiel) Typen erreicht werden, die für die eigenen Botschaften empfänglich sind, stellt sich langfristiger Erfolg ein. Besonders raffiniert bedient sich in diesem Feld moderner – nennen wir es mal – Kommunikation in der Tat die ansonsten doch eher dezidiert rückwärtsgewandte AfD …
Ihr ist es sogar gelungen, aus auserwählten Zielgruppen ein eigenes „Digi-Volk“ zu bilden, über deren Vernetzung alsbald ein Gemeinschaftsgefühl wabert – dessen Kitt sodann m Wesentlichen aus gemeinsamen Feindbildern besteht.
Damit Unternehmen, Parteien oder AfD-Mitarbeiter in sozialen Netzwerken Zielgruppen möglichst effektiv erreichen und bilden können, bieten die Plattformen Hilfsmittel an. Gegen – was Wunder – Bezahlung platzieren sie Beiträge auf den Bildschirmen spezifischer Nutzergruppen. Microtargeting nennt sich das gut belohnte Spiel. Micro, weil sich die die Zielgruppe so passgenau wie in keinem anderen Medium definieren läßt. Anders nämlich als bei TV-Werbespots oder Zeitungsanzeigen kann der Werbende exakt bestimmen, was jene draus machen, welche seine Anzeige gezeigt bekommen: Postleitzahl, Alter, Geschlecht sowieso, aber auch Gehalt, Hobbys, Beziehungsstatus, Vorlieben darinnen oder Lieblingsessen und selbst kurze, für Werber aber hochattraktive Lebensphasen wie „frischgebackene Eltern“ sind so identifizierbar. Und, was man nicht selbst preisgegeben hat, erschließt sich – genau: „Facebooks Mr. Zuckerberg verdient an alledem“ – durch das Klickverhalten, das man an den Tag beziehungsweise in den (sic) Trog legt.
Auch die AfD nutzt diese Werbemethode. Wie genau, das ist natürlich ihr Geheimnis. Aber es lassen sich Gedankenexperimente anstellen, wen die AfD wie ansprechen könnte: Die Partei sorgt sich etwa um die Sicherheit deutscher Frauen. Durch die Migration von „einer Million junger arabischer Männer“ (Guido Reil) seien „die Angsträume für blonde Frauen größer geworden“ (Björn Höcke). Junge Frauen, die an Selbstverteidigung interessiert sind, kann man über Facebook leicht erreichen. Oder solche, die im Großraum Köln leben (Stichwort: Jene Silvesternacht 2015). Nach diesem Prinzip könnte – und wie mittlerweile bekannt geworden ist tut sie das auch – die AfD in den verschiedensten Mikrogruppen der Gesellschaft nach Unterstützern fischen:
Arbeitssuchende aus deindustrialisierten Regionen, das Publikum von RT Deutsch, Sympathisanten der NPD oder Identitären Bewegung oder – wie gerade gehabt – sonstige meschuggene Ausländerfeinde. Für Parteien ist das Werbeinstrument von Facebook wie ein Selbstbedienungsladen für Wählergruppen, nur – und zwar erheblich – billiger. Wer seine Anzeige raffiniert durchdenkt und an die richtige Zielgruppe ausspielt, kann schon mit rund 200 Euro knapp tausend engagiert-hochrelevante Fans als Selbstläufer dazu gewinnen.
Der Algorithmus liefert nach,
was gerade im Gespräch ist
Eine interessierte Fangemeinde auf Facebook zu haben ist wichtig. Denn die zentrale Währung ist nicht die Fan-Zahl einer Seite, es sind die „Interaktionen“ des Publikums. Je mehr Reaktionen dann auf die in der Regel selbstgetrickten Beiträge, die Tag für Tag auf die Seite eintrudeln, generiert werden, desto höher werden diese von Facebooks Algorithmus eingestuft. Womit der AfD gelingt, dass besonders viele motivierte Menschen mit ihren Beiträgen interagieren. Es ist die Kombination eines aktuellen angekickten Themas, etwa „Asylkosten pro Bürger im Jahr 423 Euro “) mit einer zudem exakt zugeschnittenen, ideologischen Interpretation „oder das sind vier Tankfüllungen, drei Monate Stromrechnung oder 1.405 Windeln fürs Baby und noch einem emotionalen Bildchen, Motiv blauäugigs Baby, schon ist ein genervter Familienvater überzeugt davon, dass da was faul ist im Staate – und wäre es auch nur Dänemark. Und dass, was er nach alledem gerade tut „interagieren“ heißt, muss ihn da doch wirklich nicht auch noch interessieren. Daraus nun wiederum schließt der Algorithmus, dass der Beitrag auch für andere Nutzer interessant sein könnte – und liefert ihn an noch mehr Menschen. Die Interaktionsrate, auf das ganze Jahr 2016 gemessen, lag bei der AfD bei 8,5 Prozent. Das heißt, dass im Durchschnitt jeder Fan etwa mit jedem zehnten Beitrag interagiert. Bei drei Beiträgen pro Tag und über 300.000 Fans ist das enorm. Der Algorithmus wird befriedigt. Für alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien lag diese Rate bei 2,6 Prozent oder weniger. Durch die Weiterverbreitung der Inhalte erreicht ein populärer Facebook-Beitrag der AfD bis zu vier Millionen Menschen – das entspricht der Zuschauerzahl der Tagesschau und übertrumpft die der heute-Nachrichten an manchen Tagen. Mit einem Post. Die Facebook-Seite der AfD ist also zu einem alternativen Massenmedium geworden. Genau genommen: zu einem Massenspaltungsmedium.
Die AfD kümmert sich nicht um Sorgen der Bürger
sondern verstärkt diese! Warum wohl?
Die AfD aktiviert mit ihren Beiträgen Emotionen, in erster Linie Angst und Wut. Das „Wut“-Symbol wählt das Facebook-Publikum der AfD am häufigsten als Reaktion auf die Beiträge der Partei. Das liegt auf der Hand: Egal ob beim Thema Islam, Kriminalität oder Europa – die AfD kümmert sich nicht um die Sorgen der Bürger, sondern verstärkt sie. Für die AfD entsteht so eine digitale Aufmerksamkeitsspirale: Wer emotionalisiert und polarisiert, der mobilisiert auch. Schlechte Voraussetzungen für die politische Meinungsbildung – aber gute Voraussetzungen für Rechte Populisten.
Die Soundbites von AfD-Politikern eignen sich obendrein besonders gut für die virale Verbreitung durch die eigenen Anhänger, am besten in Form von Bildern oder Videos. Facebook ist eine Plattform für Redeschnipsel, nicht für abwägende Argumentationen. Wenn Björn Höcke rassistisch über den „afrikanischen Ausbreitungstyp“ sinniert, verbreitet sich das auf Facebook wellenartig. Populisten wie Höcke wissen, wie man mit Ton und Bild Aufmerksamkeit erregt. Ihr Auftreten und ihre Statements, je absurder, desto besser, provozieren Emotionen, egal ob Abscheu oder Zustimmung. Aus diesen Zutaten entstehen die kurzen Clips, die von Tausenden, manchmal Millionen Menschen durch die sozialen Netzwerke katapultiert werden. So wurden Rechtspopulisten zu den Spitzenverdienern der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie.
Bei der Betrachtung der politischen Landschaft auf Facebook drängt sich eine Frage auf: Warum können die anderen Parteien mit der AfD auf Facebook, dem wichtigsten sozialen Netzwerk für die Deutschen, nicht mithalten? Die Parteien haben lange Zeit die sozialen Netzwerke nicht ernst genommen. Vermutlich war es für viele Politiker ein lästiger zusätzlicher Kanal. Wie eine Veranstaltung, auf der man sich sehen lassen muss, aber eigentlich keine Lust auf die Gäste hat. Im Jahr 2011 nutzten nur acht Prozent der Bundestagsabgeordneten aktiv die sozialen Medien zur Kommunikation mit Bürgern.
Eine eigene Ansprache finden sie auch heute oft nicht. Sie benutzen Facebook wie ein Faxgerät zum Zustellen von Meldungen. Feedback, der Clou von Facebook, den die AfD intensiv nutzt, gibt es kaum. Das lang anhaltende Desinteresse der etablierten Parteien hat auch strukturelle Gründe. Die in Parlamenten sitzenden Parteien haben einen institutionell verankerten Zugang zur Öffentlichkeit. Journalisten und Politiker halten sich berufsbedingt ständig am selben Ort auf, kennen sich mitunter schon jahrelang. Warum sollte ein Politiker etwas auf Facebook posten, wenn ihm auf dem Weg aus dem Sitzungssaal die Mikrofone und Kameras nur so zufliegen? Die AfD machte das von Anfang an anders. Sie erschloss sich die sozialen Medien, den längst etablierten Raum der menschlichen Kommunikation, der von anderen politischen Kräften rechts liegen gelassen wurden. Was für andere Parteien lange Neuland blieb, ist für die AfD rasch zur Heimat geworden.
Ihr digitales Volk, das sie dort beheimatet, zeichnet sich weniger durch die sogenannte Filterblase aus, die der Algorithmus angeblich erzeuge. In erster Linie existiert die Blase, also der Fokus auf einer bestimmten Meinung, in unserem eigenen Kopf. Der Algorithmus von Facebook verstärkt den Effekt allerdings erheblich, indem er ihn automatisiert und kollektiviert. Der Konsum von Informationen wird auf Facebook zum sozialen Happening. Selbst wenn mein Nachrichtenmenü auf Facebook einigermaßen ausgewogen ist, werde ich mich in meinem Weltbild nicht so schnell erschüttern lassen, wenn ich für die Ablehnung unbequemer Positionen permanent Bestätigung durch mein Umfeld erfahre.
Hass schafft Gemeinschaft
In Facebook-Gruppen mit 23.000 „AfD-Sympathisanten“, die pausenlos die Nachrichten der Tagesschau als Fake News brandmarken, für gemeinsame Feindbilder eine Sprache wie „rot-grün versifft“ oder „Kanzlerdiktatorin“ pflegen, entsteht ein Gefühl der Stärke und der Gemeinschaft – die anderen sind Fake News, wir sind True News. Diese Potenziale nutzt die AfD. Die Partei hat aus einer zerstreuten Menge von politisch Unzufriedenen eine vernetzte Gemeinschaft gemacht. Das ist das „Digivolk“ der AfD.
Die AfD verlässt sich aber nicht allein auf diese große, halb künstlich, halb sozial erzeugte öffentliche Bestätigungskammer. Viele AfD-Spitzenpolitiker haben sich auch eigene Meinungsmedien geschaffen. Frauke Petry etwa verantwortet den Blauen Kanal. „In diesem alternativen Medium findet der Leser Zeitgeiststörungen aller Art (…) und wahrscheinlich kein einziges Gendersternchen“, so die Selbstbeschreibung. Petrys Mann, Marcus Pretzell, darf hier erläutern, warum „freie Bürger ein Recht auf freie Waffen“ hätten. Zugleich ist die Seite Bindeglied in das parteiunabhängige Medienuniversum der Neuen Rechten. So erschien auf dem Blauen Kanal im Mai 2017 ein mehrteiliges Interview mit Felix Menzel, Herausgeber des Magazins Blaue Narzisse, das rechtes Gedankengut für junge Menschen aufbereitet.
Das Ziel: Eine rechte Kulturrevolution.
Zum neurechten Mediensystem gehört auch die Wochenzeitung Junge Freiheit. Die Sezession, Zeitschrift und Online-Blog der rechten Denkfabrik „Institut für Staatspolitik“, rühmt sich damit, Vordenker der AfD und „anderer Widerstandsprojekte“ zu sein. Martin Sellner, der Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, sieht auch Blogs wie den von Roland Tichy (Tichy’s Einblick) als Einfallstore neurechten Denkens. Es finde „ein reger Ideenschmuggel ins Zentrum der Meinungsmacht statt“, meint Sellner.
Götz Kubitschek, Herausgeber der Sezession, sieht die Funktion der rechten Alternativmedien darin, „Metapolitik“ zu machen. Über die Veränderung von Kommunikationsmustern im vorpolitischen Raum soll ein kultureller Wandel eintreten, der völkischen Nationalismus und ethnische Homogenität zur Norm macht. AfD-Politiker wie Björn Höcke oder André Poggenburg sind politische Agenten einer rechten Revolution.
Im AfD-Internet sind die Verbindungen zwischen Partei und neurechter Bewegung klar zu sehen. Und sie werden aus strategischen Gründen weit in eher bürgerlich-konservative Kreise gezogen, die mit rechtsextremer Ideologie wenig am Hut haben. So gehen die Verbindungen des digitalen AfD-Netzwerks bis in Facebook-Gruppen von „Bürgerwehren“ hinein, die sich in den letzten Jahren gründeten und mitunter ebenfalls Vernetzungsgruppen mit bis zu 20.000 Mitgliedern aufgebaut haben“.
In den parteigebundenen Alternativmedien und den sozialen Medien hat sich eine neue Wählerklientel gebildet, das digitale Volk. Es wird getrieben durch die Logik des Netzes – und seine Einflüsterer.
Als solchen hatte die AfD nun für den Schlussspurt des letzten Bundestagswahlkampfs die US-amerikanische Digitalagentur Harris Media angeheuert – früher für Trump und UKIP tätig – das, das muss sein dürfen.
 Als nun aber einer der geistigen Brandstifter jenes in Halle – nur mal eben zum Beispiel – verübten neunfachen Mordes an ausländischen Mitbürgern verübt hat, sollte dieser braun-kasperale Widerwärtling samt Brut als geistiger Verführer eines wahrscheinlich geistig krank gemachten Menschen bestraft werden können. Aber, wir leben halt noch in einem Rechtsstaat. Schade. Für diesmal …
Als nun aber einer der geistigen Brandstifter jenes in Halle – nur mal eben zum Beispiel – verübten neunfachen Mordes an ausländischen Mitbürgern verübt hat, sollte dieser braun-kasperale Widerwärtling samt Brut als geistiger Verführer eines wahrscheinlich geistig krank gemachten Menschen bestraft werden können. Aber, wir leben halt noch in einem Rechtsstaat. Schade. Für diesmal …
Wehret den Anfängen? Sie wären doch schon lange wieder.
Heil Höcke?
Gott mit uns!
