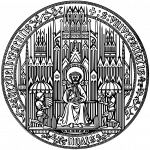Am Ufer der Wolga lebt Katja im Hause ihrer Schwiegermutter, der Witwe Kabanicha. Die Witwe sendet ihren Sohn Tichon, den Mann Katjas, auf eine zweiwöchige Reise, um einen Keil zwischen die beiden Liebenden zu treiben. Der Sohn folgt der Forderung der Mutter und lässt die verzweifelte Katja trotz ihres Flehens allein (Foto Plakatmotiv: Ludwig Olah). Während seiner Abwesenheit drangsaliert Kabanicha die junge Katja. In ihrer Verzweiflung trifft sie heimlich Boris, der ähnliches mit seinem Onkel erlebt, wie es Katja mit der Witwe durchstehen muss. Zwei einsame Seelen begegnen einander. Katja verliert sich selbst und ihre moralischen Ansprüche unter dem Druck der Tyrannei ihrer herrschsüchtigen Schwiegermutter. (mehr …)
Am Ufer der Wolga lebt Katja im Hause ihrer Schwiegermutter, der Witwe Kabanicha. Die Witwe sendet ihren Sohn Tichon, den Mann Katjas, auf eine zweiwöchige Reise, um einen Keil zwischen die beiden Liebenden zu treiben. Der Sohn folgt der Forderung der Mutter und lässt die verzweifelte Katja trotz ihres Flehens allein (Foto Plakatmotiv: Ludwig Olah). Während seiner Abwesenheit drangsaliert Kabanicha die junge Katja. In ihrer Verzweiflung trifft sie heimlich Boris, der ähnliches mit seinem Onkel erlebt, wie es Katja mit der Witwe durchstehen muss. Zwei einsame Seelen begegnen einander. Katja verliert sich selbst und ihre moralischen Ansprüche unter dem Druck der Tyrannei ihrer herrschsüchtigen Schwiegermutter. (mehr …)
 In Heidelberg finden zwei Wahlen statt:
In Heidelberg finden zwei Wahlen statt:
Die Kommunal- und die Europawahl.
Europawahl
Bei der Europawahl 2019 entscheiden die wahlberechtigten Bürger in der Europäischen Union (EU), welche Abgeordneten in den kommenden fünf Jahren im Europäischen Parlament sitzen. Das Europäische Parlament hat seinen Sitz in Straßburg. Zusätzliche Plenartagungen und Treffen der Ausschüsse des Parlaments finden in Brüssel statt. (mehr …)
Hire and fire ist das Prinzip bedrängter Unternehmen, nicht der Kirche. Oder?
Vor dem Hintergrund eines globalen Verdrängungswettbewerbs entdecken auffallend viele nachdenkliche Menschen die ethischen Vorzüge des Christentums: Peter Sloterdijk prophezeit ein grausames 21. Jahrhundert. Mit Nietzsche nennt er es neo-antik, weil nun endgültig „die Wiederholung der Antike auf der Höhe der Modernität“ anstehe. Künftig, so Sloterdijk, werde ein innerweltlicher Fatalismus herrschen: Im Hier und Jetzt, am meßbaren Erfolg entscheidet sich, ob ein Leben gelingt. Die Möglichkeit eines „Rückspiels“ im Jenseits, wie es bisher vom „Balkon am Petersplatz“ (Bild Rom) aus versprochen wurde, habe keine Relevanz mehr. Das „Mitleid mit den Verlierern“, das durch das Christentum in die Welt kam, sei nicht mehr gefragt. (mehr …)
 Verwöhnt, konfliktscheu, opportunistisch und als Führungskräfte unbrauchbar: Das sind die Vorurteile über die derzeit Jungen. Das ist unfair, findet der Soziologe Klaus Hurrelmann. „Lebst du noch oder arbeitest du schon?“ In der derzeit jungen Generation verschwimmen die Grenzen zwischen Beruf und Freizeit immer mehr. Der vollständige Text:
Verwöhnt, konfliktscheu, opportunistisch und als Führungskräfte unbrauchbar: Das sind die Vorurteile über die derzeit Jungen. Das ist unfair, findet der Soziologe Klaus Hurrelmann. „Lebst du noch oder arbeitest du schon?“ In der derzeit jungen Generation verschwimmen die Grenzen zwischen Beruf und Freizeit immer mehr. Der vollständige Text:
Die Privathaftpflicht gilt als eine der wichtigsten Versicherungen, die jeder haben sollte. Doch ihre Tarife unterscheiden sich zum Teil deutlich.
 Aber leider ist es ein Bush: Dem Pontifex bedeutet „Versöhnung“ mit vier Erzreaktionären mehr als das Vertrauen der Katholiken.
Aber leider ist es ein Bush: Dem Pontifex bedeutet „Versöhnung“ mit vier Erzreaktionären mehr als das Vertrauen der Katholiken.
Eine Rundschau-Außenansicht von Hans Küng, 80, ist emeritierter Professor für ökumenische Theologie in Uni Tübingen und Präsident der Stiftung Weltethos. 1980 ließ der Vatikan ihm die kirchliche Lehrerlaubnis entziehen.
Präsident Barack Obama ist es gelungen, in kurzer Zeit die Vereinigten Staaten aus Stimmungstief und Reformstau herauszuführen, eine glaubhafte Hoffnungsvision vorzustellen und eine strategische Wende in der Innen- wie Außenpolitik dieses großen Landes einzuleiten.

„Wenn das der Führer gewusst hätte …“ Bild: Bischof Williamson im Fernsehen: „Es gab keine Gaskammern. Maximal gab es 200 bis 300 000 Tote in den Konzentrationslagern“.
Anders in der katholischen Kirche. Die Stimmung ist bedrückend, der Reformstau lähmend. Nach fast vier Jahren im Amt sehen viele Papst Benedikt XVI. auf der Linie eines George W. Bush. Kein Zufall, dass der Papst seinen 81. Geburtstag im vergangenen Jahr im Weißen Haus gefeiert hat. Beide, Bush und Ratzinger, sind lernunfähig in Fragen von Geburtenkontrolle und Abtreibung, abgeneigt allen ernsthaften Reformen, selbstherrlich und ohne Transparenz in ihrer Amtsführung, die Freiheiten und Rechte der Menschen einschränkend.
Keine Erwartungen mehr
Wie Bush seinerzeit, so leidet auch Papst Benedikt unter einem wachsenden Vertrauensverlust. Viele Katholiken erwarten von ihm nichts mehr. Schlimmer noch: Durch die Rücknahme der Exkommunikation von vier illegal geweihten traditionalistischen Bischöfen, darunter ein notorischer Holocaust-Leugner, wurden alle bei der Wahl Ratzingers zum Papst geäußerten Befürchtungen bestätigt.
Der Papst wertet Leute auf, die nach wie vor die vom Zweiten Vatikanischen Konzil bejahte Religionsfreiheit, den Dialog mit den anderen Kirchen, die Aussöhnung mit dem Judentum, die Hochschätzung des Islam und der anderen Weltreligionen sowie die Reform der Liturgie ablehnen.
Um die „Versöhnung“ mit einem Häuflein erzreaktionärer Traditionalisten voranzubringen, riskiert dieser Papst den Vertrauensverlust von Millionen von Katholiken in allen Ländern, die dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Treue halten. Dass gerade einem deutschen Papst solche Fehltritte unterlaufen, verschärft die Konflikte. Nachträgliche Entschuldigungen können das zerschlagene Porzellan nicht kitten.
Dabei hätte es ein Papst noch leichter als ein Präsident der Vereinigten Staaten, eine Kursänderung vorzunehmen. Er hat keinen Kongress als Legislative neben sich und kein Oberstes Gericht als Judikative über sich. Er ist uneingeschränkter Regierungschef, Gesetzgeber und höchster Richter in der Kirche. Er könnte, wenn er wollte, über Nacht die Empfängnisverhütung gestatten, die Priesterehe zulassen, die Frauenordination ermöglichen und die Abendmahlsgemeinschaft mit den evangelischen Kirchen erlauben.
Was würde ein Papst tun, der im Geist Obamas handelte? Er würde ähnlich wie Obama erstens deutlich aussprechen, dass die römisch-katholische Kirche sich in einer tiefen Krise befindet und würde die Krisenherde benennen: viele Gemeinden ohne Priester, ausbleibender Nachwuchs für das Priestertum, durch unpopuläre Pfarreifusionen verschleierter Zusammenbruch seelsorgerlicher Strukturen, die oft über Jahrhunderte gewachsen waren.
Er würde zweitens die Hoffnungsvision von einer erneuerten Kirche, einer revitalisierten Ökumene, einer Verständigung mit den Juden, den Muslimen und den anderen Weltreligionen und einer positiven Wertung der modernen Wissenschaft verkünden. Er würde drittensdie fähigsten Mitarbeiter um sich versammeln, keine Jasager, sondern eigenständige Persönlichkeiten, unterstützt von kompetenten und furchtlosen Experten. Er würde viertens die dringendsten Reformmaßnahmen durch Dekret („executive orders“) sofort initiieren und fünftens ein ökumenisches Konzil zur Beförderung des Kurswechsels einberufen.
Doch welch deprimierender Kontrast
Während Präsident Obama unter Zustimmung aus der ganzen Welt nach vorne blickt und sich den Menschen und der Zukunft öffnet, orientiert sich dieser Papst vor allem nach rückwärts, inspiriert vom Ideal der mittelalterlichen Kirche, skeptisch gegenüber der Reformation, zwiespältig gegenüber den Freiheitsrechten der Moderne.
Während Präsident Obama sich kooperativ neu um Partner und Bundesgenossen bemüht, ist Papst Benedikt wie George W. Bush im Freund-Feind-Denken befangen. Mitchristen in den evangelischen Kirchen stößt er vor den Kopf, indem er diese Gemeinschaften nicht als Kirchen anerkennt. Der Dialog mit Muslimen ist über Lippenbekenntnisse zum „Dialog“ nicht hinausgekommen.
Das Verhältnis zum Judentum muss als tief gestört bezeichnet werden. Während Präsident Obama Hoffnung ausstrahlt, Bürgeraktivitäten fördert und eine „neue Ära der Verantwortlichkeit“ fordert, ist Papst Benedikt in Angstvorstellungen befangen und will die Freiheit der Menschen möglichst einschränken, um eine „Ära der Restauration“ durchzusetzen.
Keine Scheu vor der Zukunft
Während Präsident Obama in Washington offensiv die Verfassung und die große Tradition seines Landes zur Begründung kühner Reformschritte heranzieht, legt Papst Benedikt in Rom die Dekrete des Reformkonzils von 1962 bis 1965 restriktiv nach rückwärts aus: in Richtung auf das Restaurationskonzil von 1870.
Aber weil Papst Benedikt XVI. aller Wahrscheinlichkeit nach selber kein Obama wird, brauchen wir für die nächste Zeit erstens einen Episkopat, der die offenkundigen Probleme der Kirche nicht verschleiert, sondern offen benennt und auf Diözesanebene energisch angeht; zweitens Theologen, die aktiv an einer Zukunftsvision unserer Kirche mitarbeiten und keine Scheu haben, die Wahrheit zu sagen und zu schreiben; drittens Seelsorger, die sich wehren gegen die ständige Überbelastung durch Zusammenlegung von mehreren Pfarreien, und die ihre Eigenverantwortung als Seelsorger mutig wahrnehmen; viertens insbesondere Frauen, ohne die vielerorts die Seelsorge zusammenbrechen würde, die ihre Möglichkeiten des Einflusses selbstbewusst wahrnehmen.
Aber können wir das wirklich? Ja, wir können!
Hans Küng, 80, ist emeritierter Professor für ökumenische Theologie in Uni Tübingen und Präsident der Stiftung Weltethos. 1980 ließ der Vatikan ihm die kirchliche Lehrerlaubnis entziehen.
 Praxiteles war einer der größten Künstler der Antike. Der Louvre feiert ihn – mit Kopien – wobei der Louvre keine andere Wahl hatte: Praxiteles ist zwar ein Gipfel der antiken Kunstgeschichte, aber die meisten seiner Werke sind verschollen. Oft genug wurden sie von frühen Christen zerstört, die an der „heidnischen Sinneslust“ Anstoß nahmen. Der 1877 von deutschen Archäologen ausgegrabene (Bild – Gottschling) Hermes im Museum von Olympia, der den jungen Dioysos trägt, gilt als eines der wenigen gesicherten Originale.
Praxiteles war einer der größten Künstler der Antike. Der Louvre feiert ihn – mit Kopien – wobei der Louvre keine andere Wahl hatte: Praxiteles ist zwar ein Gipfel der antiken Kunstgeschichte, aber die meisten seiner Werke sind verschollen. Oft genug wurden sie von frühen Christen zerstört, die an der „heidnischen Sinneslust“ Anstoß nahmen. Der 1877 von deutschen Archäologen ausgegrabene (Bild – Gottschling) Hermes im Museum von Olympia, der den jungen Dioysos trägt, gilt als eines der wenigen gesicherten Originale.
Den größten Skandal erregte die Venus von Knidos, die älteste lebensgroße weibliche Skulptur, die sich so präsentiert, wie die Natur sie schuf. Die Stadtväter von Kos auf der gleichnamigen Insel, die die Liebesgöttin bestellt hatten, waren entsetzt, als der Künstler eine nackte Dame ablieferte. Um sie zu beschwichtigen, schuf er eine zweite, bekleidete Fassung – wie es Goya später mit seiner Maja tat. Das nackte Original wurde von der Stadt Knidos erworben, wo es Scharen von Touristen anzog. Nicht wenige Besucher wurden, wenn wir der Überlieferung glauben wollen, bei ihrem Anblick von einem wahren Sinnenrausch überwältigt. Der König von Bithynien erbot sich, alle Schulden der Stadt zu begleichen, wenn sie ihm die Statue ablasse.
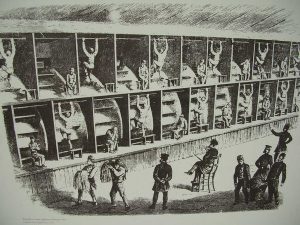 Philosophieren, sagt Cicero, sei nichts anderes, als sich auf den Tod vorbereiten. Studieren und Nachdenken also ziehen unsere Seele von uns selber ab und weisen ihr eine unkörperliche Aufgabe zu, die eine Vorbereitung auf den Tod ist und Ähnlichkeit mit ihm hat; oder es heißt auch, dass alle Weisheiten und alles Reden dieser Welt darauf hinauslaufen, uns zu lehren, den Tod nicht zu fürchten.
Philosophieren, sagt Cicero, sei nichts anderes, als sich auf den Tod vorbereiten. Studieren und Nachdenken also ziehen unsere Seele von uns selber ab und weisen ihr eine unkörperliche Aufgabe zu, die eine Vorbereitung auf den Tod ist und Ähnlichkeit mit ihm hat; oder es heißt auch, dass alle Weisheiten und alles Reden dieser Welt darauf hinauslaufen, uns zu lehren, den Tod nicht zu fürchten.
In der Tat, wenn die Vernunft uns nicht zum Narren hält, dann jedenfalls sollte sie sich doch ausschließlich auf unsere Zufriedenheit richten dürfen – ja müssen – und ihre Anstrengungen sollten zum Ziel haben, uns ein gutes und angenehmes Leben zu verschaffen, wie es jedenfalls die „Heilige Schrift“ sagt.
Alles Reden dieser Welt stimmt doch darin überein, „dass das Lebens ein Ziel hat“ welches (für manche) ein angenehmes solches sei, auch wenn die Philosophen verschiedene Wege dorthin vorschlagen.