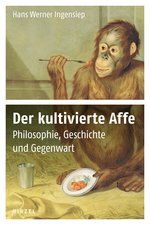Was ist der Mensch? Eine Antwort auf diese Frage versuchen Wissenschaftler auch dadurch zu finden, dass sie die Unterschiede zu seinen nächsten Verwandten ergründen. Seit der Entdeckung der Menschenaffen interessieren sich daher nicht nur Zoologen für diese Tiere, sondern ebenso Psychologen und Philosophen. Dieses Buch befasst sich mit der Entwicklung des Bildes, das sich die Europäer im Lauf der Jahrhunderte von den Menschenaffen gemacht haben. Dabei wird deutlich, dass sich unser Verhältnis zu den Tieren grundlegend geändert hat – aber dass sich durch die Forschung ebenso unser Selbstbild gewandelt hat.
Was ist der Mensch? Eine Antwort auf diese Frage versuchen Wissenschaftler auch dadurch zu finden, dass sie die Unterschiede zu seinen nächsten Verwandten ergründen. Seit der Entdeckung der Menschenaffen interessieren sich daher nicht nur Zoologen für diese Tiere, sondern ebenso Psychologen und Philosophen. Dieses Buch befasst sich mit der Entwicklung des Bildes, das sich die Europäer im Lauf der Jahrhunderte von den Menschenaffen gemacht haben. Dabei wird deutlich, dass sich unser Verhältnis zu den Tieren grundlegend geändert hat – aber dass sich durch die Forschung ebenso unser Selbstbild gewandelt hat.
Anti-Descartes
Mit seinem 2013 erschienenen Buch „Der kultivierte Affe. Philosophie, Geschichte und Gegenwart“ arbeitet Ingensiep das Bild des Menschenaffen, wie es sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat, sehr aufschlussreich und vor allem sehr unterhaltsam auf. Denn egal ob als zähnefletschende Bestie, edler Wilder, menschliche Parodie
Genetisch unterscheiden sich Menschenaffen kaum von uns. Stehen unseren nächsten Verwandten daher nicht auch Menschenrechte zu?
Menschen und Schimpansen unterscheiden sich nur in ungefähr einem Prozent ihrer genetischen Ausstattung voneinander. Biologisch betrachtet sind sie näher miteinander verwandt als Pferde und Esel. Und doch trennen wir Menschen uns selbst von den Menschenaffen als „Menschen“ und „Tiere“. Ist diese alte Trennung heute noch zeitgemäß, wenn sie biologisch offensichtlich falsch ist?
Menschenrechte für Menschenaffen?
Unsere Beziehung zu unseren nächsten Verwandten, den Affen, ist gekennzeichnet durch viele Widersprüche: Wir finden sie niedlich und drollig, aber auch garstig und abscheulich. Im 19. Jahrhundert fragte sich Darwins Gegenspieler, der Bischof Samuel Wilberforce nach einem Besuch im Londoner Zoo, wie Gott etwas so Widerwärtiges wie die Affen erschaffen konnte. Den Mayas galten Affen als der letzte verpfuschte Versuch Gottes, bis es ihm gelang den Menschen zu erschaffen. Und die Ureinwohner Borneos glaubten, dass Orang-Utans Menschen seien, die nur deshalb schweigen würden, weil sie zu faul zum Arbeiten wären. Seit Charles Darwin wissen wir, dass wir tatsächlich mit den Affen verwandt sind und uns aus gemeinsamen Vorfahren entwickelt haben.
Tierrechtler wie der australische Philosoph Peter Singer fordern seit 20 Jahren sogar „Menschenrechte“ für die Großen Menschenaffen Schimpanse, Bonobo, Gorilla und Orang-Utan. Gemeint sind das Recht auf Leben, der Schutz der individuellen Freiheit und das Verbot der Folter. Doch was bedeutet es konkret, Menschenaffen „Rechte“ einzuräumen? Dürfen wir sie dann noch in Zoos halten? Fallen sie damit nicht mehr unter die Bestimmungen des Artenschutzes, sondern unter die Menschrechts-Deklaration der UNO? Neben solchen praktischen Erwägungen berührt der Gedanke, Menschenrechte für Menschenaffen einzuräumen, die Grundfesten unseres Selbstverständnisses in der Welt. Wie und als was sehen wir uns im Verhältnis zu unseren nicht-menschlichen oder doch sehr menschlichen Verwandten?
Ingensiep vermittelt einen gelungenen Einblick in die wechselnden Sichtweisen auf den Homo sapiens und seine tierischen Verwandten.
Der Autor
 Hans Werner Ingensiep, geboren 1953, ist Professor für Philosophie und Wissenschaftsgeschichte an der Uni Duisburg-Essen. Er studiert in den 1970er Jahren zunächst mit den Schwerpunkten Geschichte und Physik, dann ab 1973 wechselt er zur Philosophie und zur Biologie. Er promoviert 1983 in Biologie und habilitiert 1995 im Fachbereich Philosophie der Universität GHS Essen mit dem Thema „Pflanzenseele, Tierseele und Naturverständnis“. Sein thematischer Schwerpunkt liegt auch in den folgenden Jahren in der kulturgeschichtlichen Bewertung unseres Verständnisses von Natur im Allgemeinen und den Menschenaffen im Besonderen.
Hans Werner Ingensiep, geboren 1953, ist Professor für Philosophie und Wissenschaftsgeschichte an der Uni Duisburg-Essen. Er studiert in den 1970er Jahren zunächst mit den Schwerpunkten Geschichte und Physik, dann ab 1973 wechselt er zur Philosophie und zur Biologie. Er promoviert 1983 in Biologie und habilitiert 1995 im Fachbereich Philosophie der Universität GHS Essen mit dem Thema „Pflanzenseele, Tierseele und Naturverständnis“. Sein thematischer Schwerpunkt liegt auch in den folgenden Jahren in der kulturgeschichtlichen Bewertung unseres Verständnisses von Natur im Allgemeinen und den Menschenaffen im Besonderen.
Es folgen Gastprofessuren in Frankfurt und Lübeck sowie Forschungsaufenthalte im Hastings Center Bioethik in New York und an der Georgetown University in Washington. 2008 veröffentlicht Ingensiep zusammen mit der Theologin Heike Baranzke „Das Tier“, eine historische Aufarbeitung zur Frage der Gleichheit zwischen Mensch und Tier, in der die bisherigen Debatten übersichtlich zusammengetragen werden. Es folgt die Herausgabe mehrerer Anthologien etwa zum Thema Ernährungsethik, zu Charles Darwin und anderen Aspekten der Kulturgeschichte der Natur.
Gebunden
ISBN 978-3-7776-2149-4
S. Hirzel Verlag