Selbstgefällige Ignoranz – Die Katalonien-Krise geht Europa mehr an, als es der EU-Zentrale lieb ist
 Brüssel müsste reagieren, statt zu negieren – Madrid hat die nächste Eskalationsstufe gezündet und will die katalanische Regionalexekutive zu Fall bringen. Alle Erwartungen, die Europäische Union werde in mäßigender und vermittelnder Weise eingreifen, haben sich endgültig als Trugschluss erwiesen.
Brüssel müsste reagieren, statt zu negieren – Madrid hat die nächste Eskalationsstufe gezündet und will die katalanische Regionalexekutive zu Fall bringen. Alle Erwartungen, die Europäische Union werde in mäßigender und vermittelnder Weise eingreifen, haben sich endgültig als Trugschluss erwiesen.
Es ist ein Zeichen der außenpolitischen Schwäche Europas, wenn eine Mediation nicht nur unterbleibt, sondern demonstrativ vermieden wird. Haben wir es hier mit einem Ausbund an Opportunismus zu tun? Oder doch eher mit der logischen Konsequenz aus der Beschaffenheit einer Union, die zuallererst eine Assoziation von Staaten und Regierungen ist – nicht von Nationen, Regionen und Bürgern. Das heißt, der Wunsch nach Selbstbestimmung – ob von Katalanen, Schotten, Flamen, Lombarden oder Korsen – stellt notgedrungen die Machtverhältnisse in der EU, vor allem deren starre Machtarchitektur in Frage. Deshalb wird nicht reagiert, sondern negiert.
Maß aller Dinge
 Die EU, wie sie derzeit existiert, lässt sich nur erhalten, wenn Administrationen wie die des konservativen spanischen Premiers Rajoy das Maß aller Dinge sind. In Madrid und in Brüssel. Allein die politische Ökonomie des Euro, die Sparauflagen und das Schuldenregime, sind nur mit Partnern wie Rajoy aufrechtzuerhalten. Weil das so ist, hat die Legitimität der von ihm verkörperten politischen Klasse ebenso gelitten wie das Vertrauen in die von ihr geführten Staaten.
Die EU, wie sie derzeit existiert, lässt sich nur erhalten, wenn Administrationen wie die des konservativen spanischen Premiers Rajoy das Maß aller Dinge sind. In Madrid und in Brüssel. Allein die politische Ökonomie des Euro, die Sparauflagen und das Schuldenregime, sind nur mit Partnern wie Rajoy aufrechtzuerhalten. Weil das so ist, hat die Legitimität der von ihm verkörperten politischen Klasse ebenso gelitten wie das Vertrauen in die von ihr geführten Staaten.
Finanzkrise, Flüchtlingsströme, Brexit, autoritäre Regime in der EU und ihren Grenzen, dazu ein US-Präsident, der weltweit für tiefe Verunsicherung sorgt – Europa und Amerika haben mit so vielen Herausforderungen gleichzeitig zu kämpfen, dass Endzeitstimmung aufkommt.
Dies ist nicht zuletzt der Tatsache zu entnehmen, dass 2016 in Spanien zweimal gewählt wurde, ohne dass Rajoys Partido Popular (PP) ein eindeutiges Mandat erhielt, um im Schulterschluss mit den Euro-Krisenmanagern weiter so regieren zu können wie nach Ausbruch der für Spanien äußerst schmerzlichen Finanzkrise im Jahr 2008. Insofern ist der Wunsch nach einer Unabhängigkeit Kataloniens auch ein Indikator für die Suche nach Alternativen zum politischen Status quo, dessen Daseinsberechtigung in Frage steht. Vielleicht ist das sogar der entscheidende Grund für die Parteilichkeit, mit der sich Brüsseler Gremien wie die EU-Kommission vorbehaltlos hinter Madrid und dessen Drang zur drakonischen Disziplinierung der katalanischen Regionalregierung stellen.
Selbst- gegen Fremdbestimmung
Mit anderen Worten: Bürger in Europa, die regionale als ihre Interessen geltend machen und mehr Souveränität verlangen, werden nicht nur vom spanischen Staat in repressiver Weise in Schach gehalten. Ihnen widerfährt Gleiches durch die EU-Zentrale, die sie als Outlaws stigmatisiert (was von einem Großteil deutscher Medien gern übernommen wird), weil sie Selbst- gegen Fremdbestimmung setzen. Und das, obwohl sich die sezessionswilligen Katalanen keineswegs als Anti-Europäer gebärden oder gar als EU-Verächter. Ganz anders als viele der regierenden britischen Konservativen, mit denen die EU-Kommission momentan intensiv verhandelt und trotz gegensätzlicher Positionen einen gewissen Respekt nicht verweigert.
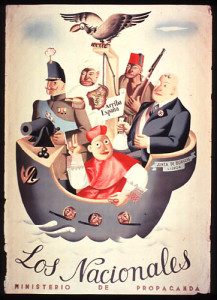 Brüssel hat sich auf die formale Position zurückgezogen, es handle sich mit der Katalonien-Krise um einen internen Konflikt, es gelte daher ein Nichteinmischungsgebot. Natürlich gäbe es genügend Gesprächskanäle – interne und offizielle –, um auf einen Kompromiss hinzuwirken, der die katalanischen Autoritäten weder demütigt noch bestraft. Stattdessen billigt die Brüsseler Zentrale, dass Mariano Rajoys Umgang mit diesem Konflikt der spanischen Gesellschaft vor allem eines bedeutet: eine Verständigung ist unerwünscht. Wenn die EU dies anstandslos hinnimmt, ist das für Europa verheerend, wenn nicht selbstzerstörerisch.
Brüssel hat sich auf die formale Position zurückgezogen, es handle sich mit der Katalonien-Krise um einen internen Konflikt, es gelte daher ein Nichteinmischungsgebot. Natürlich gäbe es genügend Gesprächskanäle – interne und offizielle –, um auf einen Kompromiss hinzuwirken, der die katalanischen Autoritäten weder demütigt noch bestraft. Stattdessen billigt die Brüsseler Zentrale, dass Mariano Rajoys Umgang mit diesem Konflikt der spanischen Gesellschaft vor allem eines bedeutet: eine Verständigung ist unerwünscht. Wenn die EU dies anstandslos hinnimmt, ist das für Europa verheerend, wenn nicht selbstzerstörerisch.
Es muss dann gefragt werden dürfen: Was ist der ständig beschworene Wille zur Demokratisierung eigentlich wert, wenn das die Akzeptanz des autoritären Gebarens in Madrid einschließt? Wie soll unter diesen Umständen verloren gegangene Legitimation zurückgewonnen werden. Und mit welchen Recht werden EU-Regierungen in Osteuropa gemaßregelt, während sich andere austoben dürfen?
Die EU hält sich vieles zugute.
Sie unterhält einen Einheitsmarkt und eine Zollunion, hat die Binnengrenzen weitgehend abgeschafft, verfügt über 19 Mitgliedsstaaten mit einer Gemeinschaftswährung und eine Zentralbank, wähnte sich mit der 2005 gescheiterten EU-Verfassung schon auf der Schwelle zu den Vereinigten Staaten Europas, versuchte sich mit wechselndem Erfolg an einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und sieht sich als Interventionsmacht, damit es an globaler Aura nicht fehlt. Ex-Kolonialmächte wie Frankreich, Spanien und – noch – Großbritannien kommen ohne den imperialen Gestus so wenig aus wie Deutschland ohne den Nachweis weltpolitischer Geltungsmacht.
Und dann erweist sich dieser monströse europäische Überbau als unfähig und unwillig, dem Wunsch nach Selbstbestimmung der Katalanen wengistens soweit gerecht zu werden, dass man sich dafür zuständig fühlt?
Was ist daran so schwer, wenn die Akteure in Madrid und Barcelona – Rajoy und Puigdemont – versichern, sie seien überzeugte Europäer.
Vom Einsturz bedroht
Es keine europäische Frage, wenn sich ein im 17. Jahrhundert entstandenes Nationalstaatsmodell als überholt erweist und von vielen Bürgern auf diesem Kontinent verworfen wird? Die EU sollte nicht nur, sie muss nach Lösungen suchen und kann das nicht den Hardlinern in Madrid überlassen. Schließlich geht es um eine existenzielle Herausforderung.
Staatenbund – aber was für einen?
Die EU der 27 kann nur deshalb ein Staatenbund sein, weil sie sich auf Nationalstaaten gründet. Entfällt dieses Fundament, ist das ganze Europäische Haus vom Einsturz bedroht – oder muss zu einer neuen, belastbaren Statik finden.
Wird das nicht zur Kenntnis genommen, gerät ihr gesamtes Vertragsregime ins Wanken. Wer sollte dafür haftbar gemacht werden, wenn nicht die Mitgliedsstaaten? Nur hat eben die Eurokrise deren Handlungsvermögen derart belastet, dass ein merklicher Autoritäts- und Vertrauensverlust die Folge ist.
 Davon musste der Separatismus profitieren, ob er wollte oder nicht. Und dieses politische Naturgesetz wird sich weder durch Repressionen noch Disziplinierung noch Ignoranz aus der Welt schaffen lassen. Wenn sich die EU dem nicht stellt, werden sie nicht nur die Katalanen dazu zwingen.
Davon musste der Separatismus profitieren, ob er wollte oder nicht. Und dieses politische Naturgesetz wird sich weder durch Repressionen noch Disziplinierung noch Ignoranz aus der Welt schaffen lassen. Wenn sich die EU dem nicht stellt, werden sie nicht nur die Katalanen dazu zwingen.

26.Okt..2017, 09:26
Die Philosophen Alexander García Düttmann und Christoph Menke plädieren dafür, den Katalanen zu vertrauen: Es gehe ihnen nicht um den Eigennutz einer reichen Region, die nichts abgeben will. „Es geht um ein gelebtes Verständnis von Demokratie, um eine demokratische Praxis, die letztlich von der Überzeugung zehrt, dass Europa mehr sein kann als der Name einer Politik, die an der Abdankung der Politik und für die neo-liberale Allianz mit dem Kapital arbeitet.“ Auch der Völkerrechtler Bardo Fassbender fordert in der FAZ eine Solidarität der EU mit den sezessionistischen Bestrebungen der Katalanen.