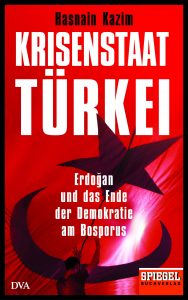 Der „Spiegel“-Korrespondent gilt als exzellenter Kenner der Türkei. Seinen Berichterstatter-Platz musste er auf Druck des Erdogan-Regimes von Istanbul nach Wien verlegen. Das Land aber lässt ihn nicht los.
Der „Spiegel“-Korrespondent gilt als exzellenter Kenner der Türkei. Seinen Berichterstatter-Platz musste er auf Druck des Erdogan-Regimes von Istanbul nach Wien verlegen. Das Land aber lässt ihn nicht los.
Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat kurz nach den Bundestagswahlen gefordert, im Verhältnis zu Deutschland ein neues Kapitel aufzuschlagen. Er wolle die Beziehungen „reparieren“. Man solle – meint Hasnain Kazim dazu, jedes gemäßigte Wort aus Ankara als ein Zeichen der Hoffnung ansehen. Es habe in jüngster Vergangenheit so viele böse Worte aus der Türkei gegeben. Im Gegenzug habe es auch aus Deutschland viel – berechtigte – Kritik an Ankara gegeben. Nun aber seien die Bundestagswahlen vorbei, das Referendum über das Präsidentensystem Mitte April gehöre der Vergangenheit an, beide Länder seien mithin nicht mehr im Wahlkampfmodus. Man solle die Chance nutzen, wieder aufeinander zuzugehen.
Jetzt legt er mit seinem Buch „Krisenstaat Türkei“ eine Analyse vor, die er als exzellenter Kenner der Türkei mit seinen persönlichen Erfahrungen mischt.
Hasnain Kazim im Gespräch:
Vor eineinhalb Jahren haben Sie notgedrungen Ihre Korrespondententätigkeit in Istanbul beendet. Würden Sie davon abraten, jetzt für eine Recherche, vielleicht sogar nur für einen Reisebericht, in die Türkei zu fahren.
Nein. Natürlich kann man weiterhin in die Türkei reisen, egal, ob aus touristischen oder beruflichen Gründen. Sie müssen sich vorher nur fragen, ob Sie schon mal etwas Kritisches über Erdogan, die türkische Regierung oder sonst ein Thema, das in der Türkei als heikel gilt, wie der Völkermord an den Armeniern oder der Umgang des Staates mit den Kurden, geschrieben haben.
Und wenn ja?
Dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man Sie erst gar nicht einreisen lässt oder dass man Sie festnimmt. Dieses Risiko ist zwar, gemessen an der gesamten Zahl aller Menschen, die in die Türkei reisen, gering. Aber es ist in den vergangenen Monaten und Jahren deutlich gewachsen. In Deutschland und anderswo wird gespitzelt, werden Listen angefertigt mit Namen von Leuten, die als türkeifeindlich gelten, und das wird dann weitergemeldet. Die Vorwürfe sind aber in den meisten Fällen absurd.
In Ihrer Danksagung nennen Sie keine Namen, um diese Menschen nicht zu gefährden. Hat die deutsche Politik diese Dramatik schon verstanden?
Ich glaube schon. Im Sommer 2017 hat die Bundesregierung die Reisehinweise verschärft, und das halte ich für richtig. Die deutsche Politik wird ja wohl wahrnehmen, dass in der Türkei ein kritischer Tweet reicht, um angeklagt zu werden. Sie wird hoffentlich all die Berichte zur Kenntnis nehmen über die Tausende von Menschen, die völlig haltlos der Terrorunterstützung bezichtigt werden und ihre Jobs verlieren. Und sie nimmt natürlich wahr, dass auch deutsche Staatsbürger grundlos im Gefängnis sitzen. Insofern bin ich mir sicher, dass die deutsche Politik die Dramatik versteht.
Zieht sie die richtigen Schlussfolgerungen daraus?
Das frage ich mich auch. Und da glaube ich, sie hat sich mit dem Flüchtlingsabkommen zu sehr in eine Abhängigkeit begeben und kann daher nicht konsequent handeln.
Zwar – schreiben Sie – sei knapp die Hälfte der Türken gegen Erdogan. Aber – und das schreiben Sie auch – viele Oppositionelle seien nicht besser; sie huldigten Faschisten, andere der Terrororganisation PKK. Gibt es also überhaupt keine Hoffnung für das Land?
Die Hoffnung sollte man nie aufgeben. Klar gibt es auch Oppositionelle, die sehr gute Arbeit leisten. Regierungskritiker, die sich nicht einschüchtern lassen. Journalisten, die weiterhin mutig sind und kritisch berichten. Aber die Zahl derer ist doch eher gering. Die wichtigsten Vertreter der einzig wirklich oppositionellen Partei, der pro-kurdischen HDP, sitzen im Gefängnis. Und den anderen traue ich nicht zu, dass sie es besser machen als Erdogan und seine AKP.
Kurz nachdem die Gezi-Proteste im Mai 2013 ausbrachen, sind Sie nach Istanbul gezogen. Haben Sie damals erwartet, dass die Türkei sich so rasant verändern würde?
Ich habe mit Veränderungen gerechnet, aber nicht in dieser Dramatik. Dass Erdogan es gelingt, mit brutaler Härte Kritik dauerhaft zu unterdrücken und dass er danach trotzdem noch Wahlen gewinnt, und zwar eindeutig, damit habe ich nicht gerechnet.
Warum haben Sie das unterschätzt?
Weil ich nicht gedacht hätte, wie sehr viele Menschen Erdogan für das schätzen, was er für sie geleistet hat, nämlich das Land wirtschaftlich voranzubringen, ein Stück weit weniger korrupt zu sein als die Vorgängerregierungen, die Macht des Militärs zu beschneiden und den einfachen, religiösen Menschen das Selbstvertrauen zurückzugeben – so sehr, dass ihnen Beschneidung von Freiheitsrechten egal ist. Den durchschnittlichen Bürger in Anatolien interessiert nicht, ob der Zugang zu Facebook oder Twitter gesperrt wird oder nicht.
Nach den Gezi-Protesten war der Putschversuch ein zweiter Wendepunkt in der politischen Entwicklung. Rückblickend gesehen hat der ausschließlich Erdogan genutzt. Halten Sie es für möglich, dass er inszeniert oder zumindest geduldet war?
Möglich ist alles. Aber ich würde das so nicht behaupten, solange es dafür keinen Beweis gibt. Tatsache ist, dass es einen Putschversuch gegeben hat, dass also Leute versucht haben, auf undemokratische Weise die Macht an sich zu reißen. Und Tatsache ist, dass Erdogan den Versuch als „Geschenk Gottes“ bezeichnet und die Gelegenheit genutzt hat, Tausende von Kritikern aus dem Weg zu räumen. Es spricht vieles dafür, dass fertige Listen von Kritikern existierten. Wie sonst hätte er so viele Gegner in so kurzer Zeit identifizieren und verfolgen können?
Im Mai 2014 drohten Ihnen hunderte Erdogan-Anhänger via Facebook mit dem Tod. Das wiederholte sich später noch einmal. Warum haben Sie damals nicht schon das Land verlassen, sondern erst als Ihre Akkreditierung 2016 nicht verlängert wurde?
2014 waren es nicht Hunderte, sondern Tausende. Und selbst klassische Medien griffen auf, ich sei angeblich ein Feind der Türkei, die Leute erkannten mich zum Teil auf der Straße. Aber das ebbte dann schnell ab. Und da meine Familie und ich die Türkei mögen, dachten wir: Wir bleiben einfach. Ich denke, das war die richtige Entscheidung.
Wie sehr haben Sie die Anfeindungen getroffen?
Ich kann mit Kritik umgehen, aber Beleidigungen und Morddrohungen sind inakzeptabel. Ich wollte mich davon nicht einschüchtern lassen. Als mir dann aber 2016 die Akkreditierung verweigert und auch noch angedroht wurde, man werde mich wegen Terrorunterstützung anklagen, blieb mir nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen. Ich bedauere sehr, dass die türkische Regierung diesen Schritt erzwungen hat. Das zeigt einmal mehr, was sie von Pressefreiheit hält und wie wenig Kritik sie verträgt.
kress.de: In der Türkei seien seit Erdogans Machtantritt 17.000 neue Moscheen entstanden, schreiben Sie. Ist das ein Symbol für die zunehmende Religiosität? Oder steht das stellvertretend für die politische Entwicklung? Stichwort: Bildung, Frauenrechte und Säkularismus.
Hasnain Kazim: Die Religiosität nimmt nach meinem Eindruck nicht zu. Sie wurde nur seit der Zeit Atatürks massiv unterdrückt. Das, was Atatürk geleistet hat mit der Gründung der Republik Türkei, ihrem Laizismus, ihrer Westorientierung und ihrer Modernisierung, das war ja eine Revolution von oben. Was wir heute erleben, ist eine Konterrevolution.
Eine Konterrevolution nach gut 90 Jahren?
Ja, und genau das ist ja auch das Interessante: Über Generationen hinweg hat sich die Unzufriedenheit weitervererbt. Heute sagen viele: Wir wollen unsere Religion ausleben können. Erdogan bespielt das äußerst geschickt. Und wie es beim politischen Islam ist, benutzt er die Religion und den Wunsch der Menschen für seine eigenen Machtinteressen. Und das ist das Bedenkliche.
Schon im Untertitel Ihres Buches schreiben Sie vom „Ende der Demokratie am Bosporus“, später dann vom „Tod der Demokratie“. Aber es gibt freie Wahlen. Wie lange noch?
Ach, na ja, wenn das Abhalten von Wahlen alleine Demokratie ausmachen würden, dann wäre die Türkei natürlich eine Demokratie. Aber zur Demokratie gehören auch Gewaltenteilung, Freiheitsrechte, Menschenrechte, der Ausgleich von Interessen. Demokratie lebt vom Kompromiss, so unbefriedigend das manchmal sein mag. All das zählt in der Türkei aber nicht viel, insofern kann von Demokratie keine Rede sein.
Aber noch wählen die Menschen mehrheitlich Erdogan …
Tun sie das nicht, so wie sie 2015 die AKP erstmals zu einer Koalition zwangen, bricht Chaos und Gewalt aus. 2015 kam es dann zu Neuwahlen, und siehe da, auf wundersame Weise gewann die AKP doch noch die absolute Mehrheit. Gut möglich, dass man da dann gleich auf Wahlen verzichtet. Oder eben, wie es ja schon geschieht, die Opposition ins Gefängnis verlagert. Was sollen das dann für Wahlen sein?
Ein Kapitel widmen Sie dem Verhältnis zwischen Türken und Deutschen. Seit einem halben Jahrhundert lebt nun eine große türkische Community bei uns. Wie sehen Sie die Entwicklung dieses Verhältnisses? Wird es sich verschlechtern?
In der Tat – leider verschlechtert sich das Verhältnis. Die Ursachen dafür sind auf beiden Seiten zu suchen. Man hat in den Menschen, die in Deutschland leben, lange Zeit die „Gastarbeiter“ gesehen.
Was ist daran schlimm?
Dass das ein unmöglicher Begriff ist, das ist daran schlimm, denn seit wann lässt man Gäste arbeiten? Nein, das sind Menschen, deren Vorfahren mal nach Deutschland gekommen sind, weil man sie gerufen hat, um das Land mitaufzubauen. Diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft und werden es auch bleiben. Das wollen manche nicht kapieren. Man hat diese Menschen oft als Bürger zweiter Klasse behandelt. Sie erleben immer wieder Anfeindungen im Alltag, und rassistische Übergriffe und Straftaten tun ihr Übriges.
Das klingt jetzt aber sehr einseitig.
Ich sage ja, dass die Ursachen auf beiden Seiten zu suchen sind. Und auf der Seite der Zugewanderten hat es tatsächlich Probleme gegeben bei der Integration. Klar gibt es Gruppen von Menschen, die selbst in dritter Generation immer noch schlecht Deutsch sprechen. Die in ihren Communities leben und „deutsch“ als ein Schimpfwort verstehen und ihren Kindern sagen: Spielt nicht mit denen, die trinken Alkohol, essen Schweinefleisch und haben ständig Sex miteinander. Integration erfordert von allen Seiten viel. Aber wir kommen nicht drum herum, diese Anstrengungen auf uns zu nehmen. Tun wir das nicht, wird sich die Lage verschlechtern.
Zu guter Letzt noch eine Frage zu Ihrer praktischen Arbeit: Als Korrespondent müsse man nicht unbedingt die Landessprache sprechen, schreiben Sie. Aber wie kann man sich ausreichend informieren, ohne die Zeitungen, die Nachrichten, die Menschen auf der Straße und die Interviewpartner zu verstehen?
Solange man gute Mitarbeiter hat, die einem alles übersetzen, versteht man ja vieles. Interviews habe ich immer mit Dolmetscher geführt, wenn es nicht auf Deutsch oder Englisch ging. Natürlich ist es immer gut, als Journalist die Sprache des Landes zu beherrschen. Deshalb habe ich mich bemüht, Türkisch zu lernen. Es reichte am Ende für den Alltag, aber nicht für ein Interview mit dem Präsidenten. Aber der wollte ja sowieso nicht mit mir reden.
Hasnain Kazim, Krisenstaat Türkei, Ein Spiegel-Buch
256 Seiten
Preis: 20,00 Euro
ISBN: 978-3-421-04784-7
