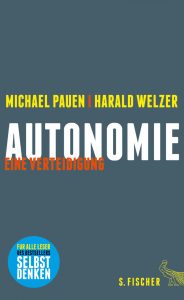 Was Harald Welzer, unter anderem Direktor von FUTURZWEI – Stiftung Zukunftsfähigkeit, umtreibt und womit er sich mit seinem Co-Autor Michael Pauen, Professor am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität, im Buch „Autonomie“ einmal mehr befasst, hat er unlängstin einem Interview so formuliert: „Ich sehe uns auf dem Weg in einen neuen Totalitarismus.
Was Harald Welzer, unter anderem Direktor von FUTURZWEI – Stiftung Zukunftsfähigkeit, umtreibt und womit er sich mit seinem Co-Autor Michael Pauen, Professor am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität, im Buch „Autonomie“ einmal mehr befasst, hat er unlängstin einem Interview so formuliert: „Ich sehe uns auf dem Weg in einen neuen Totalitarismus.
Wir denken immer, dass man dafür einen sichtbaren Wechsel des Herrschaftssystems braucht, in Uniform und mit Militärstiefeln. So wie bei den Nationalsozialisten, wie bei Stalin.
[…] Aber es geht im 21. Jahrhundert vielleicht auch anders.“ Und: „Diktaturen arbeiten immer zuerst an der Abschaffung der Privatheit und des Geheimen und Verborgenen. Denn nur so lassen sich Menschen effektiv kontrollieren. Google und Co. arbeiten […] an der Abschaffung des Privaten. […] Es droht ein Totalitarismus ohne Uniform.“
Autonomie gilt als zentrale menschliche Eigenschaft. Doch sie gerät von vielen Seiten unter Beschuss: Die Neurowissenschaft erklärt, der Wille sei nicht frei (wir, Singer zum Trotz sind da anderer Meinung), die Sozialpsychologie zeigt in ihren Experimenten ebenso wie Shitstorms im Internet, wie mächtig der Anpassungsdruck ist. Die Auswirkungen sind beträchtlich, wenn unsere Autonomie in Gefahr ist.
Anders als bei den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts und in den literarischen Visionen von Huxley bis Orwell bleibt dieses Mal die demokratische Fassade unserer Gesellschaft bestehen. Ja sie ist geradezu der ideale Entfaltungsrahmen für den neuen, den digitalen, den informationellen Totalitarismus (auch der Begriff „technologischer Totalitarismus“ ist gebräuchlich, so in einem jüngst unter der postumen Herausgeberschaft von Frank Schirrmacher erschienenen Suhrkamp-Sammelband gleichen Titels), der nicht mit Drohung, Druck und Gewalt in Szene gesetzt und erhalten werden muss, sondern der sich als Verheißung einer besseren Welt – mit immer neuen, immer schneller wechselnden technologischen Konsumtions- und Unterhaltungsangeboten an den Verbraucher wendet, die diesem mehr und mehr Entscheidungen abnehmen, ihm das Leben „vereinfachen“, „erleichtern“, „bereichern“ … Welzer/Pauen gebrauchen das eingängige Bild von „einer permanenten Ausweitung der Komfortzone“.
Auf der Strecke bleibt bei alledem die Autonomie des Individuums. Doch das wird den meisten Menschen, die überwiegend damit beschäftigt sind, aus den immer neuen Angeboten immer wieder „frei“, also „demokratisch“, auszuwählen und mit diesen Erwerbungen ihre Tage, mindestens ihre Freizeit, zu füllen, gar nicht bewusst. Und warum auch – es fehlt ja praktisch an nichts in der „schönen neuen Welt“. Vielleicht – so etwas wie ein Sinn des Lebens, aber wer braucht den schon, wenn er ganztägig „gut“ unterhalten wird.
In der spätkapitalistischen Endlosschleife von Verwertung und Gewinnmaximierung ist der ewig bedürftige Konsument das idealste aller Schmiermittel – ein Konsument übrigens, dem schlussendlich auch noch der letzte Rest von Autonomie genommen wird, nämlich die Selbstbestimmung über seine Bedürfnisse. Oder, wie es einer der Wizards der „schönen neuen Welt“, Google-Chef Eric Schmidt, trefflich formuliert hat: „Es ist nicht der Job der Verbraucher zu wissen, was sie wollen.“ Wer dies für ein Bonmot hält, der hat noch nicht begriffen, wie und woran Google und Co. arbeiten.
Die Autonomie des Individuums war, so Pauen/Welzer, „eine zivilisatorische Errungenschaft“: „Autonome Menschen können – in gewissen Grenzen – selbst entscheiden, welche Ausbildung sie machen, welchen Beruf sie wählen und mit welchem Partner sie ihr Leben oder Teile davon verbringen.
[…] autonome Individuen […] können weitgehend selbst bestimmen, was sie tun.“ Solche Möglichkeiten gab es historisch während der meisten Zeit der Existenz menschlicher Gesellschaften nicht, und, wie sich im digitalen Zeitalter gerade herausstellt, könnten ihr Heraufziehen, ihr politisches Erkämpfen über einige Generationen und ihr Bestehen ein insgesamt recht kurzes Intermezzo gewesen sein. „Ergebnisse von Zivilisationsprozessen können rückgängig gemacht werden“, warnen die beiden Autoren.
Eine Verteidigung
S. Fischer Verlag
Sachbuch – Hardcover
Preis € (D) 19,99 | € (A) 20,60
ISBN: 978-3-10-002250-9
