 Das Brexit-Votum und die amerikanischen Präsidentschaftswahlen haben die Krise der klassischen neoliberalen Politik dramatisch beschleunigt. Das Fiasko der Clinton-Kampagne zeigt, dass der Neoliberalismus nur noch nach rechts driften kann und deshalb auch nach rechts driften wird – ihm bleibt nur noch die Flucht nach vorn. Er wird dabei auf die Kombination setzen, die zuerst in Ländern wie Ungarn und Polen, dann in Großbritannien und jetzt in den USA funktioniert hat: die Kombination einer über ihr Scheitern hinweg fortgeführten neoliberalen Politik mit der Freisetzung des sozial-nationalen Ressentiments in der Mitte wie im unteren Feld der Gesellschaft.
Das Brexit-Votum und die amerikanischen Präsidentschaftswahlen haben die Krise der klassischen neoliberalen Politik dramatisch beschleunigt. Das Fiasko der Clinton-Kampagne zeigt, dass der Neoliberalismus nur noch nach rechts driften kann und deshalb auch nach rechts driften wird – ihm bleibt nur noch die Flucht nach vorn. Er wird dabei auf die Kombination setzen, die zuerst in Ländern wie Ungarn und Polen, dann in Großbritannien und jetzt in den USA funktioniert hat: die Kombination einer über ihr Scheitern hinweg fortgeführten neoliberalen Politik mit der Freisetzung des sozial-nationalen Ressentiments in der Mitte wie im unteren Feld der Gesellschaft.
Damit diese brandgefährliche Mixtur funktioniert, wird sie sich in jeweils landestypischen Variationen repräsentieren.
Eine neoliberale Mitte oder eine neoliberale „Linke“ wird dann keine relevante politische Kraft mehr sein. Die französischen und österreichischen Sozialisten sind im Grunde bereits abgewählt und folgen dem Weg der Pasok. Den spanischen Sozialisten bleibt nur der Trost, erst am Anfang der Amtszeit zu stehen, die sie sich im Pakt mit Rajoy erschlichen haben.
Sollte sich die deutsche Sozialdemokratie noch einmal an Merkel binden und im Huckepack vielleicht sogar eine weitere Amtszeit gewinnen, wird sie 2021 deutlich unter 20% liegen. Sollten die Grünen die SPD als Mehrheitsbeschafferin der CDU/CSU ablösen, werden sie im gleichen Wahlgang um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen müssen. Game over.
Eine linke Antwort auf die Globalisierung
Nichts geht mehr? Ganz im Gegenteil. Die allgegenwärtige Polarisierung und Politisierung stellen uns allen vielmehr eine grundlegende Frage: Wie weiter mit und in einer Welt der Globalisierung?
Was tun, wenn sie sich im „Jahrhundert der Migration“ nun auch von unten globalisiert – und sich gleichzeitig inmitten unserer Gesellschaften die Vielfalt der Geschlechteridentitäten, der Herkunft, der Lebens- und Liebensweisen weiter multipliziert?
Und zugleich: Was tun in einer Situation der tiefen Verunsicherung, der Abschottung und der Ressentiments? Wie verkehren wir die Bedrängnis in eine fortgesetzte Emanzipation unserer Lebenswelten und eine solidarische, demokratische und ökologische Globalisierung des Politischen? Mit einer Rückkehr zum linken Sozialstaatsnationalismus lassen sich diese Fragen ganz offenkundig nicht beantworten – so wenig allerdings wie mit einer bloßen Politik der Differenz, die den Kern der neoliberalen Prozesse unangetastet lässt. Gesucht wird vielmehr eine linke Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung von oben wie von unten. Eine Antwort, die in kultureller Befreiung und solidarischer Weltoffenheit die Potentiale einer neuen linken Politik der Gleichheit und Freiheit entdeckt.
Deutschland vor der Wahl
Auch wenn der Aufstieg des autoritär-rechtspopulistischen Neoliberalismus vielen Angst macht: Die politische Situation bleibt offen fur ihre fortschrittliche Auflösung, für die weitere Entfaltung einer solidarischen Moderne. Soll sich eine solche „Dritte Option“ auftun – jenseits von Clinton oder Trump, Hofer oder van der Bellen, von Brexit oder „Weiter so“ –, dann muss sie jedoch mehr
bieten als eine Neuauflage des nationalen Wohlfahrtsstaates oder eines „linken“ Neoliberalismus.
 Wir meinen, dass die Spielkarten der Geschichte in Deutschland, dem Machtzentrum der Europäischen Union, etwas anders gemischt sind als in Frankreich oder Großbritannien. Hier gibt es seit Jahren eine andere, zwar mehrfach schon beschädigte, wiederholt abgewählte, doch nach wie vor gangbare Option. Sie hängt zum einen an der ganz besonderen Ausdifferenzierung der parteipolitischen Linken. Sie hängt zum anderen an der gesellschaftlichen Unterstützung, die dieser nirgendwosonst gegebenen Konstellation zukommt. Seit vielen Jahren erringt sie, wenn auch mit Ausschlägen nach unten, rund die Hälfte der bei Bundes- wie Landtagswahlen abgegebenen Stimmen.
Wir meinen, dass die Spielkarten der Geschichte in Deutschland, dem Machtzentrum der Europäischen Union, etwas anders gemischt sind als in Frankreich oder Großbritannien. Hier gibt es seit Jahren eine andere, zwar mehrfach schon beschädigte, wiederholt abgewählte, doch nach wie vor gangbare Option. Sie hängt zum einen an der ganz besonderen Ausdifferenzierung der parteipolitischen Linken. Sie hängt zum anderen an der gesellschaftlichen Unterstützung, die dieser nirgendwosonst gegebenen Konstellation zukommt. Seit vielen Jahren erringt sie, wenn auch mit Ausschlägen nach unten, rund die Hälfte der bei Bundes- wie Landtagswahlen abgegebenen Stimmen.
Dass nur ein Teil dieser Stimmen auf eine entschieden linke Regierung zielen, ist jeder und jedem klar: das wird auch morgen noch nicht anders sein. Trotzdem birgt diese Konstellation eine Chance, die 2017 endlich ergriffen werden kann: vielleicht zum letzten Mal.
Anders Regieren!
Gehen wir die neu aufgelegten r2g-Debatten so an, dann öffnen wir uns selbst die Chance nicht nur der Behauptung, sondern auch der Durchsetzung einer anderen Politik. Einer Politik, in der es ummehr und um anderes gehen wird als um das, was in Hinterzimmergesprächen von Parteivertreternbesprochen werden kann.
 Arbeiten wir von jetzt an an der Chance einer neuen linken Mehrheit, die zuerst eine gesellschaftliche sein wird. Durchbrechen wir damit das lähmende Gefühl der politischen Alternativlosigkeit, das auch aus der einseitigen Fixierung auf Oppositions-, Protest oder Bewegungspolitik resultiert. Eine Politik der Hoffnung wird es in absehbarer Zeit nur geben können, wenn sie offensiv mit-regieren will und sich deshalb selbst zu einem gleichermaße realistischen und utopischen Transformationsprojekt nötigt: einem Projekt, das mehr umfasst als Parteien- und Bewegungspolitik; einem Projekt, welches das eines gesellschaftlichen Lagers sein wird – und das anders regieren wird als nur über eine Koalitionsregierung. Für diese Möglichkeit spricht, dass wir weder die einzigen noch auch nur die ersten sind, die ihr nachgehen. Je auf ihre Weise haben die Kampagnen von Bernie Sanders und Jeremy Corbyn und die Bewegungen hinter Podemos und Syriza schon dasselbe getan.
Arbeiten wir von jetzt an an der Chance einer neuen linken Mehrheit, die zuerst eine gesellschaftliche sein wird. Durchbrechen wir damit das lähmende Gefühl der politischen Alternativlosigkeit, das auch aus der einseitigen Fixierung auf Oppositions-, Protest oder Bewegungspolitik resultiert. Eine Politik der Hoffnung wird es in absehbarer Zeit nur geben können, wenn sie offensiv mit-regieren will und sich deshalb selbst zu einem gleichermaße realistischen und utopischen Transformationsprojekt nötigt: einem Projekt, das mehr umfasst als Parteien- und Bewegungspolitik; einem Projekt, welches das eines gesellschaftlichen Lagers sein wird – und das anders regieren wird als nur über eine Koalitionsregierung. Für diese Möglichkeit spricht, dass wir weder die einzigen noch auch nur die ersten sind, die ihr nachgehen. Je auf ihre Weise haben die Kampagnen von Bernie Sanders und Jeremy Corbyn und die Bewegungen hinter Podemos und Syriza schon dasselbe getan.
Warum das so ist wie es ist!
Die „Krise der Repräsentation“, die Abwendung vom bloß inszenierten „Parteiengezänk“, von der immer durchsichtigeren Desinformation durch Lobbyisten, „Experten“ und einem durchökonomisierten, auf staats- und machtkonforme Hofberichterstattung reduzierten Medienbetrieb sind zur Banalität unserer Epoche geworden. Schlimmer noch: die weit verbreitete, doch viel zu lange bloß beredete Einsicht in die Ausgelaugtheit und Entleerung der politischen Routinen und der „politikverdrossene“ Affekt gegen „die da oben“ sind längst zum Spielball einer autoritären Rechten geworden, die das sozial-nationale Ressentiment sehr viel besser bedient als jeder„linke“ Versuch, im Trüben mitzufischen.
 Gleichzeitig aber wird immer deutlicher, dass die Entdemokratisierung nicht einfach durch das Sicheinhausen ins ewig-oppositionelle, berufsprotestlerische und deshalb absehbar folgenlose Rechthaben überwunden werden kann. So unumgänglich, ja so befreiend die aktivistische Selbstermächtigung bleiben wird, so überdeutlich ist zugleich, dass die stetig wachsenden Bedürfnisse nach echter demokratischer Teilhabe auch auf neue und andere Möglichkeiten der politischen Repräsentation angewiesen sind. Öffnen wir sie für selbstbestimmte und weniger hierarchieorientiertere Politikformen und Diskussionen – in den politischen Institutionen, außerhalb ihrer und auch gegen sie.
Gleichzeitig aber wird immer deutlicher, dass die Entdemokratisierung nicht einfach durch das Sicheinhausen ins ewig-oppositionelle, berufsprotestlerische und deshalb absehbar folgenlose Rechthaben überwunden werden kann. So unumgänglich, ja so befreiend die aktivistische Selbstermächtigung bleiben wird, so überdeutlich ist zugleich, dass die stetig wachsenden Bedürfnisse nach echter demokratischer Teilhabe auch auf neue und andere Möglichkeiten der politischen Repräsentation angewiesen sind. Öffnen wir sie für selbstbestimmte und weniger hierarchieorientiertere Politikformen und Diskussionen – in den politischen Institutionen, außerhalb ihrer und auch gegen sie.
Fangen wir jetzt damit an, im Wahlkampf dieses Jahres. Hüten wir uns gleichzeitig davor, wie das Kaninchen
auf die Schlange zu starren: Was wir jetzt beginnen, wird 2017 und nach 2017 noch nicht getan sein, im Gegenteil.
Es geht um sehr viel mehr als nur um einen Aushandlungsprozess zwischen Parteien oder ihren parlamentarischen Repräsentationen. Gesellschaftliche Alternativen für einen solidarischen und nachhaltigen Einstieg in den Ausstieg aus mehr als drei Jahrzehnten Neoliberalismus entstehen nicht in Hinterzimmern, nicht in engen Zirkeln und auch nicht am Reißbrett. Sie müssen in der Breite der verschiedenen Milieus diskutiert werden, aus denen sie erwachsen.
Gescheiterte Eliten werden nicht kampflos aufgeben
Sie werden das so wenig tun, wie die Kräfte eines autoritär fortgeführten Neoliberalismus. Das sozial-nationale Ressentiment hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch in Deutschland gemordet, vergessen wir das nicht.
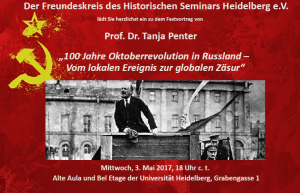 Eine sozialökologische Transformation braucht eine nachhaltige, ressourcenschonende, solidarische und demokratische Wirtschaft, braucht aus Naturbeherrschungs- und Wachstumwahn herauswachsende Arbeits- und Lebensweisen und einen vor Ort und im Ganzen transnationalen, europäischen Horizont. In Deutschland setzt das ein Ende des neoliberalen Exportmodells, in Europa ein Ende der Austeritätspolitik und der zuletzt auch selbstzerstörerischen Wettbewerbsorientierung voraus.
Eine sozialökologische Transformation braucht eine nachhaltige, ressourcenschonende, solidarische und demokratische Wirtschaft, braucht aus Naturbeherrschungs- und Wachstumwahn herauswachsende Arbeits- und Lebensweisen und einen vor Ort und im Ganzen transnationalen, europäischen Horizont. In Deutschland setzt das ein Ende des neoliberalen Exportmodells, in Europa ein Ende der Austeritätspolitik und der zuletzt auch selbstzerstörerischen Wettbewerbsorientierung voraus.
Dazu braucht es wenigstens fünf systematische Anstrengungen:
1. Solidarität – Für ein Investitionsprogramm in eine sozialökologische Infrastruktur. Wir brauchen ein längerfristig angelegtes, teilweise durch öffentliche Verschuldung vor- und durch verstärkte Steuereinnahmen gegenfinanziertes Investitionsprogramm als Motor des Umbaus und der Stärkung der europäischen Wirtschaft nach dem Desaster der Austerität. Streiten wir deshalb für den Umbau der Wirtschaft, für den systematischen Vorrang der öffentlichen Daseinsvorsorge, gegen das sozial und ökologisch zerstörerische Exportmodell des deutschen wie des Euro- Wirtschaftsnationalismus, gegen eine Produktion um der Produktion willen. Verpflichten wir die Produktion auf das Subsidiaritätsprinzip, auf Gemeinwohl und Gemeingüter, auf das Vollbringen der Energiewende. Steigen wir aus der Idiotie eines Konsumismus aus, in dem wir uns und andere nur noch erniedrigen können. Sorgen wir für die längst überfällige Verrechtlichung der globalen Produktions- und Lieferketten.
2. Gerechtigkeit – Für die Entprekarisierung der Arbeit und die Transnationalisierung des Sozialen.
Setzen wir endlich eine bedingungslose Grundsicherung der materiellen, kulturellen und politischen Teilhabe am Gemeinsamen durch transnational. Kämpfen wir für eine Arbeitszeitverkürzung auf der Höhe des technologisch Möglichen, für einen tatsächlich existenzsichernden Mindestlohn und eine allgemeine Bürger- und Erwerbstätigenversicherung. Organisieren wir den Ausbau und sorgen wir für die längst unumgängliche Aufwertung der Sorgearbeiten. Verlangen wir kompromisslos die Garantie der Sicherungs- und Gerechtigkeitsleistungen für alle, die hier sind.
Stellen wir uns endlich einer ebenso tiefgreifenden wie weit ausgespannten Debatte um ein anderes
Verständnis der schöpferischen Tätigkeiten.
3. Freiheit und Sicherheit – Für eine bedingungslose Menschenrechtsbindung aller Politik. Verpflichten
wir die Europäische Union auf eine umfassende Wende der Außen- und Sicherheits- zur Friedenspolitik.
Demokratisieren wir nicht nur die EU, sondern auch die UN. Gründen wir diese Wende im systematischen Ausbau der sozialen, ökonomischen, kulturellen und politischen Grundrechte und setzen wir uns für deren Globalisierung ein. Konkretisieren wir beides in einer diesen Zielen verpflichteten Neustrukturierung der internationalen Sicherheitssysteme, der Streitkräfte, Polizeien und Geheimdienste. Sorgen wir für die Durchsetzung der Grundrechte aller auch und gerade im Cyberspace.
4. Demokratie – Für ein Europa der Freizügigkeit und der globalen Gerechtigkeit. Verpflichten wir die Demokratie auf die Globalisierung von Recht und Gerechtigkeit auch in ökonomischer und ökologischer
Perspektive. Stärken wir dazu zuerst die demokratische Verfassung unserer Kommunen durch die umfassende Erweiterung ihrer politischen Kompetenzen wie ihrer ökonomischen Ressourcen.
Unterstützen wir im selben Zug den verfassungsgebenden Prozess für eine andere Europäische
Union und ihre transnationale Bürgerschaft. Gründen wir diese Bürgerschaft auf soziale, ökonomische, kulturelle und politische Verhältnisse, in denen die Inanspruchnahme des Menschenrechts auf Freizügigkeit wirklich zur Sache einer freien Entscheidung werden kann.
Verhindern wir die Entstellung des Rechts auf Freizügigkeit zu einer dem ökonomischen Kalkül unterworfenen
und deshalb selektiven Einwanderungs-und Abschottungspolitik und beginnen wir eine Debatte um ein Migrationsrecht.
5. Gleichheit – Für eine selbstbestimmte Lebensweise der Verschiedenheit und der globalen Nachhaltigkeit.
Die auf den Mai 68 folgenden Jahrzehnte waren nie nur Jahrzehnte der neoliberalen Entsicherung, sondern immer auch der Freisetzung unserer Denk- und Lebensweisen und unserer sozialen Beziehungen aus den Zwängen ihrer Herkünfte. Setzen wir diese Bewegung fort, treten wir weiter allen Formen des Sexismus, des Nationalismus und des Rassismus entgegen, eröffnen wir den freien Streit um das Gute Leben. Gründen wir diese Bewegung und diesen Streit auch auf seine materiellen Voraussetzungen: auf eine sozialökologische Infrastruktur, die ausnahmslos allen das Grundrecht auf ökologisch produzierte Nahrungsmittel, auf Wohnen, Gesundheit, freien Verkehr, auf freie Teilhabe an Bildung und Kultur und den Schutz vor jeder Form der Diskriminierung garantiert.
 Leben wir die Gleichberechtigung in der Freiheit in einer Kultur der demokratischen Dissidenz.
Leben wir die Gleichberechtigung in der Freiheit in einer Kultur der demokratischen Dissidenz.
Dieses andere Regieren reicht nicht nur über das institutionalisierte Staats- und Verwaltungshandeln und nicht nur über die Manöver und Taktiken von Parteien, sondern auch über die letztlich resignierte Selbstbeschränkung auf Protest und Opposition hinaus. Wer sich und andere auf dieses Wagnis verpflichtet, macht sich und andere von jeder Rettung durch ein „höheres Wesen“ frei – auch von den säkularen Varianten, die dieses Wesen in dem einen oder anderen „Subjekt der Geschichte“ gefunden hat. Aber:
„Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun“ – egal, wen wir uns dabei helfen lassen!
Dies zumal, wenn die Bitte es zu tun so wunderschön vorgetragen wird …
Wir müssen eine Regierung haben wollen dürfen, die einen Unterschied möglich macht und deshalb mit dem Neuen und Anderen wenigstens beginnt, auf das wir alle je auf unsere Weise setzen.
Dies wird nur gelingen, wenn sich Parteien und Politiker in den Dienst der Menschen und einer Idee stellen – und nicht umgekehrt die Menschen für ihre eigenen Ziele und Strategien benutzen.
Dennoch, und trotz alledem: Den Versuch ist es wert.

