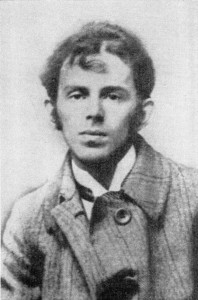 [1]Des 125. Geburtstages Ossip Mandelstams wegen widmet die UNESCO-Literaturstadt Heidelberg dem russisch-jüdischen Dichter die Ausstellung „Wort und Schicksal“. Die eigens für Heidelberg adaptierte und ergänzte Zusammenstellung von Exponaten des Staatlichen Russischen Literaturmuseums Moskau und weiterer russischer Archive ist vom 14. Mai bis 17. Juli 2016 in der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Pfaffengasse 18, zu sehen. Gezeigt werden bislang unveröffentlichte Originaldokumente, Manuskripte, Fotos und Graphiken, darunter auch Heidelberger Universitätsdokumente oder Kopien der KGB-Untersuchungsakten des 1938 im russischen Gulag verstorbenen Schriftstellers. Die Ausstellung wie auch das Rahmenprogramm werden durch die Baden-Württemberg Stiftung und die Heidelberger Volksbank gefördert.
[1]Des 125. Geburtstages Ossip Mandelstams wegen widmet die UNESCO-Literaturstadt Heidelberg dem russisch-jüdischen Dichter die Ausstellung „Wort und Schicksal“. Die eigens für Heidelberg adaptierte und ergänzte Zusammenstellung von Exponaten des Staatlichen Russischen Literaturmuseums Moskau und weiterer russischer Archive ist vom 14. Mai bis 17. Juli 2016 in der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Pfaffengasse 18, zu sehen. Gezeigt werden bislang unveröffentlichte Originaldokumente, Manuskripte, Fotos und Graphiken, darunter auch Heidelberger Universitätsdokumente oder Kopien der KGB-Untersuchungsakten des 1938 im russischen Gulag verstorbenen Schriftstellers. Die Ausstellung wie auch das Rahmenprogramm werden durch die Baden-Württemberg Stiftung und die Heidelberger Volksbank gefördert.
Wo Mandelstam nächtigte
Erstmals kann die Öffentlichkeit auch Objekte aus Mandelstams rastlosem Leben und direktem Umfeld in Augenschein nehmen, etwa das Sofa aus dem Arbeitszimmer des berühmten russischen Literaturtheoretikers Wiktor Schklowski, auf dem Ossip Mandelstam zeitweilig nächtigte, oder eine Ausgabe von Dantes „Göttlicher Komödie“ aus dem Besitz von Ossip Mandelstams Ehefrau Nadeschda. Umfangreich ist auch die Auswahl an politischen Originalplakaten und Bildwerken etwa des russischen Malers und Dichters Maximilian Woloschin. Einen spannenden multidisziplinären Zugang zu Mandelstam und seinem Lebensumfeld versprechen zudem Original-Ton- und Filmmaterialien sowie von Mandelstam inspirierte Klanginstallationen des jungen russischen Künstlers Nikolaj Khrust. Im Herbst 2016 wird die Ausstellung im Centro Federico García Lorca in Granada zu sehen sein. Zur Ausstellung gibt es ein umfassendes Begleitprogramm mit Stadtführungen, Konzerten, Theater- und Tanzveranstaltungen sowie Präsentationen von Bildwerken jugendlicher Heidelberger Künstlerinnen und Künstler zu Gedichten Ossip Mandelstams.
Internationales Auftaktprojekt für die UNESCO-Literaturstadt Heidelberg
Der Name Ossip Mandelstam ist eng mit der Stadt Heidelberg verbunden. In seiner Studienzeit 1909/1910 am Neckar begann er zu dichten. Heute lebt und schreibt der Poet Ralph Dutli in Heidelberg, der Ossip Mandelstams Gedichte vollständig übersetzt, erforscht und neu zugänglich gemacht hat.
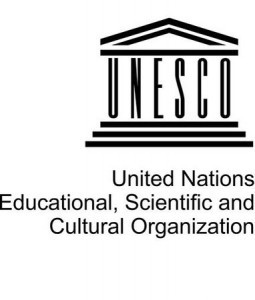 [2]„Ich könnte mir kein passenderes internationales Auftaktprojekt für die junge UNESCO City of Literature Heidelberg wünschen“, sagte Kulturbürgermeister Dr. Joachim Gerner bei einem Pressegespräch am Vortag der Ausstellungseröffnung. „Dass Ossip Mandelstam ein Jahrhundert-Poet war, zeigt sich bereits in seinen frühen Gedichten, die er in Heidelberg schrieb. Ihr Wortlaut bleibt im Gedächtnis. Sie setzen einen Kontrapunkt zur Schnelllebigkeit unserer Zeit“, so Gerner.
[2]„Ich könnte mir kein passenderes internationales Auftaktprojekt für die junge UNESCO City of Literature Heidelberg wünschen“, sagte Kulturbürgermeister Dr. Joachim Gerner bei einem Pressegespräch am Vortag der Ausstellungseröffnung. „Dass Ossip Mandelstam ein Jahrhundert-Poet war, zeigt sich bereits in seinen frühen Gedichten, die er in Heidelberg schrieb. Ihr Wortlaut bleibt im Gedächtnis. Sie setzen einen Kontrapunkt zur Schnelllebigkeit unserer Zeit“, so Gerner.
„Ossip Mandelstam war ein Poet, der es wagte, einem Diktator mit einem Schmähgedicht entgegen zu treten und der letztlich mit dem Leben dafür bezahlte“, erläuterte Dr. Andrea Edel, Leiterin des Kulturamts und des Projekts City of Literature. „Bis heute gilt es für alle UNESCO Creative Cities, die Freiheit des Worts zu verteidigen. Ossip Mandelstam hat in seiner Poesie und im politischen Widerstand kompromisslos agiert. Seine Poesie gibt mir Kraft und Hoffnung“, so Edel.
„Dass durch die Kooperation mit den zwei UNESCO-Literaturstädten Ossip Mandelstams Kunst und Werke seiner russischen Zeitgenossen wie Maximilian Woloschin international europaweit gezeigt werden können, freut uns sehr“, bekannte der Direktor des Staatlichen Literaturmuseums Moskau, Professor Dmitrij Bak, und fügte hinzu: „Es hätte Mandelstam, der sowohl einen starken Bezug zur deutschen Kultur und vor allem Musik hatte als auch eine starke ‚Sehnsucht nach Weltkultur‘ empfand, sicher ebenso glücklich gemacht.“
Ein rastloses Leben
Ossip Mandelstam wurde 1891 als Sohn jüdischer Eltern in Warschau geboren. Er wuchs in Pawlowsk und Sankt Petersburg auf, wo er am renommierten Tenischew-Gymnasium eine breite geisteswissenschaftliche Ausbildung erhielt. Da Ossip Mandelstams poetisches Schaffen während seines Studienaufenthaltes in Heidelberg 1909/10 seinen Anfang nahm, wurde Heidelberg zur „Wegscheide von größter Wichtigkeit für die Dichtung des zwanzigsten Jahrhunderts“, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (11. Februar 2016) vermerkt. Beeinflusst von der Idee des Symbolismus, veröffentlichte Mandelstam 1910 seine ersten Gedichte und begann 1911 an der Petersburger Universität sein literaturwissenschaftliches Studium. Er wurde Mitglied der Literatengruppe der Akmeisten um Nikolai Gumiljow und veröffentlichte neben Gedichten auch Essays zu literarischen Themen. Sein 1913 erschienener erster Gedichtband „Der Stein“ machte Mandelstam in der literarischen Welt bekannt. Die Zeit nach der Oktoberrevolution war für Mandelstam eine ruhelose Zeit. Rastlos und im „inneren Exil“, lebte er mit seiner Frau Nadeschda, die er seit 1919 kannte und 1922 heiratete, abwechselnd in Moskau, Petersburg und Tiflis, stets ohne große materielle Basis. Im Gegensatz zu Werken anderer Dichter durften in den 20er Jahren seine Bücher noch erscheinen. Im Zuge der Stalinschen „Säuberungen“ in den 1930er Jahren wurde er 1934 erstmals verhaftet. Einem harten Urteil entging Mandelstam nach einem Selbstmordversuch. Zunächst nur nach Tscherdyn verbannt, verbrachte er später drei Jahre in Woronesch in der Verbannung. Seine letzten Gedichte in den „Woronescher Heften“ entstanden hier. Legenden zufolge sprach Stalin persönlich telefonisch mit Mandelstams Freund und Kollegen Pasternak über Mandelstams Schicksal. Am 2. Mai 1938 erneut verhaftet, wurde er zu fünf Jahren Lager wegen konterrevolutionärer Aktivitäten verurteilt. Am 27. Dezember 1938 starb er im Übergangslager „Wtoraja Retschka“ bei Wladiwostok und wurde in einem Massengrab beerdigt. Nadeschda Mandelstam und Freunde des Dichters bewahrten viele der Gedichte, teils durch Auswendiglernen der nicht niedergeschriebenen Texte, und ermöglichten ihre Veröffentlichung in den 60er Jahren.
Ausstellungseröffnung
Offiziell eröffnet wird die Ausstellung des Staatlichen Literaturmuseums Moskau und der Mandelstam-Gesellschaft Moskau in Kooperation mit den UNESCO Cities of Literature Heidelberg und Granada am Freitag, 13. Mai 2016, um 19 Uhr von Bürgermeister Dr. Joachim Gerner, der Baden-Württembergischen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia Bauer, sowie dem 1. Botschaftsrat und Kulturattaché der Russischen Föderation, Sergey Maguta. Künstlerische Beiträge liefern zur Vernissage das Klangforum Heidelberg mit Mandelstam-Vertonungen sowie die Freie Waldorfschule Heidelberg mit russisch-deutschen Collagen von Texten Ossip Mandelstams in der Regie von Theaterregisseur Martin Oelbermann; Professor Urs Heftrich, Direktor des Slavischen Instituts der Universität Heidelberg, gibt in einem Kurzvortrag eine Einführung zu Ossip Mandelstam.
Kooperationspartner der Ausstellung in der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte sind das Staatliche Literaturmuseum Moskau und die Mandelstam-Gesellschaft Moskau sowie die UNESCO City of Literature Heidelberg und die UNESCO City of Literature Granada. Herausgegeben vom Staatlichen Literaturmuseum Moskau und den UNESCO Cities of Literature Heidelberg und Granada wird auch eine zweisprachige, reich bebilderte Publikation mit Texten von und zu Ossip Mandelstam im Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg, erscheinen.
Führungen und Öffnungszeiten
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung: 15.5, 22.5, 29.5., 26.6., 29.6., 10.7., jeweils 14.30 Uhr.
Öffnungszeiten der Ausstellung: täglich außer Montag 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr.
Eintritt frei.
Infos: www.heidelberg.de/cityofliterature [3] und www.ebert-gedenkstaette.de [4]
Rahmenprogramm
Begleitend gibt es im Rahmenprogramm zur Ausstellung viele verschiedene Veranstaltungen: von Lesungen, Vorträgen, und Filmvorführungen bis hin zu Konzerten und Kunstaktionen.
13.5.-17.7.2016, Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Pfaffengasse 18
Ausstellung der Jugendkunstschule Heidelberg-Bergstraße e. V.
in Zusammenarbeit mit der UNESCO City of Literature
Projekt mit Schülern zum Programm der Ossip Mandelstam-Ausstellung
An der Jugendkunstschule Heidelberg-Bergstraße e.V. haben sieben Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 21 Jahren Bilder zu Gedichten von Mandelstam auf großformatigen Papieren und auf Leinwänden gestaltet. Alle Arbeiten beziehen sich inhaltlich auf Mandelstams Gedichte, mit jeweils äußerst individuellen Interpretationsansätzen.
19.05.2016, 19.00 Uhr, Haus Cajeth, Haspelgasse 5
Mandelstam, Heidelberg: „Ich war das Buch, das euch im Traum erscheint“
Ralph Dutli liest Ossip Mandelstams Heidelberger Gedichte (russisch & deutsch) und spricht über die Bedeutung Heidelbergs für das Werk des russischen Dichters
Mandelstams Heidelberger Gedichte sind zarte sprachliche Gebilde von erstaunlicher Reife und Tiefgründigkeit. Sie zeigen viele Motive, die für sein späteres Werk bedeutsam sind. Der 18-jährige Dichter war auf der Suche nach seinem Weg, seiner Beziehung zur Welt, zur Natur, zur Liebe. Heidelberg wurde eine „wichtige Wegscheide für die Dichtung des 20. Jahrhunderts“ (FAZ).
Ralph Dutli lebt in Heidelberg. Er ist Herausgeber der Mandelstam-Gesamtausgabe und Autor der Mandelstam-Biographie „Meine Zeit, mein Tier“. Zuletzt erschienen: „Bahnhofskonzert. Das Ossip-Mandelstam-Lesebuch“ und „Mandelstam, Heidelberg. Gedichte und Briefe 1909-1910“.
29.05.2016, 17.00 Uhr, Treffpunkt: Stadtgarten gegenüber dem „Europäischen Hof“, Friedrich-Ebert-Anlage 1
Russische Gäste im literarischen „Weltdorf“ Heidelberg
UNESCO City of Literature-Gruppe, Heidelberger Gästeführer
Auf den Spuren von Ossip Mandelstam und europäischer Dichter, die, oft weitgereist, der Stadt Heidelberg einen Besuch abstatteten, hier studierten oder im Exil lebten. Besonders Ossip Mandelstamm und seine Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert werden lebendig. Teilnehmer hören Gedichte in deutscher aber auch in russischer, polnischer und englischer Sprache.
Tickets: 5 Euro
07.06.2016, 19.00 Uhr, Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Pfaffengasse 18
Heidelberg als Literaturstadt um 1909
Vortrag von Hans-Martin Mumm
Heidelberg war vor 100 Jahren eine Stadt mit hoher Dichte an literarischem Schaffen. Bedeutende Lyriker lebten hier oder kamen öfter her. Die Gesellschaft für Dramatik arbeitete an der Erneuerung des Theaters. Der Zupfgeigenhansel (1908) und die Verlagsgründungen von Hermann Meister und Richard Weissbach (1912) waren weitere Marksteine. Ossip Mandelstams spätere Bibliothek gibt Hinweise, welche Anregungen er als Student aus Heidelberg mitgenommen hat.
11.06.2016, 14.00–17.00 Uhr, Hauptstraße
MandelstamStraße. Poetische Attraktionen und Interaktionen in der Hauptstraße
Ausgehend von der Überlieferung von Werken Mandelstams durch das Memorieren seitens ihm nahestehender Personen wird ein oder werden mehrere ausgewählte (Heidelberger) Gedichte von ihm auf die Reise durch die Heidelberger Altstadt geschickt: Mit der höflichen Frage, „doch bitte etwas einige Meter durch die Hauptstraße mitzunehmen“, werden Vers für Vers an Passanten mündlich übergeben. Startpunkt ist der Bismarckplatz. In regelmäßigen Abstanden von circa 50 bis 100 Metern werden die erinnerten Verse an die nächsten Passanten weitergegeben, bis jeder einzelne Vers am Universitätsplatz angekommen das gesamte Gedicht wieder vervollständigt.
Kooperation von [Ak.T]-heater Heidelberg und UNESCO City of Literature in Zusammenarbeit mit der Theaterakademie Mannheim, der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und dem Kamina-Dichterkreis.
12.06.2016, 19.30 Uhr, HebelHalle openSTAGE IV:_Ossip Mandelstam.
Anlässlich der Ausstellung „Ossip Mandelstam. Wort und Schicksal“ in der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte wird die renommierte Heidelberger Choreografin Jai Gonzales gemeinsam mit Gästen auf den Spuren des Dichters Ossip Mandelstam eine „openSTAGE“ entwerfen. Ins Zentrum stellt die Helene-Hecht-Preisträgerin die Frau des Dichters, Nadeschda Jakowlewna Mandelstam.
Nadeschda Jakowlewna Mandelstam wurde am 18. Oktober 1899 geboren. Sie heiratete Mandelstam 1921 und blieb bei ihm bis zu seinem Tod im Jahr 1938 im Lager Wtoraja Retschka nahe Wladiwostok. Um Verhaftung und Repressalien zu entgehen, wechselte sie bis 1958 kontinuierlich den Wohnort. Um das Werk ihres Mannes dennoch zu erhalten, lernte sie seine Texte auswendig und machte eigene Aufzeichnungen, die sie bei verschiedenen zuverlässigen Freunden versteckte.
Jai Gonzales beleuchtet diesen und weitere Aspekte in Mandelstams Leben mit aktuellen künstlerisch-performativen Strategien. Hierbei stehen jene Prozesse im Vordergrund, die das Werden und Vergehen, die Gestaltung und Entwicklung des Ausdrucks in den Vordergrund stellen, weniger das repräsentative, inhaltlich festgelegte Produkt. Die von Nadeschda Mandelstam still ins Gedächtnis überführten Wörter, Sätze und Texte des Dichters werden bei Gonzales zu Raum und Material, aus dem jeweils vor den Augen der Zuschauer Szenen, Momente und Körperbilder geboren werden.
„openSTAGE IV_Ossip Mandelstam“ erfolgt in Kooperation mit der UNESCO City of Literature und wird vom Kulturamt der Stadt Heidelberg unterstützt.
17.06.2016, 12.00 Uhr, Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Pfaffengasse 18
„Bilder zu Ossip Mandelstam“, Ausstellungseröffnung
Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse der Theodor-Heuss-Realschule Heidelberg haben sich in einem Workshop spielerisch, bildnerisch und textlich mit Kinder- und Jugendgedichten des bedeutenden russischen Dichters Ossip Mandelstam (1891-1938) auseinandergesetzt. Die entstandenen Arbeiten der Schüler werden in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte im Rahmen der Ausstellung „Ossip Mandelstam. Wort und Schicksal“ präsentiert.
UNESCO City of Literature in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte und der Theodor-Heuss-Realschule
22.06.2016, 19.00 Uhr, Friedrich-Ebert-Gedenkstätte. Pfaffengasse 18
„Das verlorene Paradies. Russen in Heidelberg 1860–1914“
Vortrag von Dr. Roland Krischke im Rahmen der Sonderausstellung „Ossip Mandelstam. Wort und Schicksal“
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zog es viele junge Russen nach Heidelberg. Vor allem der Ruf der naturwissenschaftlichen Fakultäten der Universität mit Helmholtz oder Bunsen sorgte dafür, dass die „Anlage“ zeitweise zur „Russenstraße“ wurde. In der Plöck entstand eine russische Lesehalle. Zu den berühmten Russen in Heidelberg gehörten neben Turgenjew oder Mendelejew auch Borodin, Skrjabin und Rimskij-Korsakow. Der Erste Weltkrieg beendete die von vielen Russen als Idylle empfundene Zeit in „Gejdelberg“, ihrem „verlorenen Paradies“.
26.06.2016, 11.00 Uhr, Treffpunkt: Friedrich-Ebert-Anlage 30, Mandelstam-Tafel
Mandelstams Umfeld: Die russische Lesehalle 1861 bis 1914
Stadtführung von Hans-Martin Mumm
Die Anfänge der russischen Lesehalle gehen auf 1861 zurück. Sie hatte mindestens neun Adressen in der Altstadt. In ihr trafen sich die politisch Oppositionellen. Ihre Bibliothek wurde 1914 konfisziert und bildete ab 1919 den Grundstock des slavischen Instituts unter Nikolai von Bubnoff. Dass Ossip Mandelstam in der Lesehalle verkehrte, belegt, dass er in Heidelberg die sozialrevolutionären Kontakte nicht ganz aufgegeben hat. Die Führung endet in der Nähe des Treffpunkts.
Teilnahme: 5 Euro
28./29.06.2016, jeweils 19.00 Uhr, TIKK – Theater im Kulturhaus Karlstorbahnhof
Das Rauschen der Zeit. Erinnerungen an Ossip Mandelstam
Schüler des Hölderlin Gymnasiums haben sich zum 125. Geburtstag Ossip Mandelstams mit seinem poetischen Werk beschäftigt und ein Theaterprojekt erarbeitet, in dem Stationen aus Mandelstams Leben, einige seiner Gedichte sowie sein Verhältnis zum Thema Zeit mit eigenen Assoziationen und Bildern verwebt und auf die Bühne gebracht werden. An der Stückentwicklung war der renommierte Theaterregisseur Martin Oelbermann beteiligt, der unter anderem an den großen Schauspielhäusern in Graz, Wien, Hamburg, Dresden, Wuppertal und der Deutschen Oper am Rhein inszenierte.
UNESCO City of Literature in Kooperation mit dem Hölderlin Gymnasium und dem Karlstorbahnhof, Projektorganisation: Tabea Tangerding
04.07.2016, 19.00 Uhr, Karlstorkino im Kulturhaus Karlstorbahnhof
Gratwanderung. Erinnerungen an Jewgenia Ginsburg
Film von Mario Damolin
Ihre Bücher „Marschroute eines Lebens“ und „Gratwanderung“ vom Ende der 60er Jahre sind Meilensteine der sogenannten Gulag-Literatur. Darin beschreibt die 1904 geborene russisch-jüdische Schriftstellerin und Universitätsdozentin Jewgenia Ginsburg ihren 17 Jahre dauernden Leidensweg durch sowjetische Gefängnisse, Arbeitslager und in der Verbannung. Sie gerät 1937 unter dem Vorwurf „trotzkistischer Kontakte“ in die Mühlen der stalinistischen Vernichtungspolitik und überlebt nur knapp die mörderischen Arbeitslager in der sibirischen Kolyma-Region. Nach Stalins Tod kommt sie 1955 frei und wird rehabilitiert. Jewgenia Ginsburg stirbt 1977 in Moskau.
In der Verbannung in Magadan heiratet Ginsburg den russlanddeutschen Arzt Anton Walter, ebenfalls ehemaliger Gulag-Häftling. Die beiden adoptieren 1949 in Magadan das zweijährige Mädchen Antonina, Tochter einer unbekannten Gulag-Gefangenen. Zusammen mit ihr und dem Sohn aus Ginsburgs erster Ehe, Wassili Aksjonov, dem späteren Schriftsteller, zieht das Paar 1955 nach Moskau.
Antonina Axenova, die inzwischen 69-jährige Adoptivtochter Ginsburgs, lebt heute in Frankfurt/Main und inszeniert dort Theaterstücke für Kinder an einer deutsch-russischen Schule. Im Spätsommer 2014 brach sie zu einer Reise in die Kolyma-Region am östlichsten Rand Sibiriens auf. Sie wollte dort Archivmaterial über das Leben ihrer Adoptivmutter sammeln. Begleitet wurde sie von dem Heidelberger Dokumentarfilmer Mario Damolin, der diese Fahrt in die Vergangenheit zur Grundlage seiner filmischen Dokumentation „Gratwanderung“ machte. Sie besuchten jene Plätze in Sibirien, die nicht nur für Jewgenia Ginsburg sondern für Hunderttausende Opfer „Orte der stalinistischen Hölle“ waren. Die Reise endete im Moskauer Sowremennik-Theater, in dem heute immer noch vor ausverkauftem Haus die Theaterversion der Ginsburg’schen „Gratwanderung“ aufgeführt wird.
05.07.2016, 19.00 Uhr, Karlstorkino im Kulturhaus Karlstorbahnhof
Der Spiegel
Film von Andrei Tarkowski
Einführung: Prof. Dr. Jekatherina Lebedewa, Leiterin der Russischen Abteilung des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg.
In Andrej Tarkowskis Film „Der Spiegel“ erklingt die Stimme seines Vaters, des Dichters Arseni Tarkowski, der seine eigenen Gedichte spricht. Die eigenwillige Bildsprache verbindet Gedichte und Filme der beiden Tarkowskis, die sich dem Konsumenten verweigern und an die Grundfragen menschlicher Existenz rühren. Anna Achmatowa schrieb über Arseni Tarkowski: „Wie konnte dieser Dichter, der zwar sehr gut, sehr klug und talentiert, von Mandelstam aber gänzlich erdrückt war, sich so plötzlich befreien, so schlagartig seine eigene Stimme finden, seine unwiederholbare frische Stimme?…Jedem ist klar: Mandelstam und Pasternak sind ihrem Wesen nach Tyrannen, sie besitzen eine solche Kraft, eine solche Macht, dass nur ein sehr starker Dichter sie in sich selbst überwinden kann. Und er hat es einfach getan. So ist er.“ Viele Szenen der Filme Andrej Tarkowskis sind ins Bild gesetzte Gedichte Arseni Tarkowskis – ursprünglich hieß sein Film „Der Spiegel“ nach dem gleichnamigen Gedicht Arseni Tarkowskis „Weißer, weißer Tag“. Durch die Filme seines Sohnes gelangten die Gedichte Arsenij Tarkowskis, der in der Stalinzeit als „mystisch“ gebrandmarkt, 30 Jahre im Stillen arbeiten musste, in die Welt, noch bevor sie in andere Sprachen übersetzt waren.
Eintritt 5 Euro
16.07.2016, 20.00 Uhr, Kunstverein Heidelberg, Hauptstraße 97
Konzert „Heimathen“ des Klangforums Heidelberg
Vertonungen von Werken Mandelstams in Gegenüberstellung mit Werken emigrierter Komponisten
Dichtung und Musik von Künstlern ohne Heimat: ins Exil vertrieben wie Arnold Schönberg oder in den Gulag geschickt Ossip Mandelstam. Vertonungen seiner Werke durch Jelena Firssowa und Jan Kopp (Uraufführung) werden mit Mandelstams Worten (Ralph Dutli) und mit Werken emigrierter Komponisten gegenübergestellt, darunter Alvaro Carlevaro (Uruguay), Samir Odeh-Tamimi (Palästina) u.a.
Eintritt 20 Euro, 15 Euro Mitglieder, 10 Euro Ermäßigte, Vorverkauf über klanghd.de… [5], RNZ und Zigarren Grimm
Finissage 17.07.2016, 19.00 Uhr, Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Pfaffengasse 18
Das Jahrhundert der Wölfe von Nadeschda Mandelstam
Lesung von Nicole Averkamp und Hendrik Richter, Schauspielensemble Theater und Orchester Heidelberg
Ergänzend: Infos [6] zur Literaturstadt Heidelberg