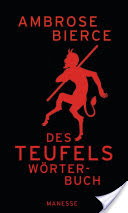 Das legendäre „Des Teufels Wörterbuch“ von Ambrose Bierce kann nun endlich (wieder) auf deutsch in vollem Umfang gelesen werden, nachdem der 1986 im Haffmanns Verlag erschienene Titel hoffnungslos und nirgendwo mehr zu haben ist – es sei denn, man habe; ich zum Beispiel. Umsomehr freue ich mich aber, dass dies Büchlein nun auch Sie wieder zu erwerben in der Lage sind.
Das legendäre „Des Teufels Wörterbuch“ von Ambrose Bierce kann nun endlich (wieder) auf deutsch in vollem Umfang gelesen werden, nachdem der 1986 im Haffmanns Verlag erschienene Titel hoffnungslos und nirgendwo mehr zu haben ist – es sei denn, man habe; ich zum Beispiel. Umsomehr freue ich mich aber, dass dies Büchlein nun auch Sie wieder zu erwerben in der Lage sind.
Das sprachkritische Wörterbuch ist ein kaum gewürdigtes Genre der Aufklärung des 18. und 19. Jahrhunderts. Schon einige Artikel der Enzyklopädie von Diderot und d’Alembert enthalten neben Begriffserläuterungen mokante Bemerkungen über den abgeschmackten Stil in den Werken der gegnerischen Philosophieschulen. Doch erst Gustave Flauberts Vorhaben einer Enzyklopädie der menschlichen Dummheit, aus der sein Wörterbuch der Gemeinplätze Stichproben bietet, machte die Erkenntnis, dass nur das richtig Gesagte auch richtig gedacht ist, zum Ausgangspunkt einer Stilkritik, der fast alles zum Objekt werden konnte.
Dass eine Naturgeschichte der menschlichen Dummheit auf eine Naturgeschichte der Menschheit selbst hinauslaufen müsste, wusste – was Wunder – auch Karl Kraus, dessen Schriften der Versuch sind, mit diesem Vorhaben, dem kein Einzelner gerecht werden kann und doch nur der Einzelne gerecht werden könnte, ernst zu machen. Ein weiteres Wörterbuch der Gemeinplätze hat er nicht geschrieben; sein ganzes Werk nämlich ist indes als solches zu verstehen.
Kraus war nicht nur der Ambitionierteste, sondern auch der Letzte seiner Art. Das 20. Jahrhundert hat die Sprachkritik zwar als satirische Gattung popularisiert, sie damit aber auch zum Teil desselben Betriebs gemacht, den sie anprangerte. Dolf Sternbergers und W. E. Süskinds Wörterbuch des Unmenschen, das den politischen Jargon der frühen Bundesrepublik ins Visier nimmt, und selbst das Mitte der Achtziger erschienene Kompendium Dummdeutsch von Eckhard Henscheid und Gerhard Henschel haben mit dem von Flaubert und Kraus gesetzten Anspruch nur wenig gemein. Sie beschränken sich auf die Kritik intellektueller und politischer Moden – Existentialismus, Öko-Bewegung, Feminismus – und bleiben ihrer Zeit so verhaftet wie die Phänomene, die sie kritisieren.
Zudem opfern sie die Erkenntnis mitunter der Pointe. In Letzterem ähneln sie einem 1911 erschienenen Buch, das mit seinen Witzen oft unfreiwillig den zeitgenössischen Ungeist wiederholt: Ambrose Bierces sprachkritisches Kompendium Des Teufels Wörterbuch, das auf Deutsch in bislang umfangreichster Form nun bei Manesse erschienen ist.
Bierce, 1842 als zehntes von 13 Kindern in Ohio geboren und durch seine Teilnahme am amerikanischen Bürgerkrieg mit den grausamen Seiten der Zivilisation vertraut, versuchte mit dem Wörterbuch seinen durch Kurzgeschichten erworbenen Ruf als Zyniker zu festigen, der Idealismus und Humanität als Fassade einer egoistischen Menschheit entlarvt. Die immanente Sprachkritik, wie Flaubert und Kraus sie pflegten, ist weniger seine Sache. Bierce demontiert den Idealismus nicht, indem er seinen Jargon aushöhlt, sondern indem er ausspricht, was dieser verschweigt.
Dass ich ein Feigling bin, das hat mir Bierce beigebracht: „Ein Feigling ist ein Mensch, bei dem der Selbsterhaltungstrieb normal funktioniert“. Oder, dass ich ein Philosoph wäre und warum: „Alle sind Irre; aber wer seinen Wahn zu analysieren versteht, wird Philosoph genannt“. Oder, gern doch, dass ich ein Denker bin: „Gehirn: ein Organ, mit dem wir denken, dass wir denken“. Und, je lakonischer ihm das auf den Punkt bringen gelingt, desto besser sind die Eintragungen. Etwa, wenn „wunderbar“ mit „nicht verstanden“, „überzeugt“ mit „lautstark im Irrtum“ und „unmoralisch“ mit „unzweckmäßig“ übersetzt wird. „Opferung“ definiert das Wörterbuch als „heiligmäßige Tötung“, „absolut“ als „ohne jeglichen Bezug auf etwas und aus reinem Eigennutz existierend“, „Redekunst“ als „Verschwörung zwischen Sprache und Handeln zu dem Zweck, den Verstand zu hintergehen“, und „gleich“ als „so schlecht wie etwas anderes“. Lakonie und Versachlichung nehmen den Worten ihren Nimbus und enthüllen deren Zweck: die Selbstüberhöhung des Sprechers und die Rechtfertigung und Verschleierung von Unrecht.
Bierces Werk wurde von seinen Zeitgenossen als zynisch empfunden, vor allem wegen der Unerbittlichkeit, mit der es die Verkommenheit und den Egoismus der Menschen immer schon voraussetzt. Das führt mitunter zu Wortbestimmungen von tiefem Witz. So wird „ruhen“ als „aufhören, andere zu belästigen“ und „Selbstachtung“ als „Fehleinschätzung“ erklärt. Doch wie Zynismus stets die Tendenz hat, die Menschen nur deshalb mit der Hohlheit ihrer Ideale zu konfrontieren, um sie auf ihre vermeintlich unveränderliche Nichtigkeit festzulegen, so macht sich auch in Des Teufels Wörterbuch immer wieder der selbstzufriedene Fatalismus desjenigen bemerkbar, der das Schlimmste stets vorausgeahnt hat. Die Sprachkritik verkümmert dann tendenziell zu einem Mittel, um den Menschen beizubringen, dass jeder Traum vom Glück nur Illusion und jeder Fortschritt einer zum Schlechten sei. „Vernunft“ wird dementsprechend als „kondensiertes Vorurteil“ definiert, „Friede“ als „Periode des Betrugs zwischen zwei Perioden des Kampfes“, „Freude“ als „Gefühlsbewegung“, die sich „aus der Betrachtung fremden Kummers“ speise, und Glück als „angenehmes Gefühl“, das „aus der Betrachtung fremden Elends“ erblühe.
In solchen Passagen wird die Polemik gegen den Idealismus zur Diffamierung des Ideals überhaupt. Dass alles sei, wie es ist, und dass sich am bösen Menschenwesen nichts würde ändern lassen, das scheint denn auch die Essenz dieser Kritik zu sein.
Wo Bierce, statt die Mehrdeutigkeit der Sprache und die desillusionierende Kraft der Lakonie auszunutzen, die in Gisbert Haefs Übersetzung besonders gut zur Geltung kommt, auf lachendes Einverständnis setzt, bricht dieses Ressentiment vollends durch. Wenn etwa „Mammon“ als „Gott der größten Weltreligion“ bestimmt wird, dessen „Haupttempel“ sich in „der Heiligen Stadt New York“ befinde, oder sich im Eintrag „Frau“ die Bemerkung findet, es handle sich um einen „Allesfresser“, dem „das Nichtsprechen beigebracht“ werden könne, appelliert er an einen judenfeindlich grundierten Antikapitalismus und an misogyne Affekte, mit deren massenhaftem Vorhandensein damals wie heute gerechnet werden konnte. Solche Stellen, in denen die Kritik in Konformismus umschlägt, entwerten zwar nicht die gelungenen Passagen. Jedoch wirken sie auf das Buch zurück und weisen auf die Gefahr der billigen Pointe hin, der Sprachkritik in Zeiten der Massenkultur ausgesetzt ist.
AMBROSE BIERCE „Des Teufels Wörterbuch“
Mit Nachwort von Gisbert Haefs
Aus dem Amerikanischen von Gisbert Haefs
Gebundenes Buch, 224 Seiten, 9,0 x 15,0 cm
ISBN: 978-3-7175-2304-8
€ 19,95 [D] | € 20,60 [A] | CHF 28,50* (* empf. VK-Preis)
Verlag: Manesse
Leseprobe von A bis B
