Als Musterbild eines Politikers, der mit dem Appell an dumpfe Vorurteile Karriere macht. Der auf alles losgeht, was man mit etwas Phantasie als fremd oder undeutsch bezeichnen kann, weil er sich darauf verlässt, dass es für den politischen Erfolg keine differenzierte Argumentation braucht, solange man nicht an die Urteils-, sondern nur an die Vorurteilskraft seiner Wähler appelliert. Weil er schon von (wer auch immer hab ihn selig) Franz Josef Strauss gelernt hat, dass im Krieg der Meinungen die Lufthoheit über den Stammtischen entscheidend ist. Weil er den zentralen Lehrsatz des Populismus verinnerlicht hat: Das einfache Argument schlägt jederzeit das richtige. Diffamieren geht über Studieren.
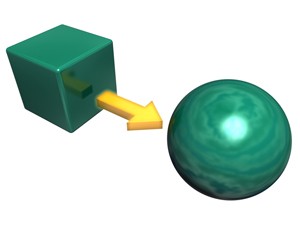 Nein, man will einfach etwas aufführen, das aus dem Rahmen fällt, schon deshalb mit Sicherheit ins Gespräch und ins Bild kommt, den einen schockiert, den anderen belustigt und alle beschäftigt. Ein Festvortrag bringt das nicht zu Stande, ein Streichquartett auch nicht. Wer Reichweite sucht, der muss es populistisch tun.
Nein, man will einfach etwas aufführen, das aus dem Rahmen fällt, schon deshalb mit Sicherheit ins Gespräch und ins Bild kommt, den einen schockiert, den anderen belustigt und alle beschäftigt. Ein Festvortrag bringt das nicht zu Stande, ein Streichquartett auch nicht. Wer Reichweite sucht, der muss es populistisch tun.
Der Begriff ist jünger als die Sache. Das Volk zu packen, an seinem Stolz, seiner Angst, an seinen Abneigungen und Vorlieben, es groß zu reden, mal zum Souverän, mal zum Vollstrecker eines „höheren“ Willens, ist eine alte Kunst der Mächtigen und jenen, die es sein oder werden wollen, der Priester und Tribunen, der Helden und Charismatiker, der Führer und Verführer. Wobei der Populismus nicht die Endstufe der Demagogie darstellt, nicht das Programm und nicht die Exekution von Politik, sondern eine Art Weichspülung, den ersten Arbeitsgang, ein erstes Verprechen, das Aufmerksamkeit erregt, Zulauf bewirkt, aber nur selten Erfüllung bringt.
 Dass Populismus etwas völlig Normales, eine durch Jahrhunderte abgeschliffene, trainierte Taktik wäre, die sich zum explodierenden Extremismus verhält wie tausend kleine, korrigierende Beben zum großen zerstörerischen Aufprall der Erdplatten, ist eine nicht gern vernommene Meinung; denn schon der leiseste Ausschlag des Seismographen verursacht in nicht nur aber gerade hier besonders gern gepflegten (Ernst Bloch: „Heidelberg ist ein Mekka des Geschwätzes“ – als ob er je eine Gemeinderatssitzung abgesessen hätte) Heidelberger Diskussionen eine Art pflichtgemäßer, nachgerade „geschuldeter“ Erregung – so als müsse man das politische Fundament, auf dem man steht, für erodiert halten. Eine Unruhe geht um, ein Gespenst: Der Populismus, den man fürchtet, rumort hier und wo man nur noch die Zukunft ängstlicher betrachtet als die Vergangenheit, ist der Populismus-Vorwurf wohlfeil. Er trifft sozusagen prophylaktisch jeden, der sich an Fragen reibt wie Sperrzeitverkürzung, Neckarufertunnel oder Notweg (dessentwegen, um Menschenleben zu retten, einige Büsche hätten weichen müssen) oder Verlängerung der Einwanderung und Einbürgerung, Modernisierung und Globalisierung reibt, nicht nur Konservative, sondern gleichermaßen Politiker jedweder Farbe, je nachdem, wovon die Rede ist. Der populistische Popanz: Moderne Angst verengt seine Definition.
Dass Populismus etwas völlig Normales, eine durch Jahrhunderte abgeschliffene, trainierte Taktik wäre, die sich zum explodierenden Extremismus verhält wie tausend kleine, korrigierende Beben zum großen zerstörerischen Aufprall der Erdplatten, ist eine nicht gern vernommene Meinung; denn schon der leiseste Ausschlag des Seismographen verursacht in nicht nur aber gerade hier besonders gern gepflegten (Ernst Bloch: „Heidelberg ist ein Mekka des Geschwätzes“ – als ob er je eine Gemeinderatssitzung abgesessen hätte) Heidelberger Diskussionen eine Art pflichtgemäßer, nachgerade „geschuldeter“ Erregung – so als müsse man das politische Fundament, auf dem man steht, für erodiert halten. Eine Unruhe geht um, ein Gespenst: Der Populismus, den man fürchtet, rumort hier und wo man nur noch die Zukunft ängstlicher betrachtet als die Vergangenheit, ist der Populismus-Vorwurf wohlfeil. Er trifft sozusagen prophylaktisch jeden, der sich an Fragen reibt wie Sperrzeitverkürzung, Neckarufertunnel oder Notweg (dessentwegen, um Menschenleben zu retten, einige Büsche hätten weichen müssen) oder Verlängerung der Einwanderung und Einbürgerung, Modernisierung und Globalisierung reibt, nicht nur Konservative, sondern gleichermaßen Politiker jedweder Farbe, je nachdem, wovon die Rede ist. Der populistische Popanz: Moderne Angst verengt seine Definition.
Gut und Böse bedienen sich der Triebkräfte im Volk, die sich verstärken, instrumentieren, instrumentalisieren und besänftigen lassen. Dass Populismus ohne Krise nicht zu begreifen sei, ist ein Irrtum. Auch Wohlfahrt und ihre Gewährleistungen nämlich sind Mittel, die politischen Segel zu stellen.

